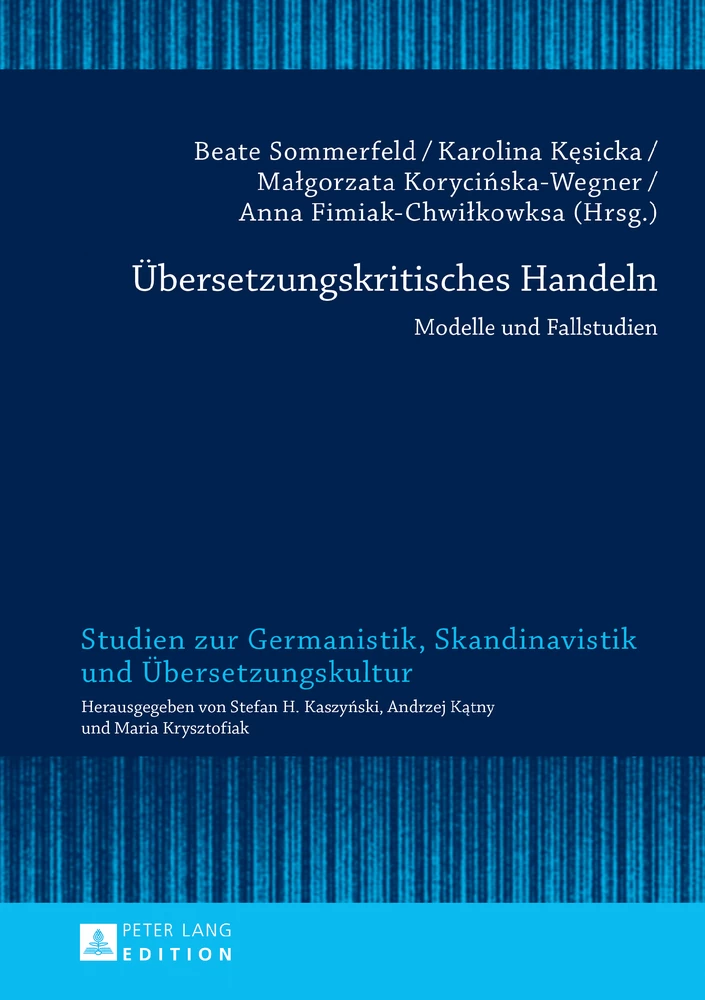Übersetzungskritisches Handeln
Modelle und Fallstudien
Summary
Excerpt
Table Of Contents
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorengaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Inhaltsverzeichnis
- Übersetzungskritisches Handeln – Modelle und Fallstudien. Vorwort der Herausgeberinnen
- Bibliographie
- Repräsentativität und Wandel der Übersetzungskultur (Maria Krysztofiak)
- 1. Pragmatik der Kulturvermittlung, getragen im Sprachbild „belesen wie ein Schwede”
- 2. Zur Kategorie der Repräsentativität des Übersetzers und der Übersetzung
- 3. Transkulturalität der Übersetzung
- 4. Übersetzungen als Identität sichernde Bestandteile in der Begegnung der Kulturen
- 5. Mediale Sichtbarkeit und meinungsbildende Marktstrategien
- Bibliographie
- Zum Spannungsverhältnis zwischen ästhetischen und linguistischen Qualitätskriterien literarischer Übersetzungen (Małgorzata Jokiel)
- 1. Einführung
- 2. Begriffsdifferenzierung
- 2.1. Übersetzungskritik
- 2.2. Übersetzungsvergleich
- 2.3. Übersetzungsbewertung
- 3. Zu Integrationsversuchen linguistischer und ästhetischer Kriterien der Übersetzungsqualität
- 3.1. Deskriptive Übersetzungsforschung
- 3.2. Integrativer Ansatz von Mary Snell-Hornby
- 4. Der Evaluierungsansatz von Kupsch-Losereit
- 4.1. Funktionsgerechtigkeit4
- 4.2. Kulturspezifische Texterwartungen. Textsorten und Gebrauchsnormen
- 4.3. Textkohärenz und Textdynamik
- 4.4. Kontextwechsel
- 4.5. Verständlichkeit und Interpretierbarkeit
- 4.6. Zielmedium und Medienabhängigkeit
- 4.7. Sprachliche Konvention
- 5. Schlussbetrachtung
- Bibliographie
- Graphic novel (comic) and translation: constitutive components and selective deviation evaluated (Brigitte Schultze)
- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- Bibliography
- I. Source texts and translations
- II. Secondary literature
- Neues vom Asteroiden B 612 – Die deutschen Neuübersetzungen von Le petit prince von Antoine de St. Exupéry aus übersetzungskritischer Perspektive (Beate Sommerfeld)
- 1. Elisabeth Edl
- 2. Hans Magnus Enzensberger
- 3. Peter Sloterdijk/ Nicolas Mahler
- Bibliographie
- Primärliteratur
- Sekundärliteratur
- Paul Maars Sams als das „fremde Kind“ in der polnischen Übersetzung (Eliza Pieciul-Karmińska)
- Das Motiv des „fremden Kindes“
- Das Sams als das fremde Kind
- „Das fremde Kind“ in polnischer Rezeption
- Das Sams auf Polnisch und ob es gelingen konnte
- Schlussfolgerungen
- Bibliographie
- Primärliteratur
- Sekundärliteratur
- Übersetzungsbedingte Modifizierungen in der Erzählstruktur von Mato Lovraks Roman Der Zug im Schnee. Ein Beitrag zur Erforschung des kroatisch-deutschen Kulturtransfers im Bereich der Kinder- und Jugendliteratur (Tihomir Engler / Sanja Cimer)
- 1. Mato Lovrak als kroatischer Kinder- und Jugendbuchklassiker
- 2. Kroatische Textvorlage und die deutsche Übersetzung
- 3. Adaption von kinderliterarischen Texten
- 4. Analyse der angewandten Adaptationsstrategien
- 4.1. Auslassung bzw. Kürzung von didaktisierten Textstellen
- 4.2 Behandlung kultureller Merkmale des Ausgangstextes
- 4.2.1 Betonung des Fremden
- 4.2.2 Neutralisierung des Fremden
- A. Neutralisierung durch Übersetzung mit neutralem Ausdruck
- B. Neutralisierung durch Auslassung
- 4.2.3 Einbürgerung des Fremden durch Lokalisierung
- 4.3 Erzähltechnische Modifizierungen des Ausgangstextes
- 5. Schlussfolgerung
- Bibliographie
- Primärliteratur
- Sekundärliteratur
- A few Remarks on Danish Translations of a Catholic Latin Hymn (Joanna Cymbrykiewicz)
- Bibliography
- Internet sources
- Kulturkompetenz in der Übersetzung senegalesischer Literatur ins Deutsche (Cheikh Anta Babou)
- 1. Einleitung
- 2. Zur Kulturkompetenz in der literarischen Übersetzung
- 3. Analyse der Kulturspezifika in der deutschen Übersetzung von La grève des Bàttu
- 4. Abschließende Bemerkungen
- Bibliographie
- Primärliteratur
- Sekundärliteratur
- Interkulturelle Kompetenz als Grundvoraussetzung für angemessene Übersetzung (Magloire Kengne Fokoua)
- 1. Einleitung
- 2. Das Konzept der interkulturellen Kompetenz
- 3. Das Untersuchungsmaterial
- 4. Zur Untersuchungsmethode
- 5. Interkulturelle Kompetenz in der translatorischen Praxis
- 5.1. Skoposangemessene Übersetzung vor dem Hintergrund der effizienten Anwendung der interkulturellen Kompetenz
- 5.2. Strategien zur Erhaltung der Skoposangemessenheit auf der inhaltlichen Ebene
- 5.3. Mittel zur Erhaltung der Skoposangemessenheit auf der Bezeichnungsebene
- 5.4. Nichtgelungene Übersetzung wegen des Mangels an interkultureller Kompetenz
- 5.4.1. Übersetzungsfehler
- 5.4.2. Verzicht auf das Verfahren der Explizitation
- 5.5. Der Beitrag der interkulturellen Kompetenz zur skoposangemessenen Übersetzung
- Bibliographie
- Primärliteratur
- Sekundärliteratur
- Aus der Geschichte des „Samisdat” am Beispiel der tschechischen Übersetzung von „Polskie Państwo Podziemne” / „Der polnische Staat im Untergrund“ von Władysław Bartoszewski (Ludmila Lambeinová)
- 1. Einleitende Bemerkungen
- 2. Die tschechische und die polnische Untergrundliteratur
- 3. Original und Übersetzung
- 4. Übersetzer und Herausgeber
- 5. Versuch einer translatologischen Analyse
- I. Satzbau
- II. Lexik
- III. Stilistik
- 6. Kulturelle Elemente und kulturelle Kompetenz
- 7. Schlussfolgerungen
- Bibliographie
- Primärliteratur
- Sekundärliteratur
- Zwischen Qualität und Kreativität? Am Beispiel der Erzählung „Panny z Wilka” von Jarosław Iwaszkiewicz und drei deutsche Übersetzungen (Anna Fimiak-Chwiłkowska)
- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- Bibliographie
- Primärtext und Übersetzungen
- Sekundärliteratur
- Substantialistische Übersetzung als humanistische Praxis. Zu Hölderlins Arbeit an Sophokles (Björn Freter)
- Vorbemerkung
- Philologische Probleme
- Substantialistische Übersetzung und Humanismus
- Bibliographie
- An inductive approach to translating German philosophy (Spencer Hawkins)
- Differential translation as an inductive approach
- Why German philosophy?
- Twentieth century cases: Husserl, Heidegger, Blumenberg, Freud
- Differential translation as a philosophical translation strategy
- Bibliography
- Primary Literature
- Secondary Literature
- Das (Nicht)Verständliche (nicht) verstehen. Über die Probleme des Übersetzens und Verstehens von Texten über das Übersetzen am Beispiel eines Essays von Paul Ricœur (Hanna Dymel-Trzebiatowska)
- Bibliographie
- Körper schreiben – Stilmerkmale der écriture féminine in Marlene Streeruwitz‘ Roman Verführungen. 3 Folge. Frauenjahre und ihre Wiedergabe in der polnischen Übersetzung (Joanna Bukowska)
- 1. Exponieren des Körperlichen in der Lexik
- 2. Satzrhythmus als Ausprägung weiblicher Schreibpraxis
- 3. Schlussfolgerungen
- Bibliographie
- Primärliteratur
- Sekundärliteratur
- Zu den AutorInnen
- Namensregister
Beate Sommerfeld / Karolina Kęsicka /
Małgorzata Korycińska-Wegner /
Anna Fimiak-Chwiłkowska (Hrsg.)
Übersetzungskritisches Handeln
Modelle und Fallstudien
![]()
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Gedruckt mit freundlicher Unterstützung des Instituts für Germanische Philologie der Adam-Mickiewicz-Universität Poznań.
Der Band wurde begutachtet von Prof. Dr. Krzysztof A. Kuczyński, Prof. Dr. Lech Kolago, Prof. UWM Ewa Kujawska-Lis, Dr. phil. habil. Gisela Thome, Dr. habil. Małgorzata Klentak-Zabłocka, Dr. habil. Agnieszka Haas
ISSN 2192-3310
ISBN 978-3-631-67569-4 (Print)
E-ISBN 978-3-653-07107-8 (E-PDF)
E-ISBN 978-3-631-71166-8 (EPUB)
E-ISBN 978-3-631-71167-5 (MOBI)
DOI 10.3726/b10739
© Peter Lang GmbH
Internationaler Verlag der Wissenschaften
Frankfurt am Main 2017
Alle Rechte vorbehalten.
Peter Lang Edition ist ein Imprint der Peter Lang GmbH.
Peter Lang – Frankfurt am Main · Bern · Bruxelles · New York · Oxford · Warszawa · Wien
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Diese Publikation wurde begutachtet.
Über das Buch
Die in diesem Buch versammelten Beiträge gehen der Frage nach einem zuverlässigen Maßstab für die sachgerechte Bewertung übersetzerischer Leistungen nach. Angesichts des sich in neuerer Zeit anbahnenden Wandels der Übersetzungslandschaft und in der sich als heterogene Theorielandschaft darbietenden Übersetzungskritik überprüfen die Autoren, inwiefern übersetzungskritische Modelle zur Qualitätssteigerung von Übersetzungen beitragen. Sie analysieren übersetzungskritische Ansätze aus der Perspektive des konkreten Übersetzungsfalls und heben dabei die Übersetzungskritik als ein komplexes Handlungsgefüge hervor.
Zitierfähigkeit des eBooks
Diese Ausgabe des eBooks ist zitierfähig. Dazu wurden der Beginn und das Ende einer Seite gekennzeichnet. Sollte eine neue Seite genau in einem Wort beginnen, erfolgt diese Kennzeichnung auch exakt an dieser Stelle, so dass ein Wort durch diese Darstellung getrennt sein kann.
Inhaltsverzeichnis
Übersetzungskritisches Handeln – Modelle und Fallstudien. Vorwort der Herausgeberinnen
Repräsentativität und Wandel der Übersetzungskultur
Zum Spannungsverhältnis zwischen ästhetischen und linguistischen Qualitätskriterien literarischer Übersetzungen
Graphic novel (comic) and translation: constitutive components and selective deviation evaluated
Neues vom Asteroiden B 612 – Die deutschen Neuübersetzungen von Le petit prince von Antoine de St. Exupéry aus übersetzungskritischer Perspektive
Paul Maars Sams als das „fremde Kind“ in der polnischen Übersetzung
Übersetzungsbedingte Modifizierungen in der Erzählstruktur von Mato Lovraks Roman Der Zug im Schnee. Ein Beitrag zur Erforschung des kroatisch-deutschen Kulturtransfers im Bereich der Kinder- und Jugendliteratur
A few Remarks on Danish Translations of a Catholic Latin Hymn
Kulturkompetenz in der Übersetzung senegalesischer Literatur ins Deutsche ←5 | 6→
Interkulturelle Kompetenz als Grundvoraussetzung für angemessene Übersetzung
Aus der Geschichte des „Samisdat” am Beispiel der tschechischen Übersetzung von „Polskie Państwo Podziemne” / „Der polnische Staat im Untergrund“ von Władysław Bartoszewski
Zwischen Qualität und Kreativität? Am Beispiel der Erzählung „Panny z Wilka” von Jarosław Iwaszkiewicz und drei deutsche Übersetzungen
Substantialistische Übersetzung als humanistische Praxis. Zu Hölderlins Arbeit an Sophokles
An inductive approach to translating German philosophy
Das (Nicht)Verständliche (nicht) verstehen. Über die Probleme des Übersetzens und Verstehens von Texten über das Übersetzen am Beispiel eines Essays von Paul Ricœur
Körper schreiben – Stilmerkmale der écriture féminine in Marlene Streeruwitz‘ Roman Verführungen. 3 Folge. Frauenjahre und ihre Wiedergabe in der polnischen Übersetzung
Übersetzungskritisches Handeln – Modelle und Fallstudien. Vorwort der Herausgeberinnen
„Eine Theorie des Übersetzens muss sich an ihrer Theorie der Übersetzungskritik und allgemein an ihrer Theorie der Bewertung von Übersetzungs- und Dolmetschleistungen messen lassen. Allzu weit sind wir bei diesen Fragen noch nicht gekommen.“ Dieser kritische Befund von Margaret Ammann (1990: 211) scheint bis heute seine Gültigkeit nicht verloren zu haben. So scheitern die seit Jahrzehnten angestellten Bemühungen um eine objektive Bewertung der Übersetzungsqualität oftmals bereits an den divergierenden Auffassungen darüber, worin diese eigentlich bestehen soll oderwelche semantischen, sprachlichen, formalen oder auch funktionalen Kategorien als Vergleichsgrößen herangezogen werden sollen, um zu ermitteln, ob der gesetzte Qualitätsmaßstab erreicht worden ist (vgl. Thome 2012: 309). Die Übersetzungskritik bietet sich heute als recht heterogene Theorielandschaft dar. Der stetig anwachsende Fundus an theoretischen Arbeiten lässt es angeraten erscheinen, den Forschungsstand von Zeit zu Zeit kritisch zu hinterfragen und eine Zwischenbilanz zu ziehen. Dies wollen die in diesem Band versammelten Texte versuchen und damit einen Beitrag zur Lösung eines Problems leisten, mit dem sich die Translationswissenschaft und die Übersetzungskritik als ihre Teildisziplin seit Jahrzehnten beschäftigen: der Frage nach einem zuverlässigen Maßstab für die sachgerechte Bewertung übersetzerischer Leistungen. Das Aufstellen klarer Kriterien und das Transparentmachen der eigenen Wertmaßstäbe wird von der Übersetzungskritik seit langem eingefordert (vgl. Ammann 1990: 213), um die angebotenen Übersetzungslösungen in einem Zieltext „nicht rein subjektiv, sondern argumentativ und intersubjektiv nachvollziehbar“ bewerten zu können (Reiß 1989: 72).
Im Hintergrund der Beiträge steht die Frage, wie ein in Forschung und übersetzerischer Praxis anwendbares Instrumentarium zur Bewertung von Übersetzungsleistungen entwickelt werden kann, um zu vermeiden, dass ein theoretischer Überbau entwickelt wird, der in der Arbeit am konkreten Text, wenn beim Übersetzen pragmatische Entscheidungen getroffen werden müssen, nur wenig hilfreich ist. Gerade in dieser Hinsicht kommt der Übersetzungskritik eine wichtige vermittelnde Rolle zu, denn die übersetzerische Praxis stellt stets neue Anforderungen an die Translatkritik, die von der Theorie oftmals übersehen werden. In ihrer beständigen ‚Tuchfühlung‘ mit translatorischer Praxis erprobt Überset←7 | 8→zungskritik, wie viel von dem, was in den vergangenen Jahrzehnten erarbeitet wurde, in der Praxis ‚ankommt‘ und inwieweit übersetzungstheoretische Modelle auch im Hinblick auf den sich gerade in neuerer Zeit anbahnenden Wandel der Übersetzungslandschaft geeignet sind, die Qualität von übersetzerischen Leistungen zu verbessern. Deshalb erscheint es wichtig, dass in der Forschung übersetzungskritische Modellbildung und einzelne Fallstudien ineinandergreifen und übersetzerische Modelle von der Perspektive des konkreten Übersetzungsfalls aus immer wieder hinterfragt und gegebenenfalls revidiert werden.
In den hier vorgestellten übersetzungskritischen Versuchen soll der handlungstheoretische Ansatz von Holz-Mänttäri (1984, 1986) fruchtbar gemacht werden, der Übersetzung in eine allgemeine Handlungstheorie einbettet. Der Übersetzungsprozess rückt als äußerst komponentenreiches und komplexes Gefüge ins Licht, der sich daher auch einfacher und eindeutiger Bewertung entziehen muss (vgl. Stolze 2001: 200). Die Auffassung des Translationsprozesses als eines komplexen und aspektreichen Handlungsgefüges bringt einen Blick auf den Translator mit sich, der zu einem Kooperationspartner und gleichberechtigten Experten avanciert. In jüngerer Zeit wird das Konzept unter dem Begriff der Translationskultur weiterentwickelt (vgl. Schippel 2008; Prunč 1997, 2008; Krysztofiak 2010). Auch hier wird von einer partnerschaftlichen Beziehung von Übersetzer und Übersetzungskritiker ausgegangen. Nur wenn das von Prunč (2008: 30) geforderte Kriterium der Kooperativität erfüllt ist, können beide Seiten – Kritiker und Übersetzer – in den Prozess der Qualitätssteigerung von Übersetzungen eingebunden werden. Die Übersetzungskultur als einer der Faktoren, die auf die Übersetzungsentwürfe einzelner Übersetzer Einfluss nehmen, als der Übersetzung zugrunde gelegte Vorstellung vom Übersetzen, wird alternativ (oder zumindest ergänzend) zum Normbegriff ins Spiel gebracht. Besonders groß scheint die Tragweite des Konzepts für das Selbstverständnis des Kritikers selbst zu sein, ermöglicht es ihm doch eine Distanznahme und ein Relativieren der vorgenommenen Evaluierungen, denen jeweils Prämissen zugrunde liegen, die kritisch mitreflektiert werden müssen. Die Handlungsform der Translationskultur stellt die Übersetzungskritik damit in einen übergreifenden Rahmen, innerhalb dessen die Bedingtheit und kulturelle Verfasstheit von Übersetzungsnormen diskutiert werden können.
Hier setzt der erste Beitrag von Maria Krysztofiak Repräsentativität und Wandel der Übersetzungskultur ein. Die Posener Translationswissenschaftlerin nähert sich der Frage der Übersetzungsqualität aus einer weit gefassten deskriptiven Perspektive, wobei die Übersetzungsbewertung als übersetzungskritisches Handeln im Rahmen einer sich stets weiterentwickelnden Translationskultur verstanden wird. Zur wichtigsten Kategorie der Bewertung avanciert die Akzeptabilität der←8 | 9→ Übersetzung: Nur die Übersetzungen, die in der Zielkultur angenommen werden und die Probe der Zeit aushalten, können letztendlich als gelungen bewertet werden. Nur wenn der Übersetzer – wie es die Autorin am übersetzerischen Schaffen Mickiewiczs zeigt – den ‚Nerv der Zeit‘ trifft, können Übersetzungen stilbildend bzw. kulturbildend wirksam werden. Der Beitrag wendet sich drei für die Übersetzungsforschung grundlegenden Kategorien zu: der Übersetzungskultur, der Transkulturalität und der Repräsentativität der Übersetzung. Von der These Jiři Levýs (1969) ausgehend, der die Grundfunktion der Übersetzung als Repräsentation des Originalwerks in der Zielkultur auffasst, wird plausibel gemacht, dass dem Übersetzer eine Mitwirkung an der Prägung der Repräsentation abverlangt werden kann. Nur wenn es dem Übersetzer gelingt, der Konkretisierung des Ausgangstextes in der Zielkultur seinen unverwechselbaren Stempel aufzudrücken, wird er zu einem „zeitlosen Meister der Transkulturalität“. Übersetzer stehen damit stets in der Verantwortung vor dem Lesepublikum, die im Kontext der Pragmatik der Kulturvermittlung in der Zeit der Globalisierung gesehen werden muss. Die Autorin zeichnet ein differenziertes Bild von der deutschen, polnischen und skandinavischen Medienlandschaft, in die auch die Übersetzer eingebunden sind. So sind die Modelle der Begegnung der Kulturen heute nicht nur an Übersetzerpersönlichkeiten und Textästhetik, sondern auch an meinungsbildende Marktstrategien gebunden. Zwischen diesen Komponenten muss übersetzungskritisches Handeln ausgependelt werden. Als wichtiger Faktor wird das translatorische Talent ins Feld geführt, eine Kategorie, die sich eindeutiger Definition entzieht und damit zahlreichen Unwägbarkeiten Raum gibt. Dem begegnet die Autorin, indem sie für den Übersetzungsvergleich plädiert, um Talent textuell nachweisbar zu machen. Indem er die Komplexität der Rahmenbedingungen übersetzungskritischen Handelns in den Blick nimmt, legt der Text überzeugend dar, dass auch die historisch-deskriptive Übersetzungswissenschaft durchaus wertvolle Ansätze zu einer fundierten Übersetzungskritik zu bieten hat.
Details
- Pages
- 238
- Publication Year
- 2017
- ISBN (Hardcover)
- 9783631675694
- ISBN (ePUB)
- 9783631711668
- ISBN (MOBI)
- 9783631711675
- ISBN (PDF)
- 9783653071078
- DOI
- 10.3726/b10739
- Language
- German
- Publication date
- 2016 (December)
- Keywords
- Übersetzungskritik Literarische Übersetzung Übersetzungskritisches Handeln Translationswissenschaft Translatqualität Übersetzung
- Published
- Frankfurt am Main, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 2017. 238 S., 4 s/w Tab.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG