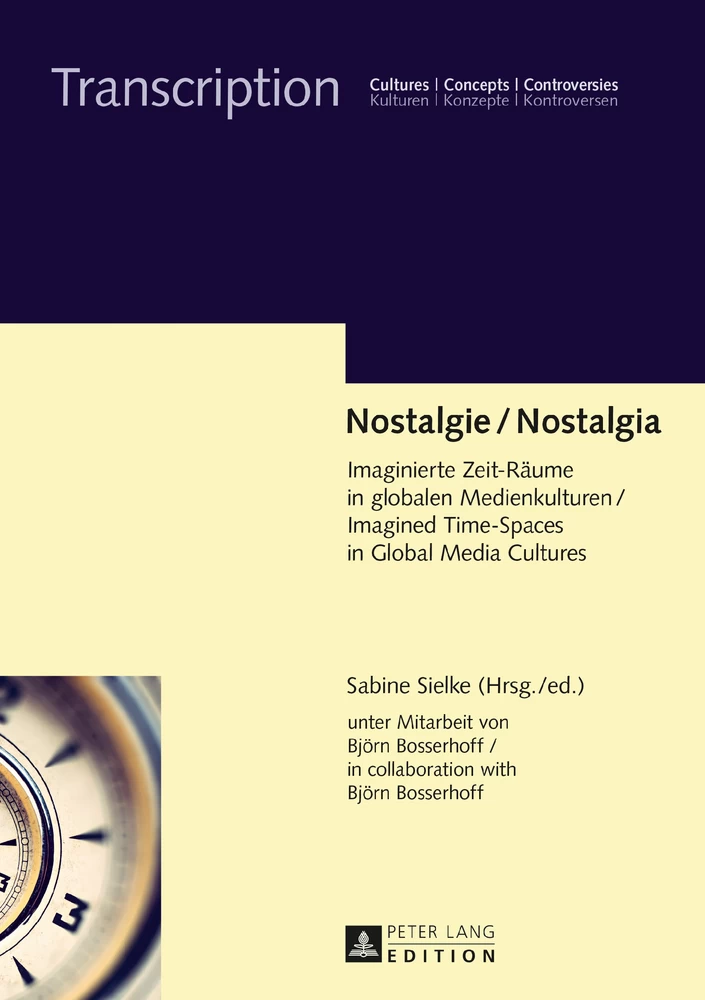Nostalgie / Nostalgia
Imaginierte Zeit-Räume in globalen Medienkulturen / Imagined Time-Spaces in Global Media Cultures
Zusammenfassung
Nostalgia booms – both as cultural phenomenon and as research object. Yet what is nostalgia, and how does it work? This book shows how nostalgia aims at arresting time and channels our perception. Inextricably entwined with the rise of new media technologies and processes of consumption, nostalgia and retro create imagined time-spaces which reinvent the past and face the future.
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Umschlag
- Schmutztitel
- Serienseite
- Titelseite
- Copyright-Seite
- General Editor’s Preface
- Inhalt
- Sabine Sielke Nostalgie – ‚die Theorie‘: eine Einleitung
- Narrating Nostalgia: Literarische Zeitreisen
- Christian Moser „An eternal image of youth and innocence“: Das tote Kind als Medium nostalgischen Erinnerns und poetischer Kreativität in der Literatur der Romantik
- Hannes Bergthaller Futures Past and Futures Present: Nostalgia and the Temporality of Science Fiction in William Gibson’s Pattern Recognition
- Christian Kloeckner Risk and Nostalgia: Fictions of the Financial Crisis
- Simone Knewitz White Middle-Class Homelessness: Nostalgia from Babbitt to Mad Men
- Imaging Nostalgia: Zeit-Räume visueller Medien
- Michael Wetzel Die Sichtbarkeit des Maschinenraums: Steampunk als Nostalgie
- Marion Gymnich Celebrating the British 1950s: ‘Serial Nostalgia’ in the TV Series Call the Midwife
- Hans-Georg Moeller Retro: Anmerkungen zur Theorie in Europa und zur Praxis in China
- Bettina Schlüter Ghouls ’n Ghosts – Medium ’n Form: Retroästhetik in digitalen Medien
- Inhabiting Nostalgia: Sehnsuchtsorte, weltweit
- Antje Gunsenheimer und Markus Melzer Mexikos „Magische Dörfer“: Ein staatliches Programm für Nostalgiephänomene im öffentlichen Raum
- Winfried Schenk Überlegungen zum Verhältnis von Landschaft und Nostalgie
- Kikuko Kashiwagi-Wetzel Ein Bahnhof aus Backstein: Japans Sehnsucht nach Europa
- Jan-Erik Steinkrüger Nostalgie in thematisierten Welten: „Main Street, USA“, Celebration (Florida) und der Mythos der US-amerikanischen Kleinstadt
- Nico Völker Brownstones and Basketballs: Brooklyn, Gentrification, and the Politics of Nostalgia
- Sabine Sielke Nostalgia for New York
- Autor(inn)en
Transcription
Cultures | Concepts | Controversies
Kulturen | Konzepte | Kontroversen
Edited by/Herausgegeben von
Sabine Sielke
Vol./Bd. 9
General Editor’s Preface
Transcription: Cultures – Concepts – Controversies is dedicated to publishing work that explores culture as cultures; work that interrogates the concepts, methods, and theories through which we map these explorations of cultures; and work that intervenes into the controversies that necessarily arise when we negotiate the complexities of cultures and cultural concepts.
Transcription focuses on, yet is by no means limited to, interdiscursive explorations of North American cultures and cultural practices. Recognizing that cultures tend to travel across regional and national boundaries – and increasingly do so in the age of digital media –, Transcription at the same time holds that concepts like cultural difference and nation remain relevant. For whenever boundaries collapse, new ones are likely to be formed.
The term ‘transcription’ acknowledges that all cultures engage in acts of copying, translating, and transforming performed, spoken, written, or digitalized sounds, languages, and codes from one medium into another. Only as close readers of these acts and processes of transformation can we achieve cultural literacy. With its multiple resonances within the human, social, and natural sciences the concept transcription also creates the frame for a wide range of transdisciplinary perspectives. Our close readings therefore aspire to travel far.
Referring, more specifically, to processes of encoding and transferring genetic information, Transcription recognizes the concurrence of cultural change, epistemological shifts, and scientific development. Taking up the challenges that the natural sciences pose to the humanities and social sciences, Transcription proposes to engage in dialogues between seemingly distant disciplines. Only in this way, it seems, can some of the most urgent cultural controversies be addressed productively.
Thus Transcription is informed by the awareness that our notions of cultures, concepts, and controversies are themselves part of an ongoing process of transcription, a process in which this series intends to take an active part.
Sabine Sielke
Inhalt
Sabine Sielke
Narrating Nostalgia: Literarische Zeitreisen
Christian Moser
Hannes Bergthaller
Christian Kloeckner
Simone Knewitz
White Middle-Class Homelessness: Nostalgia from Babbitt to Mad Men
Imaging Nostalgia: Zeit-Räume visueller Medien
Michael Wetzel
Die Sichtbarkeit des Maschinenraums: Steampunk als Nostalgie
Marion Gymnich
Celebrating the British 1950s: ‘Serial Nostalgia’ in the TV Series Call the Midwife
Hans-Georg Moeller
Retro: Anmerkungen zur Theorie in Europa und zur Praxis in China
Bettina Schlüter
Ghouls ’n Ghosts – Medium ’n Form: Retroästhetik in digitalen Medien
Inhabiting Nostalgia: Sehnsuchtsorte, weltweit
Antje Gunsenheimer und Markus Melzer
Mexikos „Magische Dörfer“: Ein staatliches Programm für Nostalgiephänomene im öffentlichen Raum
Winfried Schenk
Kikuko Kashiwagi-Wetzel
Jan-Erik Steinkrüger
Nico Völker
Brownstones and Basketballs: Brooklyn, Gentrification, and the Politics of Nostalgia
Sabine Sielke
Sabine Sielke
Nostalgie – ‚die Theorie‘: eine Einleitung
Nostalgia isn’t what it used to be.1
Nostalgie ist ein Phänomen der Moderne, das – ähnlich wie Kitsch – keinen guten Ruf und dennoch seit einiger Zeit wieder Hochkonjunktur hat. Erstmals 1688 durch den Arzt Johannes Hofer als pathologisches Heimweh beschrieben, das bei Schweizerischen Söldnern zum Tode führe, boomt Nostalgie aktuell allerorten – als Diskurs und kulturelles Phänomen wie als Gegenstand der Forschung. Der Begriff bezeichnet dabei, zumeist recht unscharf, mal ein Terrain mit Erinnerungswert – „Das Freibad ist […] ein Ort der Nostalgie“, war kürzlich in einer Kolumne der Wochenzeitschrift die zeit lesen (Jessen) –, mal einen rückwärtsgewandten Politikstil, der Donald Trumps „economics of nostalgia“ (Irwin) ebenso zu kennzeichnen scheint wie Tendenzen xenophober Rhetorik in Europa und nationale Alleingänge namens Brexit. Zumeist umschreibt Nostalgie die unbestimmte Sehnsucht nach einer Zeit, in der vermeintlich alles noch klar und übersichtlich war – eine Zeit, so ist sich die Forschung weitgehend einig, die so nie war.
Grundsätzlich jedoch fehlt es dem proliferierenden Forschungsfeld ‚Nostalgie‘ an Einigkeit in fundamentalen Fragen: Was Nostalgie eigentlich ist, wie sie ‚funktioniert‘ und welche kulturellen Effekte sie bewirkt, kann trotz der vielen rezenten Publikationen zum Thema noch nicht so recht beantwortet werden. Auch eine „Geschichte der Nostalgie“, die der Soziologe Richard Sennett bereits 1977 angemahnt hat, muss noch geschrieben werden.2 Gleiches gilt für die Geschichte des Begriffs Nostalgie, der in einem breiten, konzeptuell jedoch wenig konzisen Forschungsfeld bislang noch keine klaren Konturen entwickelt hat und für nicht wenige Autor(inn)en keiner weiteren Erläuterung bedarf.3 Wenngleich diese Geschichte aufgearbeitet scheint, bezieht sich die Forschung – wie z. B. Michael D. Dwyers rezente Studie Back to the Fifties: Nostalgia, Hollywood Film, and Popular Music of the Seventies and Eighties (2015) – oftmals lediglich auf die historische Entwicklung des Konzepts in der Psychologie.4 Nicht zuletzt weil viele Untersuchungen unter dem Stichwort Nostalgie vornehmlich aktuelle Retrophänomene ins Visier nehmen, ohne sauber zwischen Retro und Nostalgie zu trennen, verwischen die Konturen des Begriffs zunehmend. Gleichzeitig häufen sich ‚Genrebezeichnungen‘, die von „designer nostalgia“ (Huppatz) und „culinary nostalgia“ (Mannur) über „campaign nostalgia“ (O’Brien und Li) bis zu „social nostalgia“ (Abeyta et al.), „imperialist“ (Rosaldo) und „anti-imperialist nostalgia“ reichen (Wenzel), unser Verständnis von Nostalgiephänomenen jedoch nicht schärfen, sondern die Konstellationen ihrer Wirkmacht weiter verunklaren.
Schließlich ist Nostalgie bis heute weitgehend ein „Phänomen ohne Theorie“ geblieben; auch dies hat Dieter Baacke schon vor vierzig Jahren moniert. Selbst da, wo Theorie drauf steht, wie z. B. in Josué Hararis Essay „Nostalgia and Critical Theory“, ist sie nicht notwendigerweise drin. 1989 in dem von Thomas W. Kavanagh herausgegebenen Band The Limits of Theory bei der Stanford University Press erschienen, scheint Hararis 25-seitiger Aufsatz diesem Buchtitel alle Ehre zu machen, fällt der Begriff „nostalgia“ doch lediglich im Titel und am Ende des Essays: „[O]ur entire literary and theoretical modernity“, ist dort zu lesen, „is predicated on a nostalgia for the real“ (191). Hararis Aufsatz ist dennoch erwähnenswert, denn er umreißt den Kontext, in dem das Konzept der Nostalgie seine bislang deutlichste Theoretisierung erfahren hat: die Moderne/Postmoderne-Diskussion (vgl. auch Frow). „When the real no longer is what it used to be“, so schreibt Jean Baudrillard in seinem Essay „The Precession of Simulacra“ (1984), „nostalgia assumes its full meaning. There is a proliferation of myths of origin and signs of reality: of secondhand truth, objectivity, and authenticity“ (257). In ihrem Aufsatz „Irony, Nostalgia, and the Postmodern“ (1998) bekräftigt und erweitert Linda Hutcheon diese Argumentation: „[D]enying or at least degrading the present as it is lived, nostalgia makes the idealized (and therefore always absent) past into the site of immediacy, presence, and authenticity“ (4).
Der Wunsch nach unvermittelter ‚Realität‘ und ‚Authentizität‘, der Nostalgiephänomenen anhaftet, ist nicht zuletzt ein Effekt globaler Medienkulturen, die uns heterogene Wirklichkeiten hypermedial aufbereiten und scheinbar synchron über homogene Bildoberflächen vermitteln. Diese Form der Zeiterfahrung hat wiederum signifikante kulturelle Effekte, die die Medienwissenschaftler Jay Bolter und David Grusin als „double logic of remediation“ umschrieben haben: „our culture’s contradictory imperatives for immediacy and hypermediacy“. Oder wie die Autoren in der Einleitung ihrer Studie Remediation: Understanding New Media (2000) erläutern: „Our culture wants to both multiply its media and erase all traces of mediation; ideally, it wants to erase its media in the very act of multiplying them“ (5). Nostalgiephänomene folgen eben dieser Logik: Sie leisten der zunehmenden Mediatisierung unserer Weltwahrnehmung und damit auch Prozessen der Modernisierung einerseits Widerstand. Andererseits sind Nostalgiephänomene jedoch – so eine Prämisse dieses Buchs – maßgeblich bedingt durch die Emergenz neuer und neuester Medientechnologien und -ästhetiken, die – wie insbesondere Fotografie, Film und digitale Formate – Zeit in neuer Form erfahr- und formbar gemacht haben.
Der Boom von Nostalgie und Retro selbst steht in enger Wechselwirkung mit einer veränderten Zeiterfahrung, in der Historizität zunehmend umfassender Synchronizität zu weichen scheint. Bereits Fredric Jameson korreliert in seinem Essay „Postmodernism and Consumer Society“ (1983) das Genre des „nostalgia films“ am Beispiel von George Lucas’ American Graffiti (1973) mit dem allgemeinen Verlust eines Geschichtssinns („disappearance of a sense of history“ 125) und einer Kommodifizierung von Vergangenheit. Für Jameson ist dies ein kultureller Prozess, der das Fortleben des Spätkapitalismus sicherstellt. Francis Fukuyama hat seine These vom „Ende der Geschichte“ (1989, 1992) bekanntermaßen relativiert; und dennoch unterstreicht auch sie den Zusammenhang zwischen einer (vermeintlichen) Irrelevanz von Geschichte bzw. einem veränderten Geschichtsverständnis und einer zunehmenden Bedeutung von Nostalgie und Retrowellen für unsere Zeiterfahrung. Auch die seit Anfang der 1990er Jahre proliferierende Erinnerungs- und Kognitionsforschung haben mit dazu beigetragen, dass traditionelle Konzepte von Geschichte weiter fragwürdig erschienen. Diese Forschung, die den Konstruktionscharakter von Erinnerung betont und folglich individuelle Geschichte(n) privilegiert, hat der Nostalgie auch die Bahn bereitet.
„Nostalgia is not something you ‘perceive’ in an object“, läßt sich bei Hutcheon lesen; „it is what you ‘feel’ when two different temporal moments, past and present, come together for you and, often, carry considerable emotional weight. In both cases, it is the element of response – of active participation, both intellectual and affective – that makes for the power“ (5). Als zentraler Nostalgieeffekt ist diese affektive Zeiterfahrung in der Tat nicht in Objekten, sondern in (Medien-)Ästhetiken begründet, die wir oftmals mit dem Begriff ‚Retro‘ fassen. Solchen Retroästhetiken ist eine Art Zeitindex eingeschrieben (vgl. Uricchio; Schlüter, „Digitale Kultur“), die als Spur vergangener kultureller Praktiken gelesen und damit Teil einer nostalgisch orientierten Kultur der ‚Zitate‘ werden kann. Nostalgieeffekte entstehen durch Phänomene, die die materiell-mediale Dimension vergangener Medienkonstellationen und Momente technologischer Entwicklung auf der Ebene der ästhetischen Form wahrnehmbar, hör- und sichtbar, machen. Dies erklärt nicht zuletzt die Proliferation von Nostalgie- und Retrophänomenen seit den 1990er Jahren, die mit der zunehmenden Bedeutung von Internettechnologien und anderen Faktoren der Beschleunigung des Alltags zu korrelieren scheinen, welche unsere Wahrnehmung von Zeitlichkeit maßgeblich verändert haben. Die futuristischen Designs der 1980er Jahre, die sich auf Ästhetiken der 1920er Jahre berufen,5 die handmade/do-it-yourself-Designs der 1950er und 60er Jahre, die in der Werbung von McDonald’s, Levi’s und Marlboro zum Einsatz kommen, und die Renaissance von Handschriften in der digitalen Typografie erscheinen somit als Signaturen vergangener Zustände und Zeiten. Nostalgiephänomene wollen wir folglich als ästhetisch vermittelte Techniken und Verfahrensweisen der Zeiterfahrung und Affektmodellierung verstehen, die spezifische Beziehungen zwischen Subjekten und Objekten herstellen, perpetuieren und permutieren. Sie sind damit auch produktive Indikatoren komplexer Raum-Zeit-Konstellationen mit grundlegender Bedeutung für die kulturwissenschaftliche Forschung.
In der engen Verbindung von Zeiterfahrung und Affektmodellierung scheint ein wesentliches Moment der Wirkmacht von Nostalgiephänomenen begründet. „Affect works as a magnifier of perception“, resümiert Aleida Assmann am Ende ihres Essays „Three Stabilizers of Memory: Affect – Symbol – Trauma“ (2003): “Affect memories bear the stamp of authenticity which is why they are cherished by individuals as inalienable property. Such vivid, somatic, and preverbial memories retain isolated scenes without a before or after” (29). Wenngleich Grenzen zwischen ‚affektlosem‘ und affektivem Gedächtnis schwer zu ziehen sind, befördert die Vorstellung, Affekte isolierten Erinnerungen aus einem konkreten Zeitrahmen, unser Verständnis der spezifischen Effekte von Nostalgiephänomenen. „Affective memories“ wären folglich besonders beweglich und sozusagen flexibel in neue Kontexte zu integrieren. Auch deshalb lässt sich ein Verständnis von Nostalgie nicht mehr auf ein „Zeitgefühl im westlichen Europa und den USA“, eine „unstabile, in Politik und Ökonomie praktisch nicht greifbar werdende Stimmung“ reduzieren (Baacke 449). Nostalgie ist keine Eigenheit westlicher Kulturen, sondern ein globales Phänomen, das in seinen kulturellen, politischen und ökonomischen Funktionen greifbar gemacht werden muss, will man seiner wachsenden Relevanz gerecht werden. Nostalgie lässt sich vielmehr als eine ästhetische „Eigenzeit“ bezeichnen (Schlüter, „Eigenzeiten“), die der Dynamisierung von Kultur und Gesellschaft Widerstand entgegensetzt und, wie Michael Wetzel in seinem Beitrag zum Steampunk formuliert, als eine „Figur der Kritik“, ja der „Globalisierungskritik“ gelesen werden kann.
Dabei gilt das Begehren der Nostalgie weniger einer idealisierten Vergangenheit als einer ‚besseren‘ Zukunft. „Die Nostalgie richtet sich auf einen Anfang“, heißt es bei Michael Rutschky (2005), „einen Ursprung, als noch nicht ausgemacht war, wie die Geschichte weitergeht. Als das Wünschen noch geholfen hat – als man sich für die Zukunft noch einen Idealzustand ausdenken durfte. Die Nostalgie richtet sich auf eine Zeit, in der alles noch Hoffnung und Erwartung ist; die retrograde Sehnsucht imaginiert eine entgegengesetzte, die sich restlos auf die Zukunft richtet, als alles noch offen war“ (1057). Nostalgie ist somit aber auch eine Form des fälschlichen Erinnerns, des Vergessens, und ein kreativer Akt, der Zeit-Räume entstehen lässt, die vorher nicht existent waren und die dennoch eine zentrale Bedeutung sowohl für individuelles Begehren als auch für ein jeweils spezifisches kulturelles Imaginäres entwickeln. Nostalgie inspiriert unsere Vorstellung von Zukunft, indem sie imaginiert, verbildlicht, materialisiert, was sein könnte. So erinnert sie eher nach vorn denn zurück, produziert Formen der Vorausschau anstelle von Rückblicken.6
Details
- Seiten
- 286
- Erscheinungsjahr
- 2017
- ISBN (Hardcover)
- 9783631699249
- ISBN (PDF)
- 9783631700815
- ISBN (ePUB)
- 9783631700822
- ISBN (MOBI)
- 9783631700839
- DOI
- 10.3726/b10535
- Open Access
- CC-BY
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2016 (Dezember)
- Schlagworte
- Retroästhetiken Zeitkonzepte Moderne Literatur Audio-visuelle Medien Populärkultur
- Erschienen
- Frankfurt am Main, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 2017. 286 S., 47 s/w Abb.
- Produktsicherheit
- Peter Lang Group AG