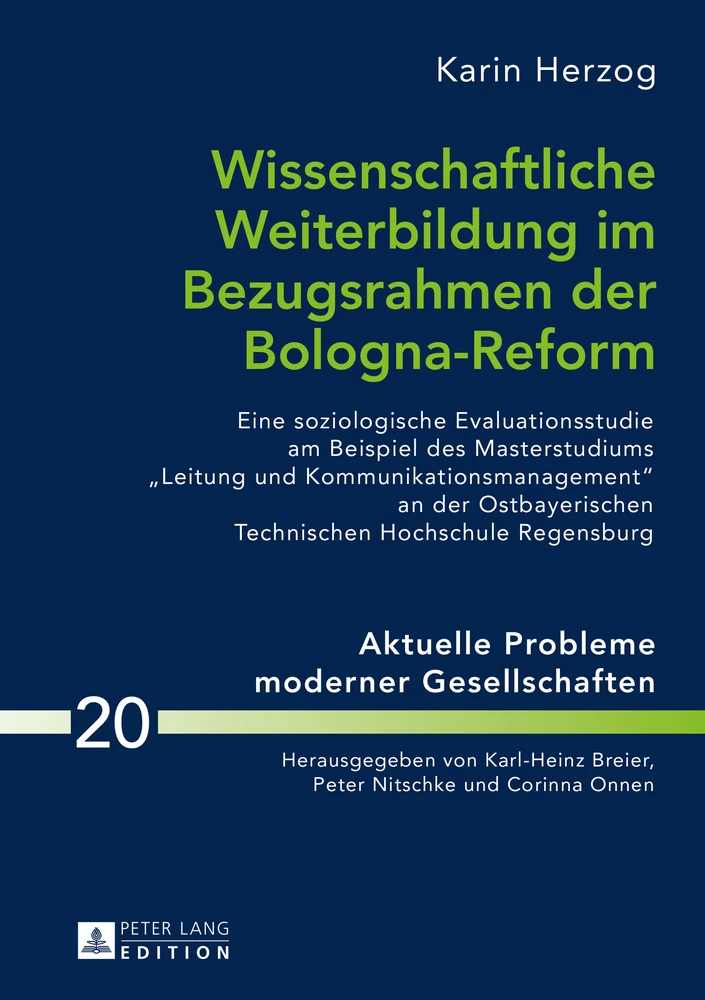Wissenschaftliche Weiterbildung im Bezugsrahmen der Bologna-Reform
Eine soziologische Evaluationsstudie am Beispiel des Masterstudiums «Leitung und Kommunikationsmanagement» an der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg
Summary
Excerpt
Table Of Contents
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Inhaltsverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Teil A Grundlagen
- 1 Der Bologna-Prozess in Deutschland: Stand und Perspektiven
- 1.1 Ausgangslage
- 1.2 Ziele des Bologna-Prozesses
- 1.2.1 Stand der Umsetzung 2015
- 1.2.2 Der Bildungsbegriff in Zeiten von Bologna
- 1.2.3 Kritische Stellungnahmen zur Hochschulreform
- 1.3 Anerkennung von Bachelor und Master bei den Studierenden
- 1.4 Anerkennung von Bachelor und Master in der Wirtschaft
- 1.4.1 Bevorzugter Abschluss – der Master
- 1.4.2 Anforderungen von Unternehmen an Hochschulabsolventen
- 1.4.3 Gehaltserwartungen bei Bachelor- und Masterabschlüssen
- 1.5 Wissenschaftliche Weiterbildung im Bologna-Prozess
- 1.5.1 Voraussetzungen für die Teilnahme an wissenschaftlicher Weiterbildung
- 1.5.2 Weiterbildungsangebote
- 1.5.3 Qualitätssicherung von (Weiterbildungs-) Studiengängen
- 2 Gender in der (wissenschaftlichen) Weiterbildung
- 2.1 Teilnahme in Deutschland an (wissenschaftlicher) Weiterbildung
- 2.2 Ziele und nachgefragte Inhalte
- 2.3 Geschlechtsspezifische Unterschiede in der Weiterbildung von Frauen und Männern
- 2.4 Konsequenzen im Bologna-Prozess
- 2.4.1 Kriterien geschlechtergerechten Studierens
- 2.4.2 Maßnahmen zur Umsetzung in der Lehre
- Teil B Empirische Erhebungen
- 3 Problemdarstellung
- 3.1 Vorstellung des Masterstudienganges „Leitung und Kommunikationsmanagement“
- 3.2 Ziele des Masterstudienganges
- 3.3 Ziele der Arbeit
- 4 Methodik und Vorgehensweise
- 4.1 Methoden
- 4.1.1 Qualitative Erhebung
- 4.1.2 Evaluationsstudie
- 4.2 Instrumente
- 4.2.1 Interviewgestaltung
- 4.2.2 Evaluationsfragebogen
- 4.2.3 „Follow-Up“-Fragebogen
- 4.3 Gütekriterien
- 4.4 Interviewdurchführung
- 4.4.1 Zeitlicher Rahmen
- 4.4.2 Im Vorfeld der Befragung
- 4.4.3 Setting
- 4.4.4 Interviewführung
- 4.5 Dokumentation der Daten
- 4.5.1 Interviewdaten
- 4.5.2 Fragebogendaten
- 4.6 Auswertungsverfahren
- 4.6.1 Inhaltsanalyse
- 4.6.1.1 Ablaufmodell der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring
- 4.6.1.2 Die Technik der Strukturierung
- 4.6.1.2.1 Allgemeines Ablaufmodell der strukturierenden Inhaltsanalyse
- 4.6.1.2.2 Inhaltliche Strukturierung
- 4.6.2 Kategoriensystem und Kodierregeln
- 4.6.2.1 Vorgehensweise
- 4.6.2.2 Kategorienbildung
- 4.6.2.3 Ankerbeispiele und Kodierregeln
- 5 Beschreibung der Stichprobe
- 6 Ergebnisse
- 6.1 Entscheidung für den Studiengang
- 6.1.1 Zufriedenheit mit bisheriger Ausbildung
- 6.1.2 Zufriedenheit mit bisheriger beruflicher Position
- 6.1.3 Entscheidung für den Studiengang aus persönlichem Interesse
- 6.1.4 Entscheidung für den Studiengang durch persönliches/fachliches Defizitempfinden
- 6.1.5 Entscheidung für den Studiengang durch (höher qualifizierte) Familienangehörige
- 6.1.6 Entscheidung für den Studiengang durch die höher qualifizierte Partnerin/den höher qualifizierten Partner
- 6.1.7 Entscheidung für den Studiengang durch das Berufsumfeld
- 6.2 Erwartungen an den Studiengang
- 6.2.1 Erwartungen in beruflicher Hinsicht
- 6.2.2 Erwartungen in persönlicher Hinsicht
- 6.2.3 Erwartungen an die Durchführung und Wertigkeit der Weiterbildung
- 6.3 K3 Bewertung des Studiengangs
- 6.3.1 Niveau des Studienganges
- 6.3.2 Durchführbarkeit des Studiums
- 6.3.3 Nutzen für die berufliche Praxis
- 6.3.4 Persönlicher Nutzen
- 6.3.5 Nutzen für den beruflichen Aufstieg
- 6.3.6 Unterstützung durch Dozentinnen und Dozenten
- 6.3.7 Einhalten von Zeitvorgaben
- 6.4 Bewertung des Studierens durch das Umfeld
- 6.4.1 Bewertung durch die Kolleginnen und Kollegen (einschließlich der Führungskraft)
- 6.4.2 Bewertung durch die Familie
- 6.4.3 Bewertung durch die Freunde
- 6.5 Bewertung der Studiengruppe
- 6.5.1 Heterogenität der Gruppe
- 6.5.2 Vorerfahrungen der einzelnen Teilnehmerinnen und Teilnehmer
- 6.6 (Didaktische) Qualität der Veranstaltungen
- 6.6.1 Bevorzugte Seminarform
- 6.6.2 Inhaltliche zielgruppenbezogene Aufbereitung
- 6.6.3 Prüfungsgestaltung
- 6.6.4 Angebotsvielfalt
- 6.7 Bewertung der Lehrenden
- 6.7.1 Zielgruppenorientiertheit
- 6.7.2 Fachkompetenz
- 6.7.3 Aktueller Praxisbezug
- 6.7.4 Leitungsverhalten
- 6.8 Bewertung der Rahmenbedingungen
- 6.8.1 Raumsituation
- 6.8.2 Verpflegung/Verpflegungsmöglichkeiten
- 6.8.3 Bibliothek (Öffnungszeiten, Angebot, Service)
- 6.9 Bewertung des Weiterbildungsanbieters
- 6.9.1 Organisation
- 6.9.2 Betreuung
- 6.10 Bewertung des Wissenszuwachses
- 6.10.1 Veränderungen im privaten Umfeld
- 6.10.2 Veränderung in der beruflichen Interaktion
- 6.11 Berufliche Entwicklung
- 6.11.1 Bereits stattgefundene berufliche Höherstufung
- 6.11.2 Erwartete bzw. gewünschte berufliche Höherstufung
- 6.11.3 Erwartungen an eine andere (höhere) Position
- 6.12 Erwartungen an die Hochschule nach Abschluss des Studiums
- 6.13 Zukunftspläne
- 6.13.1 Private Zukunftspläne
- 6.13.2 Berufliche Zukunftspläne
- 6.13.3 Weiterbildungspläne
- 6.14 Unterschiede in den Kohorten
- 6.15 Ergebnisse der semesterbegleitenden Kursevaluationen
- 6.16 Ergebnisse der „Follow-Up-Befragung“ im Sommer 2015
- 6.17 Hypothesenüberprüfung
- Teil C Diskussion der Ergebnisse
- 7 Interpretationen der Ergebnisse aus den Interviews
- 7.1 Entscheidungen für den Studiengang
- 7.2 Erwartungen an den Studiengang
- 7.3 Bewertung des Studiengangs
- 7.4 Bewertung des Studierens durch das Umfeld
- 7.5 Bewertung der Studiengruppe
- 7.6 (Didaktische) Qualität der Veranstaltungen
- 7.7 Bewertung der Lehrenden
- 7.8 Bewertung der Rahmenbedingungen
- 7.9 Bewertung des Weiterbildungsanbieters
- 7.10 Bewertung des Wissenszuwachses
- 7.11 Berufliche Entwicklung
- 7.12 Erwartungen an die Hochschule nach Abschluss des Studiums
- 7.13 Zukunftspläne
- 8 Diskussion der Ergebnisse der semesterbegleitenden Kursevaluationen
- 9 Diskussion der Ergebnisse der „Follow-Up-Befragung“ im Sommer 2015
- 10 Zusammenfassung der wichtigsten Aspekte
- Teil D Folgerungen
- 11 Konsequenzen für die wissenschaftliche Weiterbildung
- 11.1 Empfehlungen für die Durchführung von Weiterbildungsangeboten
- 11.2 Umsetzung der „Wissenschaftlichkeit“ in der Hochschulweiterbildung
- 12 Fazit und Ausblick
- Literaturverzeichnis
- Anhang
1 Der Bologna-Prozess in Deutschland: Stand und Perspektiven
Der Begriff „Bologna“ steht für einen Reformprozess, den Deutschland zusammen mit seinen europäischen Nachbarn im Jahre 1998 initiierte, um einen gemeinsamen europäischen Hochschulraum zu gestalten. Durch die Einführung von Bachelor und Master als „gestuftes Studiensystem“ sollten europaweit vergleichbare Abschlüsse dazu dienen, die Mobilität zu steigern, die Qualitätssicherung zu verbessern und das gemeinsame Wissenspotential besser zu nutzen.
Am 19. Juni 1999 schlossen sich dieser Idee dreißig europäische Staaten an und legten mit der Bologna-Erklärung den Grundstein für einen europäischen Hochschulraum, der inzwischen siebenundvierzig Mitgliedstaaten umfasst (vgl. BMBF 2015a).
Details
- Pages
- XVI, 305
- Publication Year
- 2016
- ISBN (Hardcover)
- 9783631676561
- ISBN (PDF)
- 9783631699935
- ISBN (ePUB)
- 9783631699942
- ISBN (MOBI)
- 9783631699959
- DOI
- 10.3726/978-3-631-69993-5
- Language
- German
- Publication date
- 2019 (March)
- Keywords
- Quartäre Bildung Akzeptanz Master Anerkennung Wirtschaft Genderaspekte Weiterbildung Akzeptanz Bachelor
- Published
- Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2016. XVI, 305 S., 15 farb. Abb., 16 s/w Abb., 8 Tab.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG