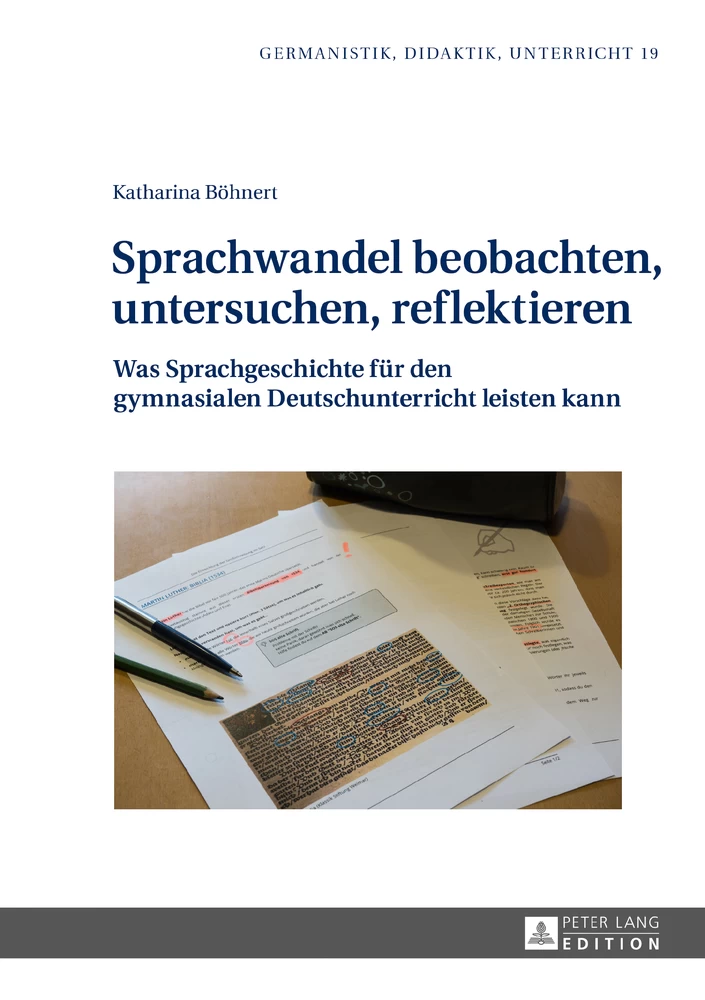Sprachwandel beobachten, untersuchen, reflektieren
Was Sprachgeschichte für den gymnasialen Deutschunterricht leisten kann
Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autoren-/Herausgeberangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Vorwort
- Inhaltsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis und Abbildungsnachweise
- Tabellenverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- I Einleitung und Fragestellung
- II Bestandsaufnahme
- 1 Definition des Untersuchungsbereichs
- 1.1 Sprachwandel und Neue Sprachgeschichte(n)
- 1.2 Sprachgeschichte und Didaktik
- 2 Sprachgeschichte in den Bildungsstandards und Lehrplänen
- 2.1 Forschungsstand
- 2.2 Forschungsziel und Hypothesen
- 2.3 Konzeption und Methodik
- 2.4 Darstellung und Interpretation der Ergebnisse
- 2.4.1 Bildungsstandards im Fach Deutsch
- 2.4.2 Lehrplan im Bundesland Rheinland-Pfalz
- 2.4.3 Lehrplan im Bundesland Thüringen
- 2.4.4 Zusammenfassung
- 3 Sprachgeschichte in den Lehrwerken
- 3.1 Forschungsstand
- 3.2 Forschungsziel und Hypothesen
- 3.3 Konzeption und Methodik
- 3.4 Darstellung und Interpretation der Ergebnisse
- 3.4.1 Lehrwerke in der Sek. I
- 3.4.2 Lehrwerke in der Sek. II
- 3.4.3 Zusammenfassung
- 4 Sprachgeschichte im Urteil von Lehrenden und Lernenden
- 4.1 Forschungsstand
- 4.2 Forschungsziel und Hypothesen
- 4.3 Konzeption und Methodik
- 4.4 Auswahl und Aufbau des Erhebungsinstruments
- 4.5 Darstellung und Interpretation der Ergebnisse
- 4.5.1 Sprachgeschichtsbezogene Vorstellungen und Unterrichtspraxis
- 4.5.2 Faktoren für den Einsatz: Sprachgeschichte im Lehramtsstudium
- 4.5.3 Sprachgeschichtsbezogene Einstellungen von Lehrenden und Lernenden
- 4.5.4 Zusammenfassung
- III Didaktische und methodische Vorüberlegungen
- 1 Thematische Ansätze
- 1.1 Sprachgeschichte(n) als Gesellschaftsgeschichte(n)
- 1.2 Sprachgeschichte systematisch: Fremdwörter
- 1.3 Sprachgeschichte und Normwandel: sprachliche Zweifelsfälle
- 2 Didaktische Zielperspektive: Sprachgeschichtsbewusstheit
- 2.1 Definition
- 2.2 Sprachgeschichtsdidaktische Prinzipien
- 2.2.1 Sprachgeschichte als kontinuierlicher Entwicklungsprozess
- 2.2.2 Sprachgeschichte als systematischer Entwicklungsprozess
- 2.2.3 Sprachgeschichte als spiralcurriculares Desiderat
- 2.2.4 Sprachgeschichte als Bestandteil des integrativen Deutschunterrichts
- 2.3 Zusammenfassung
- 3 Progression: Sprachwandel beobachten, untersuchen, reflektieren
- 4 Zusammenfassung
- IV Vorschläge zur unterrichtspraktischen Umsetzung
- 1 Rahmenbedingungen
- 2 Entwicklung der satzinternen Großschreibung
- 2.1 Einleitung
- 2.2 Fachwissenschaftlicher Hintergrund
- 2.2.1 Ontogenese und Didaktik
- 2.2.1.1 Lexikalischer Ansatz
- 2.2.1.2 Syntaktischer Ansatz
- 2.2.2 Historiogenese
- 2.2.3 Diskussion Pro/Contra satzinterne Großschreibung
- 2.2.3.1 Textproduktion
- 2.2.3.2 Textrezeption
- 2.3 Konkretisierung
- 2.3.1 Inhalte
- 2.3.2 Methoden
- 2.3.3 Kompetenzerwerb
- 3 Schulnamen im Wandel
- 3.1 Einleitung
- 3.2 Fachwissenschaftlicher Hintergrund
- 3.2.1 Eigennamen und Gattungsbezeichnungen
- 3.2.2 Inhaltsseitige Besonderheiten von Namen
- 3.2.3 Ausdrucksseitige Besonderheiten von Namen
- 3.2.4 Schulnamen diatopisch und diachron
- 3.2.4.1 Korpora
- 3.2.4.2 Einfache versus erweiterte Schulnamen
- 3.2.4.3 Bildungsmuster
- 3.2.4.4 Benennungsmotive
- 3.3 Konkretisierung
- 3.3.1 Inhalte
- 3.3.2 Methoden
- 3.3.3 Kompetenzerwerb
- 4 Anredewandel
- 4.1 Einleitung
- 4.2 Fachwissenschaftlicher Hintergrund
- 4.2.1 Historische Pragmatik
- 4.2.1.1 Linguistische Einordnung
- 4.2.1.2 Sprachliche Höflichkeit
- 4.2.1.3 Quellen historisch pragmatischer Forschung
- 4.2.1.4 Perspektivierung
- 4.2.2 Pronominaler Anredewandel im Deutschen
- 4.2.2.1 Ahd. und Mhd.
- 4.2.2.2 Fnhd. und Nhd.
- 4.2.2.3 Von der Pragmatik zur Grammatik?
- 4.2.2.4 Auf dem Weg zum universellen Du?
- 4.2.3 Anredesysteme in anderen Sprachen: Schwedisch
- 4.3 Konkretisierung
- 4.3.1 Inhalte
- 4.3.2 Methoden
- 4.3.3 Kompetenzerwerb
- V Zusammenfassung und Ausblick
- 1 Zusammenfassung
- 1.1 Der Stellenwert der Sprachgeschichte in der gegenwärtigen Unterrichtspraxis
- 1.2 Das didaktische Potential einer Reflexion über die Diachronie von Sprache
- 1.3 Die unterrichtspraktische Umsetzung von Sprachgeschichte und Sprachwandel
- 2 Ausblick
- Literaturverzeichnis
- Elektronischer Anhang
- Reihenübersicht
Abbildungsverzeichnis und Abbildungsnachweise
Abb. 1: Zwiebelmodell sprachlicher Ebenen
Abb. 2: Bausteine der Bestandsaufnahme
Abb. 3: Lern-/Kompetenzbereiche in den Bildungsstandards und Lehrplänen
Abb. 4: „App statt Adrema“ (Deutschbuch 9, S. 235)
Abb. 5: „Der Nibelungen Untergang“ (P.A.U.L. D. 7, S. 152ff.)
Abb. 6: Bausteine der didaktischen und methodischen Vorüberlegungen
Abb. 7: Sprache und Gesellschaft – zwei mögliche Perspektiven
Abb. 8: Phasen der Entlehnung im Germanischen/Deutschen
Abb. 9: Grammatikalisierung von Adpositionen
Abb. 10: Sprachgeschichtsbewusstheit – Voraussetzungen und geförderte Kompetenzen
Abb. 11: Sprachwandel – Lernschritte und Kompetenzerwerb
Abb. 12: Sprachgeschichtsbezogene Didaktik im Deutschunterricht
Abb. 13: Bausteine der Didaktisierungsvorschläge
Abb. 14: Konkreta im System der Wortarten
Abb. 15: Korrelation zwischen Individualität und Belebtheit
Abb. 16: Modell der konzeptionellen Mündlichkeit/Schriftlichkeit
Abb. 17: Arbeitsblatt „Groß- und Kleinschreibung bei Luther“
Abb. 18: Arbeitsblatt „Die Entwicklung der Großschreibung im Überblick“ 1
Abb. 19: Arbeitsblatt „Die Entwicklung der Großschreibung im Überblick“ 2
Abb. 20: Arbeitsblatt „Vor- und Nachteile der SIG“
Abb. 21: Arbeitsblatt „Relevanzprinzip“
Abb. 22: Arbeitsblatt „Projekt Rechtschreibcoaches“
Abb. 23: Arbeitsblatt „CMC-Korpus“
Abb. 24: Eigennamen im semiotischen Dreieck
Abb. 25: Klassifikation von Eigennamen ← 11 | 12 →
Abb. 26: Die Region Rheinhessen im Bundesland Rheinland-Pfalz
Abb. 27: Anteil erweiterter Schulnamen
Abb. 28: Anteil kompositionell eingebundener Schulnamen
Abb. 29: Anteil anthroponymisch erweiterter Schulnamen
Abb. 30: Anteil regional markierender Namenerweiterungen
Abb. 31: Arbeitsblatt „Schulnamenprojekt“
Abb. 32: Stufen der pronominalen Anrede im Deutschen
Abb. 33: Pfad der Höflichkeit durch das deutsche Pronominalparadigma
Abb. 34: Arbeitsblatt „Pragmatik“
Abb. 35: Arbeitsblatt „Brown/Levinson 1987“
Abb. 36: Sprachgeschichtsbezogene Didaktik im Deutschunterricht ← 12 | 13 →
Abdruck mit freundlicher Genehmigung von:
Abb. 4: „App statt Adrema“ (Deutschbuch 9, S. 235)
© Cornelsen Schulbuchverlage GmbH, Berlin 2015.
Abb. 5: „Der Nibelungen Untergang“ (P.A.U.L. D. 7, S. 152ff.)
© Schöningh Schulbuchverlag, Paderborn 2014,
© Hansen, W.: Wo Siegfried starb und Kriemhild liebte: Die Schauplätze des Nibelungenliedes. DTV, München 2004.
© Nibelungenlied, Hohenems-Laßbergsche Nibelungenlied-Handschrift C, Badische Landesbibliothek, Karlsruhe
© Walther von der Vogelweide, mit übergeschlagenen Beinen auf einem Stein sitzend und meditierend, Codex Manesse, um 1170 bis um 1230, akg images, Berlin.
Abb. 17–23, 31, 34–36: Arbeitsblätter
© tutory UG.
Abb. 17: Arbeitsblatt „Groß- und Kleinschreibung bei Luther“
© Luther: Biblia, Klassik Stiftung Weimar, Weimar 1545,
© Cliparts, Microsoft Corp., Redmond.
Abb. 26: Die Region Rheinhessen im Bundesland Rheinland-Pfalz
© Rheinland-Pfalz-Gastgeber.
Abb. 31: Arbeitsblatt „Schulnamenprojekt“
© Wettbewerbslogo „Literaturwettbewerb Rheinland-Pfalz“, Fachverband Deutsch Rheinland-Pfalz im Deutschen Germanistenverband.
Tab. 1: Anteil der Lernbereiche an den Pflichtstunden in Grund- und Leistungskurs
Tab. 2: Sprachgeschichte in den Bildungsstandards und Lehrplänen
Tab. 3: Sprachgeschichte und Sprachwandel in Deutschlehrwerken der Sek. I
Tab. 4: Sprachgeschichte und Sprachwandel in Deutschlehrwerken der Sek. II
Tab. 5: Struktur, Themenbereiche und Fragestellungen der Fragebögen
Tab. 6: Diachroner Vergleich der Präpositionalrektionen
Tab. 7: Anteil der Genitiv- und Dativrektion nach sekundären Präpositionen
Tab. 8: Großschreibung von Konkreta und Abstrakta
Tab. 9: Historische Entwicklung der SIG
Tab. 10: Quellbereiche anthroponymischer Namenerweiterungen
AB Anforderungsbereich, Arbeitsblatt
ahd. althochdeutsch
arch. archaisch
BS AH Bildungsstandards für den Erwerb der Allgemeinen Hochschulreife
BS MS Bildungsstandards für den Mittleren Schulabschluss
CMC Computer Mediated Communication
fnhd. frühneuhochdeutsch
germ. germanisch
LP RLP Lehrplan Rheinland-Pfalz
LP THÜ Lehrplan Thüringen
LuL Lehrerinnen und Lehrer
mhd. mittelhochdeutsch
nhd. neuhochdeutsch
NP Nominalphrase
SIG satzinterne Großschreibung
SuS Schülerinnen und Schüler
I Einleitung und Fragestellung
Sprachgeschichte, das ist wie die Menschen vor hundert
Jahren gesprochen haben. Da haben sie irgendwie anders
gesprochen als heute nicht so deutsch (S–6–11).
Das Zitat stammt von einer Schülerin/einem Schüler, die/der1 für diese Arbeit nach ihren/seinen Vorstellungen von ‚Sprachgeschichte‘ befragt wurde. Ungeachtet der in fachwissenschaftlicher Hinsicht inkorrekten Vorstellung der Schülerin/des Schülers, wann die Sprachgeschichte des Deutschen ihren Anfang nahm und ‚was davor kam‘, lässt sich zunächst festhalten: In der Aussage wird durchaus ein Verständnis von historischer sprachlicher Alterität deutlich: Ihr oder ihm ist bewusst, dass Menschen früher „anders gesprochen [haben]“. Doch scheint die Vorstellung davon, wann dieser frühere Sprachzustand zeitlich verortet werden kann, zunächst nur hundert Jahre Sprachgeschichte zu umfassen. Zudem zeigt die Ergänzung der Schülerin/des Schülers, die Menschen haben früher „nicht so deutsch“ gesprochen, dass die/der Betreffende über kein kontinuierliches Sprachgeschichtsverständnis verfügt, durch das Vergangenes als „Entwicklungen hin zur Gegenwartssprache“ (Dieckmann/Voigt 1980: 9) begreifbar wird. In der Aussage der Schülerin/des Schülers wird das ‚Frühere‘ vielmehr als ein vom heutigen Sprachzustand abgekoppeltes ‚Anderes‘ verstanden. ← 19 | 20 →
Details
- Seiten
- 312
- Erscheinungsjahr
- 2017
- ISBN (Hardcover)
- 9783631723319
- ISBN (PDF)
- 9783631723821
- ISBN (ePUB)
- 9783631723838
- ISBN (MOBI)
- 9783631723845
- DOI
- 10.3726/b11173
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2017 (Mai)
- Schlagworte
- Diachronie Satzinterne Großschreibung Schulnamen Anrede Sprachreflexion Sprachbewusstheit
- Erschienen
- Frankfurt am Main, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 2017. 312 S., 35 s/w Abb., 1 farb. Abb., 10 s/w Tab.
- Produktsicherheit
- Peter Lang Group AG