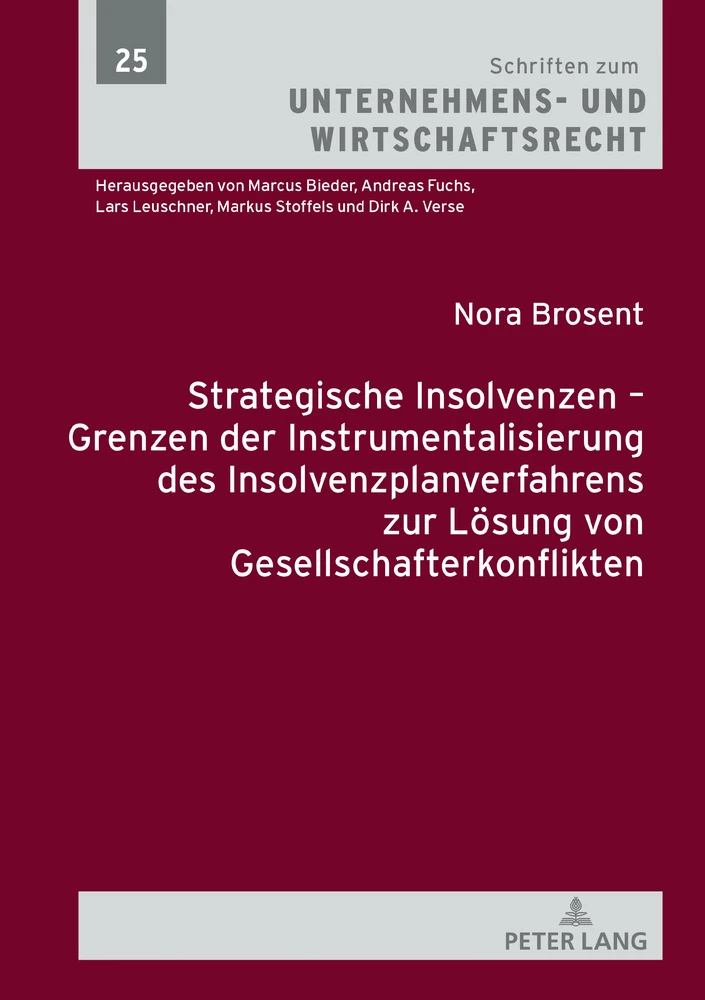Strategische Insolvenzen – Grenzen der Instrumentalisierung des Insolvenzplanverfahrens zur Lösung von Gesellschafterkonflikten
Zusammenfassung
Die Autorin greift diese im Schnittfeld von Insolvenz- und Gesellschaftsrecht angesiedelte Problematik auf und analysiert die Möglichkeiten und Grenzen, die für eine Instrumentalisierung des Insolvenzplanverfahrens zur Lösung innergesellschaftlicher Konflikte bestehen. Hierbei wird insbesondere beleuchtet, welche Rechtsschutzmöglichkeiten dem Gesellschafter zur Wahrung seiner Rechte offenstehen.
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titel
- Copyright
- Herausgeberangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Vorwort
- Gliederung
- Abkürzungsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Teil: Wege aus der Unternehmenskrise
- A. Grundsätzliches
- B. Überblick über Sanierungsmöglichkeiten vor Einführung des ESUG
- I. Außergerichtliche Sanierung
- 1) Die in Betracht kommenden Sanierungsinstrumente
- 2) Die gesellschaftsrechtliche Treuepflicht
- 3) „Girmes“ und „Sanieren oder Ausscheiden“
- II. Sanierung im Insolvenzverfahren
- 1) Einleitung
- 2) Die übertragende Sanierung
- 3) Insolvenzplan und Eigenverwaltung
- a) Das Obstruktionspotential der Gesellschafter als Hindernis für eine erfolgreiche Sanierung
- b) Kein Eingriff in Gesellschafterrechte nach altem Recht
- C. Neue Sanierungsmöglichkeiten nach dem ESUG
- I. Die Änderungen im Verfahren der Eigenverwaltung
- 1) Das Eröffnungsverfahren gemäß § 270a InsO
- 2) Das Schutzschirmverfahren gemäß § 270b InsO
- II. Möglichkeiten zur gesellschaftsrechtlichen Umstrukturierung im Insolvenzplan
- III. Vereinbarkeit der neuen Regelungen mit dem Grundgesetz
- 1) Erhobene Verfassungsbeschwerden
- 2) Vereinbarkeit mit Art. 14 I GG
- a) Schutzgehalt der Eigentumsfreiheit
- b) Eigentumsrelevante Maßnahme
- c) Rechtfertigung
- aa) Vergleich mit der Situation im Regelinsolvenzverfahren
- bb) Besonderheiten im Falle lediglich drohender Zahlungsunfähigkeit?
- cc) Der vollständige Entzug der Gesellschafterposition in der Rechtsprechung des BVerfG
- d) Ergebnis und Folge für die weitere Betrachtung
- 3) Vereinbarkeit mit Art. 9 I GG
- a) Schutzbereich und Verhältnis zu Art. 14 I GG
- b) Eingriff
- c) Rechtfertigung
- 4) Ergebnis
- IV. Zulässige gesellschaftsrechtliche Regelungen im Insolvenzplan
- 1) Grundsätzliches zu § 225a InsO
- a) Keine Massebezogenheit der gesellschaftsrechtlichen Regelung
- b) Zulässigkeit der gesellschaftsrechtlichen Regelung
- 2) Der Debt Equity Swap gemäß § 225a II InsO
- a) Die Kapitalherabsetzung
- b) Grundsätzliche Wertlosigkeit der Gesellschafteranteile?
- c) Die Kapitalerhöhung
- aa) Das Bezugsrecht der Altgesellschafter
- (1) Der Bezugsrechtsausschluss außerhalb der Insolvenz
- (2) Der Bezugsrechtsausschluss im Insolvenzplan
- (a) Erfordernis einer sachlichen Rechtfertigung
- (b) Keine Übertragung der Grundsätze aus Sanieren oder Ausscheiden
- (c) Kein zwingendes Bezugsrecht
- (d) Insolvenzspezifische Abwägung des Bezugsrechtsausschlusses
- bb) Forderungseinbringung der Gläubiger
- (1) Vollwertigkeit der einzubringenden Forderung
- (2) Bewertung nach Fortführungswerten
- (3) Vereinbarkeit der Forderungseinbringung mit Art. 9 I GG
- d) Die Vereinbarkeit des Debt Equity Swaps mit der Kapitalrichtlinie
- 3) Weitere zulässige gesellschaftsrechtliche Maßnahmen
- a) Fortsetzungsbeschluss
- b) Satzungsänderungen
- aa) Anteilsübertragungen
- bb) Sonstige Kapitalmaßnahmen
- cc) Änderungen in der Organstruktur
- dd) Änderung von Sonderrechten der Gesellschafter
- c) Gesellschafterausschluss
- d) Umwandlungen
- aa) Die Umwandlungsfähigkeit aufgelöster Rechtsträger
- bb) Verschmelzung
- cc) Spaltung
- (1) Aufspaltung
- (2) Abspaltung
- (3) Ausgliederung
- (4) Die Anwendbarkeit von § 133 UmwG
- dd) Formwechsel
- 4) Abfindung zum wahren Wert
- a) Abfindung bei Ausscheiden eines Gesellschafters
- b) Abfindung bei Beschränkung der Gesellschafteranteile
- c) Besonderheiten bei der börsennotierten AG
- d) Geltendmachung des Abfindungsanspruchs
- D. Ergebnis zum 1. Teil
- 2. Teil: Vom strategischen zum rechtsmissbräuchlichen Eigenantrag
- A. Einleitung
- B. Der strategische Eigenantrag
- I. Die Anreize des Schutzschirmverfahrens für strategische Anträge
- 1) Die Vormachtstellung der Geschäftsführung im Schutzschirmverfahren
- 2) Die Unterstützung durch die Gläubiger
- 3) Die (Un-)Abhängigkeit der Geschäftsführung vom Einfuss der Gesellschafter und der Überwachungsorgane
- a) Keine gesellschaftsrechtliche Veränderungssperre
- b) Keine analoge Anwendung des § 276a InsO auf das Schutzschirmverfahren
- 4) Die strategische Wahl des vorläufigen Sachwalters
- 5) Die eingeschränkte Überprüfbarkeit der Bescheinigung
- II. (Zwei) Prominente Beispiele aus der Praxis
- 1) Pfleiderer AG
- 2) Suhrkamp Verlagsgruppe GmbH & Co. KG
- C. Rechtsmissbräuchlichkeit eines strategischen Eigenantrags?
- I. Der Zweck des Insolvenzverfahrens als „Richtschnur“
- II. Die insolvenzzweckwidrige Nutzung des Insolvenzplanverfahrens
- 1) Eingrenzung auf den Gesellschafterkonflikt in der personalistischen GmbH
- 2) Widerspricht die Lösung eines Gesellschafterkonflikts dem Zweck des Insolvenzverfahrens?
- a) Der Subsidiaritätsgedanke im Gesellschaftsrecht
- aa) Auflösung der GmbH
- bb) Urteil des OLG München vom 4.2.2015
- b) Generelle Subsidiarität des Insolvenzverfahrens?
- 3) Zwischenergebnis und weiterer Gang der Untersuchung
- III. Anknüpfungspunkt für die Feststellung der Rechtsmissbräuchlichkeit
- D. Insolvenzverfahrensrechtliche Schutzmechanismen gegen missbräuchliche Eigenanträge
- I. Die Antragsbefugnis
- 1) Die Antragsberechtigung
- a) Die Antragsberechtigung beim Eigenantrag
- b) Die Antragsberechtigung bei Sanierungsanträgen
- c) Zwischenergebnis
- 2) Pflicht zur Einholung der Zustimmung der Gesellschafter
- a) Zustimmung der Gesellschafter zum Eigenantrag
- aa) Konsultationspflicht ausschließlich im Falle drohender Zahlungsunfähigkeit
- bb) Antragstellung als außergewöhnliches Geschäft i.S.v. § 49 II GmbHG
- cc) Auflösung der GmbH durch den Eröffnungsbeschluss
- dd) Urteil des OLG München vom 21.3.2013
- ee) Kein vorrangiges Gläubigerinteresse
- b) Auswirkungen auf die Antragsbefugnis
- aa) Missbrauch der Vertretungsmacht
- bb) Alternativ: Rücknahme des eigenmächtig gestellten Insolvenzantrags?
- (1) Antragsrücknahme nach Abberufung des Geschäftsführers
- (2) Antragsrücknahme aufgrund einer Gesellschafteranweisung
- cc) Zwischenergebnis
- c) Zustimmung der Gesellschafter zu Sanierungsanträgen
- aa) Keine Konsultationspflicht aufgrund der gesellschaftsrechtlichen Treuepflicht
- bb) Kein außergewöhnliches Geschäft
- cc) Kein Weisungsrecht der Gesellschafter
- dd) Wille des ESUG-Gesetzgebers
- 3) Ergebnis zum Bestehen der Antragsbefugnis
- II. Der Eröffnungsgrund
- 1) Grundsätzliches zur Feststellung des Insolvenzgrundes
- a) Überschuldung
- b) Drohende Zahlungsunfähigkeit
- c) Die Insolvenzgründe als Prognosetatbestände
- d) Die künstliche Schaffung eines Insolvenzgrundes durch den/die Gesellschafter?
- e) Stundung und qualifizierter Rangrücktritt zur Vermeidung der Insolvenz
- f) Treuwidrigkeit der Geltendmachung von Forderungen des Gesellschafters gegen die GmbH?
- aa) Treuepflicht bei Ausübung eigennütziger Rechte
- bb) Interessenabwägung anhand des wirtschaftlichen Interesses
- cc) Umfang der Treuepflicht
- g) Folgen für das Bestehen des Insolvenzgrundes
- h) Die gerichtliche Prüfung des Vorliegens eines Insolvenzgrundes
- aa) Zulassung des Insolvenzantrags
- bb) Eröffnungsbeschluss
- i) Ergebnis
- 2) Der vorläufige Sachwalter als Sachverständiger
- III. Keine Eigenverwaltung bei einem Konflikt innerhalb der Gesellschaft?
- 1) Beschluss des AG Mannheim vom 21.2.2014
- 2) Übertragung auf die Anordnung des Schutzschirmverfahrens?
- IV. Rechtsschutzbedürfnis
- 1) Grundsätze beim Gläubigerantrag
- 2) Grundsätze beim Schuldnerantrag
- V. Die Gewährung rechtlichen Gehörs im Eröffnungsverfahren
- 1) Beschluss des BverfG vom 9.2.1982
- 2) Übertragbarkeit auf das Insolvenzverfahren
- 3) Zeitpunkt der Gewährung rechtlichen Gehörs
- 4) Möglichkeit zur Einreichung einer Schutzschrift
- VI. Rechtsschutz gegen den Eröffnungsbeschluss?
- 1) Kein Rechtsschutz analog § 765a ZPO
- 2) Keine Anhörungsrüge gemäß § 321 a ZPO
- 3) Ausweitung des Rechtsschutzes gemäß § 34 InsO
- 4) Rechtsschutz gegen die Zulassung des Insolvenzantrags?
- E. Rechtsschutzmöglichkeiten des Gesellschafters im Rahmen des eröffneten Insolvenzplanverfahrens
- I. Die Aufstellung des Insolvenzplans
- 1) Der Einfluss der Gesellschafter auf die Erstellung und Vorlage des Insolvenzplans?
- 2) Der Schutz der Gesellschafter durch die Vorschriften über den Planinhalt
- a) Maßstäbe für die Gruppenbildung gemäß § 222 InsO
- b) Das Gleichbehandlungsgebot gemäß § 226 InsO
- c) Beachtlichkeit der gesellschaftsrechtlichen Treuepflicht i.R.d. § 225a III InsO?
- 3) Zurückweisung des Plans gemäß § 231 InsO
- a) Prüfungsumfang
- b) Keine Verhältnismäßigkeitsprüfung
- c) Begrenzung anhand des Insolvenzzwecks
- 4) Ergebnis zur Aufstellung des Insolvenzplans
- II. Annahme und Bestätigung des Insolvenzplans
- 1) Abstimmung über den Insolvenzplan
- a) Das Obstruktionsverbot
- aa) Keine Abhängigkeit von der Wertlosigkeit der Gesellschafteranteile
- bb) Keine Schlechterstellung durch den Insolvenzplan (§ 245 I Nr. 1 InsO)
- cc) Vorliegen einer Mehrheit (§ 245 I Nr. 3 InsO)
- dd) Angemessene wirtschaftliche Beteiligung (§ 245 I Nr. 2, III InsO)
- (1) Maßstab für die Gleichstellung
- (2) Maßstab für die Besserstellung
- b) Einfluss der gesellschaftsrechtlichen Treuepflicht auf die Abstimmung?
- aa) Urteil des LG Frankfurt a.M. v. 10.9.2013
- bb) Beschluss des OLG Frankfurt a.M. v. 1.10.2013
- cc) Bewertung durch das Schrifttum
- (1) Die Geltung der gesellschaftsrechtlichen Treuepflicht im eröffneten Insolvenzplanverfahren
- (2) Entscheidungszuständigkeit eines anderen Gerichts
- 2) Bestätigung des Insolvenzplans durch das Insolvenzgericht
- 3) Exkurs: Prüfungsbefugnis des Registergerichts?
- 4) Ergebnis zur Annahme und Bestätigung des Insolvenzplans
- F. Rechtsschutzmöglichkeiten des Gesellschafters gegen den Insolvenzplan
- I. Lediglich vermögensbezogener Schutz der Gesellschafter durch §§ 251, 253 InsO
- 1) Die Regelinsolvenz als Vergleichsmaßstab
- 2) Keine Prüfung einer etwaigen Insolvenzzweckwidrigkeit des Insolvenzplans i.R.v. §§ 251, 253 InsO
- 3) Keine Begrenzung bei nicht exakt bezifferbaren Nachteilen
- 4) Keine Ausnahme vom Vergleichsmaßstab der Regelinsolvenz
- 5) Ausreichender Schutz durch die vermögensbezogene Betrachtungsweise
- II. Minderheitenschutz gemäß § 251 InsO
- 1) Zulässigkeit des Antrags
- 2) Begründetheit des Antrags
- 3) Ausgleich gemäß § 251 III InsO
- III. Rechtsmittel gegen den Bestätigungsbeschluss gemäß § 253 InsO
- 1) Zulässigkeit
- a) Glaubhaftmachung einer wesentlichen Schlechterstellung
- b) Kein vorheriger Antrag gemäß § 251 InsO
- 2) Umfang der Begründetheitsprüfung
- 3) Das „Freigabeverfahren“ gemäß § 253 IV InsO
- a) Nachteilsabwägung
- b) Besonders schwerer Rechtsverstoß
- c) Keine Rechtsbeschwerde gegen den Freigabebeschluss
- Fazit
- Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse
- Literaturverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
a.A. andere Ansicht
ABl. Amtsblatt
Abs. Absatz
AcP Archiv für die civilistische Praxis
a.E. am Ende
a.F. alte Fassung
AG Aktiengesellschaft/ Die Aktiengesellschaft (Zeitschrift) / Amtsgericht
AktG Aktiengesetz
Alt. Alternative
a.M. am Main
Anm. Anmerkung
Art. Artikel
Aufl. Auflage
Az. Aktenzeichen
BAG Bundesarbeitsgericht
BB Betriebs-Berater
Bd. Band
Begr. Begründung
Beschl. Beschluss
BGB Bürgerliches Gesetzbuch
BGBl. Bundesgesetzblatt
BGH Bundesgerichtshof
BGHZ Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Zivilsachen (amtliche Entscheidungssammlung)
BT-Drucks. Bundestagsdrucksache
bspw. beispielsweise
BVerfG Bundesverfassungsgericht
BVerfGE Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts (amtliche Entscheidungssammlung)
BVerfGG Gesetz über das Bundesverfassungsgericht
BVerwG Bundesverwaltungsgericht
bzw. beziehungsweise
CFL Corporate Finance Law
DB Der Betrieb
←19 | 20→ders. derselbe
DES Debt Equity Swap
d.h. das heißt
dies. dieselbe/n
Diss. Dissertation
DStR Deutsches Steuerrecht
DNotZ Deutsche Notar-Zeitschrift
DZWIR Deutsche Zeitschrift für Wirtschafts- und Insolvenzrecht
EL Ergänzungslieferung
ESUG Gesetz zur weiteren Erleichterung der Sanierung von Unternehmen
etc. et cetera
EuGH Europäischer Gerichtshof
EWiR Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht
f. folgende
ff. fortfolgende
Fn. Fußnote
FS Festschrift
GbR Gesellschaft bürgerlichen Rechts
gem. gemäß
GG Grundgesetz
ggf. gegebenenfalls
GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GmbHG Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung
GmbH & Co. KG Gesellschaft mit beschränkter Haftung und Compagnie
GmbHR GmbH Rundschau
GWR Gesellschafts- und Wirtschaftsrecht
HGB Handelsgesetzbuch
Hrsg. Herausgeber
Hs. Halbsatz
i.d.F. in der Fassung
IDW Institut der Wirtschaftsprüfer
InsO Insolvenzordnung
i.R.d. im Rahmen des
i.R.v. im Rahmen von
i.S.d. im Sinne des/der
i.S.v. im Sinne von
i.V.m. in Verbindung mit
JZ JuristenZeitung
←20 | 21→KredReorgG Gesetz zur Reorganisation von Kreditinstituten
KSI Krisen-, Sanierungs- und Insolvenzberatung
KSzW Kölner Schrift zum Wirtschaftsrecht
KTS Zeitschrift für Insolvenzrecht
LG Landgericht
Mio. Million(en)
Mrd. Milliard(en)
n.F. neue Fassung
NJW Neue Juristische Wochenschrift
Nr. Nummer
NZG Neue Zeitschrift für Gesellschaftsrecht
NZI Neue Zeitschrift für das Recht der Insolvenz und Sanierung
OLG Oberlandesgericht
RegE Regierungsentwurf
Rn. Randnummer
Rspr. Rechtsprechung
S. Seite
sog. sogenannt
u.a. und andere/unter anderem
UG Unternehmergesellschaft
UmwG Umwandlungsgesetz
Urt. Urteil
USA United States of America
v. von/vom
Var. Variante
WiB Wirtschaftsrechtliche Beratung
WM Zeitschrift für Wirtschafts- und Bankrecht
WPg Die Wirtschaftsprüfung
z.B. zum Beispiel
ZGR Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht
ZHR Zeitschrift für das gesamte Handels- und Wirtschaftsrecht
ZInsO Zeitschrift für das gesamte Insolvenzrecht
ZIP Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
zugl. zugleich
ZRP Zeitschrift für Rechtspolitik
ZZP Zeitschrift für Zivilprozess
Einleitung
„Endlich pleite!“1 – die Insolvenz als Rettungsanker? Was lange Zeit abwegig war, erscheint seit dem Inkrafttreten des ESUG2 zumindest nicht mehr ausgeschlossen.
Mit der Reform hat der Gesetzgeber die Rufe im Schrifttum nach einer Neuordnung des Verhältnisses von Gesellschafts- und Insolvenzrecht3 erhört. Das einstige Obstruktionspotential der Gesellschafter im Insolvenzplanverfahren gehört endgültig der Vergangenheit an. War die Vereinbarung gesellschaftsrechtlicher Strukturmaßnahmen im Insolvenzplan vor der Reform stets von der Zustimmung der Gesellschafter abhängig, ist es nun nicht nur möglich, ihre Anteils- und Mitgliedschaftsrechte gemäß § 217 S. 2 InsO in den Insolvenzplan einzubeziehen; vielmehr erlaubt § 225a III InsO die Vereinbarung jeder Regelung, die gesellschaftsrechtlich zulässig ist. Vervollständigt wird der Eingriff in die Gesellschafterrechte durch die Unterwerfung unter das Obstruktionsverbot (§ 245 InsO), womit die Zustimmung der Gesellschafter zu etwaigen Maßnahmen im Insolvenzplan unter bestimmten Voraussetzungen sogar obsolet wird.
Was mancherorts – als längst überfällig – befürwortet wird,4 schürt anderenorts die Befürchtung, der missbräuchlichen Inanspruchnahme des Insolvenzplanverfahrens werde hierdurch Tür und Tor geöffnet5.
Insbesondere die Streitigkeiten der Gesellschafter des Suhrkamp Verlages Ulla Unseld-Berkéwicz und Hans Barlach6 fachten dabei die Diskussion an. Die ←23 | 24→beiden Hauptakteure befanden sich bereits seit Jahren in gesellschaftsrechtlichen Auseinandersetzungen,7 die im Mai 2013 schließlich in einem Antrag auf Eröffnung des Insolvenz- und Schutzschirmverfahrens kulminierten8. Der im Rahmen dieses Schutzschirmverfahrens ausgearbeitete Insolvenzplan sah unter anderem eine komplette gesellschaftsrechtliche Umstrukturierung vor: Die GmbH & Co. KG sollte in eine AG umgewandelt werden, womit gleichzeitig die zahlreichen Sonderrechte, die Barlach durch den Gesellschaftsvertrag eingeräumt waren, untergingen. Das Schrifttum sah in der Beantragung der Insolvenz den Versuch, den Gesellschafterkonflikt zulasten des Minderheitsgesellschafters zu lösen,9 und rief die „Geburtsstunde der strategischen Insolvenz“ aus.10
In der vorliegenden Arbeit wird der Frage nachgegangen, welche Möglichkeiten und Grenzen sich durch das reformierte Insolvenzplanverfahren zur Lösung innergesellschaftlicher Konflikte in der Kapitalgesellschaft bieten.11
Eine Konfliktlösung im Rahmen des Insolvenzplanverfahrens kann insbesondere deswegen reizvoll sein, da die Anforderungen, die verfahrensrechtlich an die Vereinbarung von Strukturmaßnahmen gestellt werden, insbesondere durch die insolvenzrechtlichen Vorschriften über die Abstimmung und die erforderlichen Mehrheiten deutlich reduziert sind.12 Strukturmaßnahmen, die außerhalb der Insolvenz nicht die erforderlichen Mehrheiten erreichen, können so in der Insolvenz vereinfacht durchgesetzt, (Minderheits-)Gesellschafter aus der Gesellschaft ausgeschlossen oder die corporate governance der Gesellschaft komplett geändert werden. Überspitzt kann hier das Insolvenzplanverfahren das Mittel zur „Zähmung des Widerspenstigen“13 sein.
←24 | 25→Ausgangspunkt einer solchen Nutzung des „gesellschaftsrechtlichen Universalwerkzeugs“14 Insolvenzplanverfahren zur Lösung von Streitigkeiten zwischen den Gesellschaftern ist das durch die Einführung des § 225a III InsO geschaffene Mittel, gesellschaftsrechtliche Umstrukturierungen im Insolvenzplan vorzunehmen. Dabei bietet die Kombination aus Insolvenzplan- und Eigenverwaltungsverfahren dem Schuldner optimale Möglichkeiten zur strategischen Nutzung des Insolvenzplanverfahrens. Denn einerseits eröffnet das Insolvenzplanverfahren die Möglichkeit, in die Gesellschafterstruktur einzugreifen. Andererseits belässt das Eigenverwaltungsverfahren der Geschäftsführung die Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis. Innergesellschaftliche Konflikte können so einer schnellen Lösung zugeführt werden – auch und gerade zulasten eines (Minderheits-)Gesellschafters. Ob eine solche Nutzung des Insolvenzplanverfahrens eine zulässige oder unzulässige Inanspruchnahme des insolvenzrechtlichen Rechtsrahmens darstellt, bildet dabei einen Schwerpunkt der Fragestellung. Dabei ist zunächst einmal von der Prämisse auszugehen, dass die strategische Inanspruchnahme des Insolvenzplanverfahrens ein zulässiges und sogar wünschenswertes Vorgehen darstellt.15 Dies kann allerdings nicht für die rechtsmissbräuchliche Verfahrensnutzung gelten. Die Abgrenzung ist anhand des in § 1 InsO niedergelegten Zwecks des Insolvenzverfahrens als Grenze der rechtmäßigen Inanspruchnahme des Insolvenzverfahrens vorzunehmen.16
Im Hinblick auf das Ziel, die rechtsmissbräuchliche Inanspruchnahme des Insolvenzplanverfahrens zu verhindern, sind die hierin vorgesehenen Rechtsschutzmöglichkeiten daraufhin zu beleuchten, ob sie einen ausreichenden Schutz des (Minderheits-)Gesellschafters vor einer rechtsmissbräuchlichen Inanspruchnahme gewähren. Sollte dies nicht der Fall sein, stellt sich aber auch die Frage, ob, über diesen vorgesehenen Rechtsschutz hinaus, die gesellschaftsrechtliche Treuepflicht das Insolvenzplanverfahren – und möglicherweise sogar die Planabstimmung beeinflussen kann. Diese Frage wurde erstmals im erwähnten Suhrkamp-Verfahren virulent und ist in Rechtsprechung und Literatur umstritten.17
←25 | 26→Die Arbeit gliedert sich in zwei Teile. Der erste Teil widmet sich den Grundlagen für die eigentliche Fragestellung. Hierbei wird zunächst ein Überblick über die infrage kommenden gesellschaftsrechtlichen Instrumente im Rahmen einer außergerichtlichen Sanierung gegeben (1. Teil B. I.). Sodann werden die Verfahren dargestellt, die das Insolvenzrecht für eine Sanierung bietet. Dabei ist es unerlässlich, einen Blick auf die Gründe zu werfen, die die neuen Vorschriften betreffend das Verhältnis von Gesellschafts- und Insolvenzrecht notwendig machten (1. Teil B. II. 3)). Angesprochen ist hier insbesondere das Obstruktionspotential der Gesellschafter. Darauf aufbauend werden die Möglichkeiten, die durch die Einbeziehung der Gesellschafter in den Insolvenzplan geschaffen wurden, und ihre Auswirkungen auf die Stellung der Gesellschafter dargestellt (1. Teil C.). Dabei wird auch der Frage nachgegangen, inwieweit die Zulässigkeit gesellschaftsrechtlicher Maßnahmen im Insolvenzplan (§ 225a III InsO) von außerhalb der Insolvenz geltenden gesellschaftsrechtlichen Prinzipien, wie dem Bezugsrecht im Rahmen eines Debt Equity Swaps oder der gesellschaftsrechtlichen Treuepflicht, beeinflusst wird. Schließlich ist auf die verfassungsrechtliche Beurteilung der neuen Vorschriften einzugehen.
Der zweite Teil bildet den Hauptteil der Arbeit. Hier wird der Frage nachgegangen, ob gesellschaftsrechtliche Konflikte im Rahmen des Insolvenzplanverfahrens einer Lösung zugeführt werden können. Die Betrachtung in diesem Teil soll sich dabei auf den Gesellschafterkonflikt in der personalistischen GmbH konzentrieren. Diese erscheint aufgrund ihrer Struktur besonders anfällig für Streitigkeiten unter den Gesellschaftern.
Dabei wird zunächst untersucht, inwieweit das Schutzschirmverfahren einen Anreiz für die Stellung strategischer Insolvenzanträge bietet (2. Teil B. I.). Daran anknüpfend wird die Frage beleuchtet, wann von einer rechtsmissbräuchlichen Inanspruchnahme des Insolvenzplanverfahrens auszugehen ist. Hierbei ist der in § 1 InsO festgelegte Zweck des Insolvenzverfahrens zu untersuchen, um festzustellen, ob die Nutzung des Insolvenzplanverfahrens zur Lösung gesellschaftsrechtlicher Konflikte diesem widerspricht (2. Teil C.). Daran anknüpfend soll gezeigt werden, inwieweit das Insolvenzplanverfahren gegen rechtsmissbräuchliche Insolvenzanträge des Schuldners Schutz bietet. Besondere Relevanz kommt dabei dem Rechtsschutz des (Minderheits)Gesellschafters, der durch die geplanten Maßnahmen in seinen Rechten beeinträchtigt wird, zu. (2. Teil D, E, F). Hinsichtlich des Rechtsschutzes gegen eine Instrumentalisierung des Insolvenzplanverfahrens zur Lösung innergesellschaftlicher Konflikte, wird zwischen dem Eröffnungsverfahren (2. Teil D) und dem eröffneten Verfahren (2. Teil E, F) differenziert. Hierbei spielt auch eine Rolle, inwieweit das Gesellschaftsrecht sowohl die Antragstellung als auch die Ausgestaltung des Insolvenzplans beeinflusst. ←26 | 27→Dabei ist insbesondere von Interesse, ob die gesellschaftsrechtliche Treuepflicht Einfluss sowohl auf den Umfang der im Insolvenzplan festgelegten gesellschaftsrechtlichen Maßnahmen als auch auf das Verfahrensrecht – und hier insbesondere auf die Abstimmung über den Insolvenzplan – haben kann.18
←27 | 28→1 So betitelte der Tagesspiegel den Antrag der Geschäftsleitung des Suhrkamp Verlages auf Insolvenzeröffnung, abrufbar unter: http://www.tagesspiegel.de/kultur/suhrkamp-insolvenz-endlich-pleite/8614330.html (zuletzt abgerufen am 24.2.2016).
2 Gesetz zur weiteren Erleichterung der Sanierung von Unternehmen v. 7.12.2011, BGBl. I 2011, S. 2582 ff.
3 Siehe nur Bork, ZIP 2010, 397 (408); Braun, FS Fischer, 53 (65); Brüning, Gesellschafter und Insolvenzplan, S. 119, 214; Büchele, Eingriff in Gesellschafterrechte, S. 94; Eidenmüller, ZIP 2010, 649 (652); Eidenmüller/Engert, ZIP 2009, 541 ff.; Gerster, ZInsO 2008, 437 (441); Jaffé/ Friedrich, ZIP 2008, 1849 (1853), bezeichnen die Trennung von Insolvenz- und Gesellschaftsrecht als „Geburtsfehler“; Pape, ZInsO 2010, 2155 (2158); Smid, DZWIR 2009, 397 (399); Stapper, ZInsO 2009, 2361 (2364).
4 MüKo InsO/Eidenmüller, § 225a Rn. 9; Haas, NZG 2012, 961 (967); Hölzle, ZIP 2012, 2427 (2428); H. Meyer/Degener, BB 2011, 846 (851).
5 Schäfer, ZIP 2015, 1208; Westermann, NZG 2015, 134.
6 * 31.8.1955 in Ratzeburg, † 15.7.2015 in Hamburg.
7 Siehe hierzu und auch zu dem Verlauf des Insolvenzverfahrens ausführlich Böcker, DZWIR 2014, 331 (332 f.) und ders., ZInsO 2015, 773 (774 f.); Überblick auch durch das BVerfG, Beschl. v. 18.12.2014 – 2 BvR 1978/13, ZIP 2015, 80 (80).
8 Siehe die hierzu veröffentlichte Pressemitteilung des Suhrkamp Verlages vom 27.5.2013 unter http://www.suhrkamp.de/news/schutzschirmverfahren_sichert_existenz_und_handlungsfaehigkeit_des_suhrkamp_verlags_2147.html (zuletzt abgerufen am 24.2.2016).
9 Brünkmans/Uebele, ZInsO 2014, 265 (265); Madaus, ZIP 2014, 500 (500).
10 So Hölzle, ZIP 2015, 83 (84); Möhlenkamp, BB 2013, 2828, fragt in diesem Sinne: „Flucht nach vorn in die Insolvenz – funktioniert Suhrkamp?“.
11 Hierbei soll sich die Betrachtung auf die Rechtsform der GmbHG und der AG beschränken.
12 Priester, FS Kübler, 557 (560).
13 Fölsing, ZInsO 2013, 1325 (1325).
14 Eidenmüller, NJW 2014, 17 (17).
15 Eidenmüller, ZIP 2014, 1197 (1197).
16 MüKo InsO/Ganter/Lohmann, § 1 Rn. 7.
17 Siehe zu dieser Frage u.a. OLG Frankfurt a.M., Beschl. v. 1.10.2013 – 5 U 145/13, DZWIR 2014, 370; LG Frankfurt a.M., Urt. v. 10.9.2013 – 3-09 O 96/13, Fölsing, ZInsO 2013, 2021; Insolvenzrechts-Handbuch/Haas, § 91 Rn. 29; Hölzle, EWiR 2013, 589; NZG 2013, 1315; Madaus, ZIP 2014, 500; Meyer, ZInsO 2013, 2361; Thole, ZIP 2013, 1937; Schäfer, ZIP 2013, 2237; Schluck-Amend, Gesellschaftsrecht in der Diskussion 2014, 151; Spliedt, ZInsO 2013, 2155; Stöber, ZInsO 2013, 2457; Zipperer, ZIP 2015, 2002.
18 Mögliche, sich an das Insolvenzverfahren anschließende, Rechtsfragen (wie etwaige Schadensersatzansprüche des (Minderheits)Gesellschafters) bleiben in der Arbeit ausgeklammert.
Details
- Seiten
- 358
- Erscheinungsjahr
- 2019
- ISBN (Hardcover)
- 9783631777138
- ISBN (PDF)
- 9783631779248
- ISBN (ePUB)
- 9783631779255
- ISBN (MOBI)
- 9783631779262
- DOI
- 10.3726/b15134
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2019 (Februar)
- Schlagworte
- Sanierung ESUG Eigenantrag Insolvenzzweck Rechtsmissbrauch Rechtsschutz
- Erschienen
- Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien. 2019. 358 S.
- Produktsicherheit
- Peter Lang Group AG