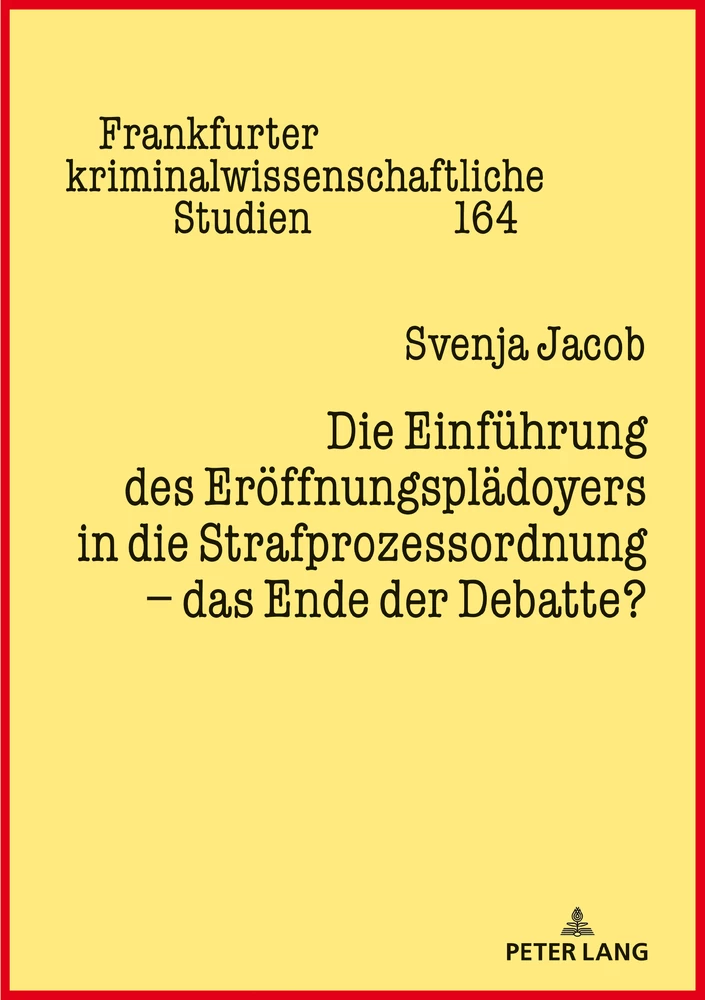Die Einführung des Eröffnungsplädoyers in die Strafprozessordnung – das Ende der Debatte?
Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Title Page
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Vorwort
- Inhaltsübersicht
- Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Einleitung
- Kapitel 1. Das Eröffnungsplädoyer des Verteidigers in der Hauptverhandlung – eine Einführung
- A. Der Ursprung des Eröffnungsplädoyers
- B. Das Eröffnungsplädoyer im strafprozessualen Diskurs – zur historischen Entwicklung des Rederechts
- I. Die Anfänge des Eröffnungsplädoyers in Deutschland
- II. Das Eröffnungsplädoyer in der Verfahrenswirklichkeit vor dessen Kodifizierung
- III. Das Eröffnungsplädoyer im Gesetzgebungsprozess
- C. Sinn und Zweck des Eröffnungsplädoyers – strafprozessuale Argumente im Widerstreit
- I. Die Vorzüge eines Eröffnungsplädoyers im Strafverfahren
- 1. Das Eröffnungsplädoyer als Gegengewicht
- 2. Die Offenlegung der Verteidigungsstrategie und ihre Folgen
- 3. Die Förderung von Kommunikation und Transparenz im Strafverfahren
- 4. Das Eröffnungsplädoyer als Instrument zur Entgegenwirkung von Vorverurteilungen
- 5. Das Eröffnungsplädoyer als Instrument zur Veranschaulichung von Problemen
- 6. Das Eröffnungsplädoyer im Falle der Modifikation des Anklagesatzes
- 7. Das Eröffnungsplädoyer im Falle verfahrenverkürzender Normen
- II. Die strafprozessualen Bedenken gegen ein Eröffnungsplädoyer
- 1. Die Gefahr der missbräuchlichen Ausübung
- 2. Die Vorbereitung des Gerichts und der Staatsanwaltschaft
- 3. Die Entwertung der Einlassung des Angeklagten
- 4. Die Verzögerung der strafrechtlichen Hauptverhandlung
- 5. Die Gefahr einer vorzeitigen strafprozessualen Wertung
- III. Zwischenergebnis
- D. Zur Rechtsnatur eines Eröffnungsplädoyers
- Kapitel 2. Die Einführung des Eröffnungsplädoyers in die Strafprozessordnung – eine abstrakte Betrachtungsweise im Kontext strafprozessualer und verfassungsrechtlicher Grundlagen
- A. Zur Erforderlichkeit eines Eröffnungsplädoyers
- I. Zur Entstehung eines Ungleichgewichts durch Verlesung des Anklagesatzes
- 1. Der Sinn und Zweck der Verlesung des Anklagesatzes
- 2. Das strafprozessuale Ungleichgewicht
- II. Das Ungleichgewicht im Lichte von Schöffen und Medien
- 1. Zur rechtlichen Qualifikation der Schöffen im Strafverfahren
- a. Das Recht der Schöffen auf Akteneinsicht
- aa. Die ältere Auffassung
- bb. Die Verschiebung des Meinungsstands
- cc. Die Schöffen als gleichwertige Mitglieder der Richterbank
- b. Zur Auswirkung des Ungleichgewichts auf Schöffen
- 2. Zur Bedeutung der Medienberichterstatter im Strafverfahren
- a. Die Medienberichterstatter als rechtliche Laien des Strafverfahrens
- b. Zu den Bedenken eines Ungleichgewichts aus Sicht der Öffentlichkeit
- 3. Zwischenergebnis
- III. Das Eröffnungsplädoyer als strafprozessual geeignetes Gegengewicht zur Anklageverlesung
- IV. Zwischenergebnis
- B. Das Eröffnungsplädoyer im Lichte der Grundlagen der Strafverteidigung – ein Instrument contra legem?
- I. Das Eröffnungsplädoyer und die Stellung des Verteidigers im Strafverfahren
- 1. Die verfahrensrechtliche Stellung des Verteidigers
- a. Der Verteidiger als Beistand und Organ der Rechtspflege – Organtheorie
- aa. Die Organtheorie im Spiegel der Rechtsprechung
- (1) Reichsgericht
- (2) Bundesgerichtshof
- (3) Bundesverfassungsgericht
- (4) Zwischenergebnis
- bb. Die Organtheorie im Spiegel des Schrifttums
- b. Die eingeschränkte Organtheorie
- c. Der Verteidiger als privater Interessensvertreter des Beschuldigten – Parteiinteressenvertretertheorie
- aa. Die strengen Parteiinteressenvertretertheorien
- bb. Die eingeschränkten Parteiinteressenvertretertheorien
- d. Die Vertragstheorie
- e. Thesen des Strafrechtsausschusses der Bundesrechtsanwaltskammer 2015
- 2. Zur Konformität vom Eröffnungsplädoyer und der verfahrensrechtlichen Stellung des Verteidigers
- 3. Zwischenergebnis
- II. Das Eröffnungsplädoyer und die Beteiligungsrechte des Strafverteidigers
- 1. Zu den Beteiligungsrechten und ihrer zugrundeliegenden Systematik
- a. Die Beteiligungsrechte des Strafverteidigers im Einzelnen
- aa. Die Erklärungsrechte des Strafverteidigers
- (1) Das Erklärungsrecht gemäß § 257 Abs. 2 StPO
- (a) Die gesetzliche Ausgestaltung des Rechts auf Erklärung
- (b) Zum Sinn und Zweck des Erklärungsrechts
- (2) Das sog. „allgemeine Erklärungsrecht“
- bb. Das Fragerecht gemäß § 240 Abs. 2 S. 1 StPO
- (1) Die gesetzliche Ausgestaltung des Rechts auf Befragung
- (2) Zum Sinn und Zweck des Fragerechts
- cc. Das Beanstandungsrecht gemäß § 238 Abs. 2 StPO
- (1) Die gesetzliche Ausgestaltung des Beanstandungsrechts
- (2) Zum Sinn und Zweck des Beanstandungsrechts
- dd. Das Beweisantragsrecht, § 244 Abs. 3–6 StPO
- (1) Die gesetzliche Ausgestaltung des Rechts auf Stellung eines Beweisantrags
- (2) Zum Sinn und Zweck des Beweisantragsrechts
- ee. Das Akteneinsichtsrecht gemäß § 147 Abs. 1 StPO
- (1) Die gesetzliche Ausgestaltung des Rechts auf Akteneinsicht
- (2) Zum Sinn und Zweck des Akteneinsichtsrechts
- ff. Das Schlussplädoyer gemäß § 258 Abs. 1 StPO
- (1) Die gesetzliche Ausgestaltung des Schlussplädoyers
- (2) Zum Sinn und Zweck des Schlussplädoyers
- b. Zur Systematik der Beteiligungsrechte
- aa. Die Förderung der Sachverhaltsaufklärung
- bb. Die Funktion als Gegengewicht im Strafverfahren
- cc. Die Einflussnahme auf das Strafverfahren
- dd. Die Förderung von Kommunikation und Transparenz im Strafverfahren
- ee. Die Festschreibung prozessrelevanter Aspekte
- ff. Zwischenergebnis
- 2. Das Eröffnungsplädoyer und die Systematik bereits bestehender Beteiligungsrechte – ein Vergleich
- a. Zur Verbesserung von Kommunikation und Transparenz im Strafverfahren
- b. Zur Funktion als Gegengewicht im Strafverfahren
- c. Zur Festschreibung prozessrelevanter Aspekte
- d. Zur Aufklärungsförderung
- e. Zur Einflussnahme auf das Strafverfahren und die Öffentlichkeit
- 3. Zwischenergebnis
- III. Zwischenergebnis
- C. Das Eröffnungsplädoyer im Kontext verfassungsrechtlicher Grundsätze des Strafprozessrechts
- I. Zur Herleitung des Eröffnungsplädoyers aus dem Verfassungsrecht
- 1. Der Grundsatz des rechtlichen Gehörs
- a. Der Regelungsumfang des Anspruchs auf rechtliches Gehör gemäß Art. 103 Abs. 1 GG
- aa. Anspruchsberechtigung
- bb. Inhaltliche Reichweite des Anspruchs auf rechtliches Gehör
- (1) Das Recht zur Äußerung
- (2) Das Recht auf Information
- (3) Die Pflicht zur Kenntnisnahme und zum Erwägen
- cc. Anwendungsbereich des Art. 103 Abs. 1 GG
- b. Zum strafprozessualen Zusammenspiel von Eröffnungsplädoyer und Anspruch auf rechtliches Gehör
- aa. Das Eröffnungsplädoyer und die inhaltliche Reichweite des Anspruchs auf rechtliches Gehör
- bb. Das Eröffnungsplädoyer und der Anwendungsbereich des Anspruchs auf rechtliches Gehör
- (1) Die Eröffnung der Beweisaufnahme durch das Gericht
- (2) Das Urteil des Gerichts, § 260 Abs. 1 StPO
- cc. Das Eröffnungsplädoyer und die Anspruchsberechtigung des Grundsatzes auf rechtliches Gehör
- dd. Der Anspruch auf rechtliches Gehör als „Gesamtlösung“?
- c. Zwischenergebnis
- 2. Das Prinzip der verfahrensrechtlichen Waffengleichheit
- a. Der Regelungsumfang der verfahrensrechtlichen Waffengleichheit
- aa. Inhaltliche Reichweite der Waffengleichheit
- bb. Träger der Waffengleichheit
- cc. Geltungsbereich des Prinzips der Waffengleichheit
- b. Zur Konformität von Eröffnungsplädoyer und Waffengleichheit
- aa. Das Eröffnungsplädoyer und der Träger der Waffengleichheit
- bb. Das Eröffnungsplädoyer und der Geltungsbereich der Waffengleichheit
- cc. Das Eröffnungsplädoyer und die inhaltliche Reichweite der Waffengleichheit
- dd. Das Eröffnungsplädoyer und die Waffengleichheit als unselbstständiges akzessorisches Verteidigungsrecht
- c. Zwischenergebnis
- II. Zur Vereinbarkeit des Eröffnungsplädoyers mit dem Beschleunigungsgebot
- 1. Das Eröffnungsplädoyer im Kontext des Gebots der Verfahrensbeschleunigung
- 2. Eine Abwägung widerstehender Interessen
- a. Das Interesse an einer Beschleunigung des Strafverfahrens
- b. Das Interesse an einem Eröffnungsplädoyer
- c. Zum Überwiegen des Interesses an einem Eröffnungsplädoyer
- III. Zwischenergebnis
- D. Ergebnis
- Kapitel 3. Die Einführung des Eröffnungsplädoyers in die Strafprozessordnung – die Sätze 3 und 4 des § 243 Abs. 5 StPO auf dem Prüfstand
- A. Die gesetzliche Umsetzung eines Eröffnungsplädoyers – zum Regelungsgehalt der Sätze 3 und 4 des § 243 Abs. 5 StPO
- I. Der Anwendungsbereich des Eröffnungsplädoyers
- II. Der Antrag des Verteidigers und die Entscheidung des Gerichts
- III. Der Inhalt des Eröffnungsplädoyers
- IV. Der Zeitpunkt des Eröffnungsplädoyers
- V. Die Replik der Staatsanwaltschaft
- B. Kritische Analyse der Regelungen zum Eröffnungsplädoyer
- I. Zur inhaltlichen Konzeption des Eröffnungsplädoyers gemäß § 243 Abs. 5 S. 3 und S. 4 StPO
- 1. Die Abgabe der Erklärung „für diesen [Angeklagten]“
- a. Kürzung des Rechts auf Einlassung
- b. Kollision mit dem prozessualen Mehrwert eines Eröffnungsplädoyers
- c. Unvereinbarkeit mit dem Grundsatz der Aussagefreiheit
- d. Ungeklärte Folgefragen
- aa. Das Eröffnungsplädoyer im Falle mangelnder inhaltlicher Übereinstimmung mit der Sacheinlassung
- bb. Das Eröffnungsplädoyer im Falle fehlender Sacheinlassung
- cc. Das Eröffnungsplädoyer bei fehlender Zurechnung
- e. Zwischenergebnis
- 2. Die inhaltliche Beschränkung des Eröffnungsplädoyers nach § 243 Abs. 5 S. 3 StPO
- 3. Die inhaltliche Beschränkung des Eröffnungsplädoyers nach § 243 Abs. 5 S. 4 StPO
- a. Praktische Vorzüge der inhaltlichen Beschränkung
- b. Strafprozessuale Bedenken der inhaltlichen Beschränkung
- aa. Die inhaltliche Beschränkung und das Bestimmtheitsgebot nach Art. 20 Abs. 3 GG
- (1) Die erhebliche Verfahrensverzögerung nach § 406 Abs. 1 S. 5 StPO
- (2) Die erhebliche Verfahrensverzögerung nach § 406e Abs. 2 S. 3 StPO
- (3) Zwischenergebnis
- bb. Die inhaltliche Beschränkung und die Grundsätze des Strafverfahrens
- (1) Die Grundprinzipien der Hauptverhandlung
- (a) Der Unmittelbarkeitsgrundsatz
- (b) Der Mündlichkeitsgrundsatz
- (c) Der Öffentlichkeitsgrundsatz
- (2) Zwischenergebnis
- cc. Die inhaltliche Beschränkung und die fehlende Sachnähe zwischen Erklärungen und Selbstleseverfahren
- c. Die Vorzüge und Bedenken des § 243 Abs. 5 S. 4 StPO im Widerstreit – eine Abwägung
- d. Zwischenergebnis
- 4. Zum Verhältnis zwischen Satz 3 und Satz 4 des § 243 Abs. 5 StPO
- II. Zum Anwendungsbereich des Eröffnungsplädoyers
- 1. Die Begrenzung auf einen bestimmten Prozesstyp
- 2. Die Begrenzung auf eine gewisse Verfahrensdauer
- a. Die Missbrauchsgefahr durch den Vorsitzenden
- b. Der irreversible Entzug des Eröffnungsplädoyers
- 3. Der begrenzte Anwendungsbereich des Eröffnungsplädoyers
- a. Unklarheiten im Falle der Unterschreitung der Begrenzung
- b. Widerspruch zum Stellenwert eines Eröffnungsplädoyers
- 4. Zwischenergebnis
- III. Zur Konzeption des Eröffnungsplädoyers als Antragsrecht
- IV. Zur zeitlichen Verortung des Eröffnungsplädoyers
- V. Zur Replik der Staatsanwaltschaft
- C. Ergebnis
- D. Exkurs: Das Eröffnungsplädoyer in der Strafprozessordnung – ein modifizierter Ansatz
- I. Lösung de lege lata?
- II. Lösung de lege ferenda?
- Kapitel 4. Endergebnis
- Literaturverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1. Das Eröffnungsplädoyer des Verteidigers in der Hauptverhandlung – eine Einführung
A. Der Ursprung des Eröffnungsplädoyers
B. Das Eröffnungsplädoyer im strafprozessualen Diskurs – zur historischen Entwicklung des Rederechts
I. Die Anfänge des Eröffnungsplädoyers in Deutschland
II. Das Eröffnungsplädoyer in der Verfahrenswirklichkeit vor dessen Kodifizierung
III. Das Eröffnungsplädoyer im Gesetzgebungsprozess
C. Sinn und Zweck des Eröffnungsplädoyers – strafprozessuale Argumente im Widerstreit
I. Die Vorzüge eines Eröffnungsplädoyers im Strafverfahren
1. Das Eröffnungsplädoyer als Gegengewicht
2. Die Offenlegung der Verteidigungsstrategie und ihre Folgen
3. Die Förderung von Kommunikation und Transparenz im Strafverfahren
4. Das Eröffnungsplädoyer als Instrument zur Entgegenwirkung von Vorverurteilungen
5. Das Eröffnungsplädoyer als Instrument zur Veranschaulichung von Problemen
6. Das Eröffnungsplädoyer im Falle der Modifikation des Anklagesatzes
7. Das Eröffnungsplädoyer im Falle verfahrenverkürzender Normen
II. Die strafprozessualen Bedenken gegen ein Eröffnungsplädoyer
1. Die Gefahr der missbräuchlichen Ausübung
←9 | 10→2. Die Vorbereitung des Gerichts und der Staatsanwaltschaft
3. Die Entwertung der Einlassung des Angeklagten
4. Die Verzögerung der strafrechtlichen Hauptverhandlung
5. Die Gefahr einer vorzeitigen strafprozessualen Wertung
D. Zur Rechtsnatur eines Eröffnungsplädoyers
A. Zur Erforderlichkeit eines Eröffnungsplädoyers
I. Zur Entstehung eines Ungleichgewichts durch Verlesung des Anklagesatzes
1. Der Sinn und Zweck der Verlesung des Anklagesatzes
2. Das strafprozessuale Ungleichgewicht
II. Das Ungleichgewicht im Lichte von Schöffen und Medien
1. Zur rechtlichen Qualifikation der Schöffen im Strafverfahren
a. Das Recht der Schöffen auf Akteneinsicht
bb. Die Verschiebung des Meinungsstands
cc. Die Schöffen als gleichwertige Mitglieder der Richterbank
b. Zur Auswirkung des Ungleichgewichts auf Schöffen
2. Zur Bedeutung der Medienberichterstatter im Strafverfahren
a. Die Medienberichterstatter als rechtliche Laien des Strafverfahrens
b. Zu den Bedenken eines Ungleichgewichts aus Sicht der Öffentlichkeit
III. Das Eröffnungsplädoyer als strafprozessual geeignetes Gegengewicht zur Anklageverlesung
←10 | 11→I. Das Eröffnungsplädoyer und die Stellung des Verteidigers im Strafverfahren
1. Die verfahrensrechtliche Stellung des Verteidigers
a. Der Verteidiger als Beistand und Organ der Rechtspflege – Organtheorie
aa. Die Organtheorie im Spiegel der Rechtsprechung
bb. Die Organtheorie im Spiegel des Schrifttums
b. Die eingeschränkte Organtheorie
aa. Die strengen Parteiinteressenvertretertheorien
bb. Die eingeschränkten Parteiinteressenvertretertheorien
e. Thesen des Strafrechtsausschusses der Bundesrechtsanwaltskammer 2015
2. Zur Konformität vom Eröffnungsplädoyer und der verfahrensrechtlichen Stellung des Verteidigers
II. Das Eröffnungsplädoyer und die Beteiligungsrechte des Strafverteidigers
1. Zu den Beteiligungsrechten und ihrer zugrundeliegenden Systematik
a. Die Beteiligungsrechte des Strafverteidigers im Einzelnen
aa. Die Erklärungsrechte des Strafverteidigers
(1) Das Erklärungsrecht gemäß § 257 Abs. 2 StPO
(a) Die gesetzliche Ausgestaltung des Rechts auf Erklärung
←11 | 12→(b) Zum Sinn und Zweck des Erklärungsrechts
(2) Das sog. „allgemeine Erklärungsrecht“
bb. Das Fragerecht gemäß § 240 Abs. 2 S. 1 StPO
(1) Die gesetzliche Ausgestaltung des Rechts auf Befragung
(2) Zum Sinn und Zweck des Fragerechts
cc. Das Beanstandungsrecht gemäß § 238 Abs. 2 StPO
(1) Die gesetzliche Ausgestaltung des Beanstandungsrechts
(2) Zum Sinn und Zweck des Beanstandungsrechts
dd. Das Beweisantragsrecht, § 244 Abs. 3–6 StPO
(1) Die gesetzliche Ausgestaltung des Rechts auf Stellung eines Beweisantrags
(2) Zum Sinn und Zweck des Beweisantragsrechts
ee. Das Akteneinsichtsrecht gemäß § 147 Abs. 1 StPO
(1) Die gesetzliche Ausgestaltung des Rechts auf Akteneinsicht
(2) Zum Sinn und Zweck des Akteneinsichtsrechts
ff. Das Schlussplädoyer gemäß § 258 Abs. 1 StPO
(1) Die gesetzliche Ausgestaltung des Schlussplädoyers
(2) Zum Sinn und Zweck des Schlussplädoyers
b. Zur Systematik der Beteiligungsrechte
aa. Die Förderung der Sachverhaltsaufklärung
bb. Die Funktion als Gegengewicht im Strafverfahren
cc. Die Einflussnahme auf das Strafverfahren
dd. Die Förderung von Kommunikation und Transparenz im Strafverfahren
ee. Die Festschreibung prozessrelevanter Aspekte
2. Das Eröffnungsplädoyer und die Systematik bereits bestehender Beteiligungsrechte – ein Vergleich
←12 | 13→a. Zur Verbesserung von Kommunikation und Transparenz im Strafverfahren
b. Zur Funktion als Gegengewicht im Strafverfahren
c. Zur Festschreibung prozessrelevanter Aspekte
e. Zur Einflussnahme auf das Strafverfahren und die Öffentlichkeit
C. Das Eröffnungsplädoyer im Kontext verfassungsrechtlicher Grundsätze des Strafprozessrechts
I. Zur Herleitung des Eröffnungsplädoyers aus dem Verfassungsrecht
1. Der Grundsatz des rechtlichen Gehörs
a. Der Regelungsumfang des Anspruchs auf rechtliches Gehör gemäß Art. 103 Abs. 1 GG
bb. Inhaltliche Reichweite des Anspruchs auf rechtliches Gehör
(3) Die Pflicht zur Kenntnisnahme und zum Erwägen
cc. Anwendungsbereich des Art. 103 Abs. 1 GG
b. Zum strafprozessualen Zusammenspiel von Eröffnungsplädoyer und Anspruch auf rechtliches Gehör
aa. Das Eröffnungsplädoyer und die inhaltliche Reichweite des Anspruchs auf rechtliches Gehör
bb. Das Eröffnungsplädoyer und der Anwendungsbereich des Anspruchs auf rechtliches Gehör
(1) Die Eröffnung der Beweisaufnahme durch das Gericht
(2) Das Urteil des Gerichts, § 260 Abs. 1 StPO
←13 | 14→cc. Das Eröffnungsplädoyer und die Anspruchsberechtigung des Grundsatzes auf rechtliches Gehör
dd. Der Anspruch auf rechtliches Gehör als „Gesamtlösung“?
2. Das Prinzip der verfahrensrechtlichen Waffengleichheit
a. Der Regelungsumfang der verfahrensrechtlichen Waffengleichheit
aa. Inhaltliche Reichweite der Waffengleichheit
bb. Träger der Waffengleichheit
cc. Geltungsbereich des Prinzips der Waffengleichheit
b. Zur Konformität von Eröffnungsplädoyer und Waffengleichheit
aa. Das Eröffnungsplädoyer und der Träger der Waffengleichheit
Details
- Seiten
- 280
- Erscheinungsjahr
- 2020
- ISBN (Hardcover)
- 9783631800294
- ISBN (PDF)
- 9783631811313
- ISBN (ePUB)
- 9783631811320
- ISBN (MOBI)
- 9783631811337
- DOI
- 10.3726/b16519
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2019 (Dezember)
- Schlagworte
- Ursprung Historische Entwicklung Strafprozessuale Bedeutung Rechtsnatur Erforderlichkeit Grundlagen Strafverteidigung Verfassungsrecht Regelungsgehalt Kritische Analyse Lösungsansatz
- Erschienen
- Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 2020. 280 S.
- Produktsicherheit
- Peter Lang Group AG