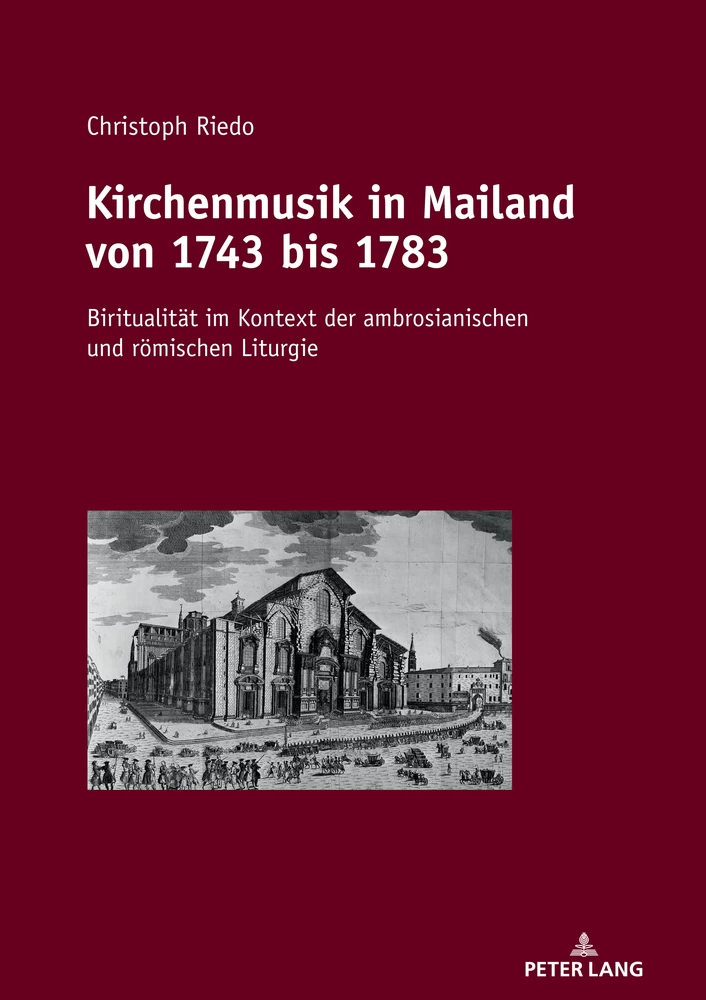Kirchenmusik in Mailand von 1743 bis 1783
Biritualität im Kontext der ambrosianischen und römischen Liturgie
Summary
Excerpt
Table Of Contents
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Inhaltsverzeichnis
- Gedruckte liturgische Bücher, bibliographische Abkürzungen und Bibliothekssigel
- Gedruckte liturgische Bücher
- Bibliographische Abkürzungen
- Bibliotheken und Archive
- Vorwort
- Bemerkung zur Gehalts- und Preisentwicklung in Mailand im 18. Jahrhundert
- Einleitung
- I.
- 1 Grundlagen
- 1.1 Das Erzbistum Mailand
- 1.2 Carlo Borromeo und die katholische Aufklärung
- 1.3 Kirchenmusik als varietà degli stili
- 2 Eine Stadt kartografieren
- 2.1 Milano sacro: Ankündigungen eines Almanachs
- 2.2 Der aufgeklärte Reformkatholizismus und seine Folgen
- 2.3 Ein Rundgang durch Mailands bedeutendste Kirchen
- 2.4 Kapellmeister und feste Ensembles
- 2.5 Ein Kirchenmusikkalender von 1775: La Galleria delle Stelle
- 3 Ambrosianischer und römischer Ritus im Vergleich
- 3.1 Das Interesse der Fremden an der ambrosianischen Liturgie
- 3.2 Zwei verschiedene liturgische Kalender
- 3.3 Besonderheiten der ambrosianischen Liturgie
- 3.4 Die Liturgie und ihre figuralmusikalische Realisierung
- 3.4.1 Die Messe
- 3.4.2 Verschiedene liturgische Texte
- 3.4.3 Unterschiede im liturgischen Text
- 3.4.4 Beispiel einer liturgischen Adaptation
- 3.4.5 Differenzen in der Choralmelodie
- 3.4.6 Hybride Vertonungen
- 4 Die Biritualität in der Mailänder Lebenswelt
- 4.1 Ein Ritenkonflikt und seine Regelung
- 4.2 Die Auswirkungen der Biritualität
- 4.3 Die liturgischen Verhältnisse in einzelnen Kirchen
- 4.4 Religiöse Kongregationen und ihre rituellen Gegebenheiten
- II.
- 1 Der Mailänder Dom
- 1.1 Der Domkapellmeister Giovanni Andrea Fioroni: Musikstil und Musikrepertoire
- 1.2 Giuseppe Sarti: ein Opernkomponist wird Domkapellmeister
- 1.3 Die soziale Stellung der Domkapelle
- 1.4 Das liturgische Zeremoniell
- 1.5 Fioronis Geschenk an Burney und seine Aussagekraft
- 2 Der Regio Ducal Tempio di Santa Maria presso San Celso
- 2.1 Der Dienstplan der königlich-herzoglichen Kirchenkapelle
- 2.2 Die Musikbibliothek
- 2.3 Der Mailänder Dom als Musikalienlieferant
- 2.4 Vertonungen all’Ambrosiana und alla Romana
- 2.5 Die korrekte musikalische Umsetzung der Liturgie
- 2.6 Ein Zeitsprung: liturgische Adaptationen um 1900
- 2.7 Die Charakteristika des ambrosianischen Kyrie
- 2.8 (Keine) Messeadaptationen aus dem 18. Jahrhundert?
- 2.9 Keine Regel ohne Ausnahme I: Vertonungen der ambrosianischen Liturgie mit Instrumentalbeteiligung
- 3 Das Augustinerinnenkloster Santa Maria Maddalena
- 4 Die Herzogskirche San Gottardo
- 4.1 Prestige und Zusammensetzung der Kirchenkapelle
- 4.2 Wenn die Kirchenmusik zusammen mit dem Ritus wechselt
- 4.3 Giovenale Sacchi: über den Einfluss eines Barnabitermönchs auf die Kirchenmusik
- 5 Die Jesuitenkirche San Fedele und die Congregazione del Santissimo Entierro
- 5.1 Bachs erster Auftritt als Kirchenkomponist
- 5.2 Gedenkmessen in San Fedele nach der Auflösung des Jesuitenordens 1773
- 5.3 Die Reale Imperiale Congregazione del Santissimo Entierro
- 5.4 Mailänder Totenmusiken
- 5.5 Die Verbreitung der Mailänder Musikalien
- 5.6 Die zeitliche Dauer als Charakteristikum
- 6 Die Franziskanerkirche San Francesco und die Johann-Nepomuk-Bruderschaft
- 6.1 Bachs Auftrag für die Kongregation zu Ehren des heiligen Johannes Nepomuk
- 6.2 Klienteläre Verflechtung bei der Vergabe von Kompositionsaufträgen und Kapellmeisterstellen
- 6.3 Der Versuch einer Rekonstruktion der Kirchenmusik Bachs
- III.
- 1 Johann Christian Bach und das Pater noster
- 1.1 Bachs Schüler-Lehrer-Verhältnis zu Padre Martini
- 1.2 Musikstilistische Tücken eines Pater noster
- 1.3 ›Gute‹ und ›schlechte‹ Mailänder Vertonungen
- 1.4 Bachs Anstellung als Organist am Mailänder Dom
- 1.5 Padre Martinis Wissen über die ambrosianische Liturgie und die Mailänder Verhältnisse
- 1.6 Wie sich Bach allmählich mit den Mailänder Gepflogenheiten vertraut machte
- 2 Giovanni Battista Sammartini und seine liturgischen Kompositionen
- 2.1 Sammartinis dominierende Stellung
- 2.2 Sängervirtuosität und die Rolle des Orchesters
- 2.3 Keine Regel ohne Ausnahme II: ambrosianische Vertonungen mit Instrumentalbeteiligung und a cappella-Kompositionen der römischen Liturgie
- 3 San Giuseppe und die Gloria-Vertonungen der römischen Liturgie
- 3.1 Pompöse Mailänder Orchestermessen
- 3.2 Die Einleitungssinfonien
- IV.
- 1 Mailänder Kirchenmusik im Benediktinerstift Einsiedeln
- 1.1 Zeugnisse lang andauernder Kirchenmusik
- 1.2 Strategien zur Aneignung einer kontextfremden Kirchenmusik
- 1.3 Theaterstil in der Kirche
- 2 Vimercate: eine Pfarrei vor den Stadttoren Mailands
- 2.1 Die Musikkapelle in Vimercate
- 2.2 Das Musikarchiv
- V.
- 1 Fazit
- Druckwerke vor 1800
- Bibliographie
- Auswahldiskographie
- Anhang:
- Milano sacro: Die Kirchen Mailands und ihre Kapellmeister
Gedruckte liturgische Bücher, bibliographische Abkürzungen und Bibliothekssigel
Gedruckte liturgische Bücher
Psalterium 1618
Psalterium Cantica, et hymni, Aliaque Divinis Officijs Ritu Ambrosiano Psallendis Communia Modulationibus opportunis notata. Federici Cardinalis Archiep. iussu edita. Mediolani: Apud haer. Pacifici Pontij, & Ioannem Baptistam Piccaleum Impressores Archiepiscopales. MDCXVIII
Cærimoniale Ambrosianum 1619
Cærimoniale Ambrosianum Iussu Illustrissimi, ac Reverendissimi D.D.
Federici Card. Borromæi Mediolanensis Ecclesiæ Archiepiscopi Nuper editum.
Mediolani, Apud Io. Iacobum Comum 1619. Cum Privilegio
Missale romanum 1621
Missale romanum: ex decreto sacrosancti concilii Tridentini restitutum, Pii
V. Pont. Max. iussu editum, et Clementis VIII. auctoritate recognitum. Antwerpiæ, ex officina plantiniana, apud Balthasarem Moretum, & Viduam Ioannis Moreti, & Io. Meursium. MDCXXI
Missale Ambrosianum 1712
Missale Ambrosianum novissime Ioseph Cardinalis Archinti Archiepiscopi
Auctoritate recognitum, Mediolani, MDCCXII. Apud Beniamin, & Fratres de
Sirturis, Impressores Archiepiscopales. Cum privilegio
Missale romanum 1753
Missale romanum ex decreto sacrosancti concilii Tridentini restitutum, S. Pii
V. Pontificis Max. jussu editum Clementis VIII. & Urbani VIII. auctoritate recognitum, Venetiis, apud Nicolaum Pezzana. MDCCLIII
Breviarium Ambrosianum 1760
Breviarium Ambrosianum Sancti Caroli Cardinalis Archiepisc. Jussu Editum,
Et novissime Joseph Card. Puteobonelli Archiepiscopi Auctoritate recognitum.
Mediolani, MDCCLX. Apud Jo: Baptistam de Sirturis, Impressorem Archiep.
Cum Privilegio
←11 | 12→Missale Ambrosianum 1768
Missale Ambrosianum novissime Joseph Cardinalis Puteobonelli Archiepiscopi
Auctoritate Recognitum. Mediolani, MDCCLXVIII. Typis Joannis Baptistæ de
Sirturis Impress. Archiepisc. Cum Privilegio
Officium defunctorum 1770
Officium defunctorum ritu ambrosiano cum privilegio. Mediolani MDCCLXX.
Apud Jo: Baptistam de Sirturis, Impress. Archiepisc
Litaniæ Majores 1846
Litaniæ Majores Et Triduanæ Solemnes Ritu Ambrosiano S. Carolo Card. Tituli S. Praxedis Archiepiscopo Editæ A Carolo Cajetano Cardinali Gaisruchio Archiepiscopo Ad Recentiorem Usum Accomodatæ, Mediolani Apud Jacobum Agnelli Typogr. Archiepisc. MDCCCXLVI
AEM
Acta Ecclesiæ Mediolanensis, Achille Ratti (Hrsg.), Bde. 2–4 [Bd. 1 nicht erschienen], Mailand 1890–1897
DBI
Dizionario Biografico degli Italiani, Rom 1960–
Jenkins/Churgin
Jenkins, Newell & Churgin, Bathia: Thematic Catalogue of the Works of Giovanni Battista Sammartini: Orchestral and Vocal Music, Cambridge/ Massachusetts 1976
MGG1
Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik, Friedrich Blume (Hrsg.), 17 Bde., Kassel u.a. 1949–1986
MGG2
Die Musik in Geschichte und Gegenwart: Allgemeine Enzyklopädie der Musik, begründet von Friedrich Blume, Ludwig Finscher (Hrsg.), 29 Bde., Kassel u.a. 1994–2008
Milano sacro
Milano sacro, Giovanni Montano (Hrsg.), Mailand 1761–1907
NGrove2
New Grove, 2. Auflage, Stanley Sadie (Hrsg.), 29 Bd., London 2001
RISM A/2
Manuscrits musicaux après 1600, München: K.G. Saur (Répertoire International des Sources Musicales. Serie A/2), auch https://opac.rism.info; www.rism-ch.ch
Schnoebelen
Schnoebelen, Anne: Padre Martini’s Collection of Letters in the Civico Museo Bibliografico Musicale in Bologna: an annoted index, New York 1979
SdM
Storia di Milano, 18 Bde., Mailand 1953–1962
Vos
Vos, Marie Ann Heiberg: The Liturgical Choral Works of Johann Christian Bach, Dissertation, Washington University, 2 Bde., St. Louis 1969
←13 | 14→Warburton
The collected works of Johann Christian Bach, Ernest Warburton (Hrsg.), 48 Bde., New York 1984–1999
Die vorliegende Dissertation ist im Rahmen des vom Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung getragenen Forschungsprojektes »Musik aus Schweizer Klöstern« entstanden, das am musikwissenschaftlichen Institut der Universität Freiburg i. Ü. unter der Leitung von Luca Zoppelli durchgeführt wurde. Ihm, dem ich die Teilnahme am Forschungsprojekt verdanke, sowie den Projektteilnehmern Giuliano Castellani, Claudio Bacciagaluppi, Luigi Collarile und den ehemaligen Kollegen des musikwissenschaftlichen Instituts gilt mein ganz besonderer Dank. Am Forschungsprojekt beteiligten sich ausserdem die Schweizerische Musikforschende Gesellschaft mit der damaligen Präsidentin Therese Bruggisser-Lanker, die Schweizerische Arbeitsstelle des RISM mit Laurent Pugin, Cédric Güggi und Gabriella Hanke Knaus sowie die Schweizerische Nationalphonothek unter der Leitung von Pio Pellizzari. In der gleichnamigen Editionsreihe, herausgegebenen von der Schweizerischen Musikforschenden Gesellschaft, sind in Form von kritischen Editionen bisher fünf Bände mit ausgewählten Werken aus dem reichen Bestand der eidgenössischen Klöster erschienen und weitere Bände sind in Vorbereitung. Im Zuge des Forschungsprojektes entstandene Transkriptionen dienten als Aufführungsmaterial, z.B. dem von Diego Fasolis geleiteten Coro della Radio Svizzera und dem Orchester I Barocchisti sowie dem Barockorchester Capriccio Basel (Leitung Dominik Kiefer) und der Cappella Murensis (Leitung Johannes Strobl). Aus den zahlreichen Konzerten sind eine CD-Einspielung, mehrere Live-Radioübertragungen und verschiedene Aufzeichnungen im Radiostudio Lugano entstanden.
Als die Schweizerische Arbeitsstelle des RISM in den späten 2000erJahren die digitale Erfassung der Musikbibliothek Einsiedeln und weiterer Klosterbestände vornahm, zeigte sich erstmals die weite Verbreitung der mailändischen Musik in der Alten Eidgenossenschaft. Doch mit der Bestandsaufnahme begannen zugleich die Fragen: Wie gelangten die Mailänder Musikalien in die Alte Eidgenossenschaft, für welche Kirchen wurden die Kompositionen in Mailand erstellt und wie verhielt es sich mit dem liturgischen Hintergrund der Vertonungen, wenn das Bistum Mailand den ambrosianischen und die eidgenössischen Klöster den römischen Ritus praktizierten? Derartige Fragestellungen standen am Beginn meiner Forschungen, wobei mir Robert L. Kendrick (University of Chicago) und Christine Getz (University of Iowa) sowohl mit ihren Publikationen zur Musik in Mailand vor 1650 als auch mit ihren Empfehlungen und Hinweisen eine sehr grosse Hilfe waren. Ein besonderer Dank gebührt ←17 | 18→ebenso Bathia Churgin (Bar Ilan University), die dank der organisatorischen Leitung von Alessandra Rossi (Stiftung Fondazione Arcadia) und der Mitarbeit von Ada Beate Gehann, Mariateresa Dellaborra, Marina Toffetti und Marina Vaccarini Gallarani weitere Forschungen um den Mailänder Komponisten Giovanni Battista Sammartini in Gang setzte.
Bei Fragen zur ambrosianischen Liturgie durfte ich auf die generöse Hilfe von Giordano Monzio Compagnoni (Pontificio Istituto Ambrosiano di Musica Sacra), des Domzeremonienmeisters Monsignor Claudio Antonio Fontana und Monsignor Bruno Maria Bosatras zählen. Zahlreiche Sachverständige standen mir bei den Archivrecherchen in Mailand zur Seite. Unterstützung erfuhr ich vor allem von Fabrizio Pagani (Archivio Storico Diocesano di Milano), Davide Dozio (Archivio di Stato di Milano), Andrea Bernasconi, Roberto Fighetti (Archivio della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano) sowie Fausto Ruggeri, Stefano Malaspina und Laila Gagliano (Biblioteca Capitolare di Milano). Franco Buzzi (Biblioteca Ambrosiana), Marco Petoletti (Archivio della Basilica di Sant’Ambrogio) und Massimo Gentili Tedeschi (Ufficio Ricerca Fondi Musicali) gewährten mir freundlicherweise Zugang zu ihren Beständen und gaben mir ausführlich Auskunft. Wertvolle Hinweise verdanke ich zudem den Historikern Danilo Zardin (Università Cattolica del Sacro Cuore), Peter Hersche (Universität Bern) und Giorgio Dell’Oro sowie der mittlerweile verstorbenen Kirchenhistorikerin Paola Vismara (Università degli Studi di Milano).
Da sich ein Grossteil der Mailänder Musikquellen nicht mehr in Mailand selbst befindet, sondern in verschiedenen Bibliotheken verstreut vorliegt, war ich auf die Kooperation weiterer Bibliotheksleiter und Archivare angewiesen. Ein ganz besonderer Dank gilt dem Kapellmeister und Leiter der Musikbibliothek des Klosters Einsiedeln, Pater Lukas Helg OSB, sowie Andreas Meyerhans (ehemals Staatsarchiv Schwyz), Vera Paulus (Benediktinerkloster Engelberg), Hans-Rudolf Binz (Zentralbibliothek Solothurn), Tomás Slavický (Musikarchiv der Prager Kreuzherren), Marcello Eynard (Biblioteca Civica Angelo Mai, Bergamo) und Aurelio Aghemo (Biblioteca Estense Universitaria, Modena). Suzanne Eggleston Lovejoy und Richard Boursy (Yale University Library) gewährten mir grosszügig Einblick in den Nachlass des Sammartini-Forschers Newell Jenkins. Unterstützung erhielt ich ebenso vom musikwissenschaftlichen Institut der Università degli Studi di Milano, insbesondere von Davide Daolmi, Cesare Fertonani und dem externen Gutachter der Dissertation, Claudio Toscani, sowie von Raffaele Mellace (Università degli Studi di Genova).
Erst während meines Postdocs zur Instrumentalmusik des 17. Jahrhunderts an der Harvard University fand ich den nötigen Abstand und die Kraft für die Überarbeitung der bereits 2012 verteidigten Dissertation, die nun in einer stark gekürzten Fassung vorliegt. Kate van Orden und Christoph Wolff möchte ich für die bereichernde Zeit in Cambridge/Massachusetts danken. Ada Beate Gehann ←18 | 19→und Andrea Bernasconi haben sich liebenswürdigerweise die Zeit genommen, das Manuskript sorgfältig gegenzulesen; für allfällige Fehler übernehme ich alleine die Verantwortung. Cristina Urchueguía, Zentralpräsidentin der Schweizerischen Musikforschenden Gesellschaft und Herausgeberin der Publikationen der Schweizerischen Musikforschenden Gesellschaft, danke ich für die unermüdliche Geduld. Doch mein grösster Dank gilt Christoph Rudolf, dem zu früh verstorbenen Jonas Gräni, Astrid Knöchlein, meiner Lebenspartnerin Nicole Aellen sowie meiner Familie, ohne deren moralische Unterstützung die Arbeit nicht in Buchform erschienen wäre. In grosser Dankbarkeit widme ich dieses Buch meinen Eltern.
Bern, November 2020
Bemerkung zur Gehalts- und Preisentwicklung in Mailand im 18. Jahrhundert
Die Mailänder Löhne waren im 18. Jahrhundert kaum Schwankungen unterworfen. Ein Maurermeister beispielsweise verdiente 1701 einen durchschnittlichen Tageslohn von 1,73 Lire. Dieser Betrag fiel 1708 auf 1,62 Lire und verharrte im Grossen und Ganzen 70 Jahre auf diesem Stand. Erst 1778 sank der Handwerkerlohn von 1,67 Lire auf 1,59 Lire und verblieb auf diesem Niveau bis um 1800, als er auf 2 Lire anstieg. Das Gehalt eines Gesellen (garzone muratore) betrug zur gleichen Zeit zwischen 0,95 und 0,8 Lire, entsprach demzufolge in etwa der Hälfte des Maurermeisterlohnes und war den gleichen Schwankungen ausgesetzt.1
Den Musikern bezahlten die kirchlichen Institutionen praktisch über das ganze Jahrhundert hinweg das gleiche Gehalt: Der Domkapellmeister Giovanni Andrea Fioroni verdiente in den 1740er- bis 1770er-Jahren ein Jahresgehalt von 1800 Lire, der erste Organist erhielt 900 Lire und der zweite 700 Lire. Das Jahresgehalt eines Domsängers belief sich auf ungefähr 670 Lire, was einen durchschnittlichen Monatslohn von 50–60 Lire ergibt.2 Folglich verdienten die Sänger am Mailänder Dom etwas mehr als die Maurermeister, aber rund dreimal weniger als der Kapellmeister Fioroni. Allerdings konnten sich Kirchenmusiker zusätzliche Einnahmequellen erschliessen, was dem Handwerker, der eine feste Tagespauschale erhielt und somit bloss einer Tätigkeit nachgehen konnte, verwehrt blieb. Im Überblick zeigt sich, dass die Musiker der Domkapelle äusserst grosszügig bezahlt wurden. Der Kapellmeister an Santa Maria presso San Celso erhielt im Verhältnis lediglich 660 Lire pro Jahr und Giovanni Battista Sammartini als Kapellmeister an Sant’Ambrogio sogar nur 450 Lire. Eine solche Gegenüberstellung berücksichtigt jedoch nicht den Arbeitsaufwand, der mit dem jeweiligen Amt verbunden war. Gerade im Hinblick auf Sammartini ist zudem belegt, dass seine Frau Rosalinda Acquanio nach dessen Tod am 15. Januar 1775 von Maria Theresia eine Witwenrente über 500 Lire zugesprochen erhielt,3 was seinerzeit in etwa dem Jahreslohn eines Maurermeisters entsprach.
Grösseren Schwankungen waren die Nahrungsmittelpreise ausgesetzt, da der Marktpreis von der Erntemenge abhing. Der Getreidepreis schwankte zwischen 26 Lire (1710) und 16 Lire pro Mütt (1723), erreichte zur Jahrhundertmitte wiederum 26 Lire und überschritt Ende der 1770er-Jahre den Preis von 30 lire milanesi al moggio.4
Bereits in den 1910er-Jahren wiesen George de Saint-Foix und Fausto Torrefranca darauf hin, dass die Anfänge der Konzertsinfonie in Mailand zu lokalisieren sind.1 Seither konnten die Mailänder Ursprünge dieser Instrumentalgattung bestätigt und auf die Zeit um 1730 festgemacht werden.2 Von der Lombardei aus setzte die Sinfonie schliesslich zum allgemeinen Siegeszug an. Gemäss Giuseppe Carpani (1751–1825) führte Graf Ferdinando Bonaventura von Harrach, von 1747–1750 Gouverneur der österreichischen Lombardei in Mailand, die Instrumentalmusik Giovanni Battista Sammartinis (1700/01–1775) in Wien ein.3 Die Musik dieses bedeutendsten Mailänder Vertreters der Gattung sei daraufhin in der Kaiserstadt Wien in Mode gekommen und schliesslich in Privatkonzerten der Grafen Pálffy, Schönborn und Morzin erklungen. Joseph Haydn (1732–1809) machte bereits in jungen Jahren, nämlich bei seinem ersten Mäzen, dem Grafen Morzin, die Bekanntschaft mit Sammartinis Musik und lernte sie später am Hof der Esterházy näher kennen.4 Um die suggerierte Beeinflussung Haydns durch Sammartini weiter zu bezeugen, berichtet der Lombarde Carpani ferner, wie Josef Mysliveček ←23 | 24→um 1780 in Mailand Sammartini-Sinfonien gehört und dabei erstaunt festgestellt haben soll: »Ho trovato il padre dello stile di Haydn.«5
Details
- Pages
- 436
- Publication Year
- 2021
- ISBN (Softcover)
- 9783034339094
- ISBN (PDF)
- 9783034341004
- ISBN (ePUB)
- 9783034341011
- ISBN (MOBI)
- 9783034341028
- DOI
- 10.3726/b17062
- Open Access
- CC-BY-NC-ND
- Language
- German
- Publication date
- 2021 (March)
- Keywords
- liturgische Musik geistliche Musik 18. Jahrhundert Lombardei Ritus katholische Aufklärung Carlo Borromeo Karl Borromäus Tridentinum Konzil von Trient
- Published
- Bern, Berlin, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 2021. 436 S., 72 farb. Abb., 14 s/w Abb., 46 Tab.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG