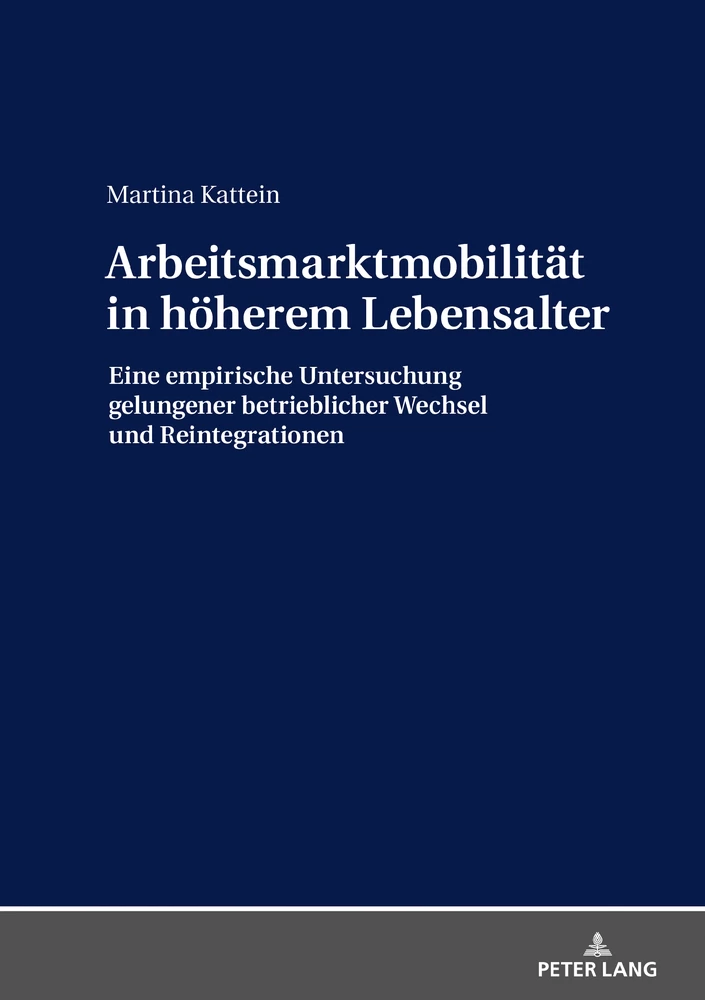Arbeitsmarktmobilität in höherem Lebensalter
Eine empirische Untersuchung gelungener betrieblicher Wechsel und Reintegrationen
Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titel
- Copyright
- Herausgeberangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Inhaltsverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Glossar
- Abbildungsverzeichnis
- Zusammenfassung
- 1 Einleitung
- 2 Arbeitsmarktsituation älterer Erwerbspersonen: Empirische Befunde
- 2.1 Erwerbsbeteiligung und Erwerbsformen
- 2.2 Erwerbs- und Arbeitslosigkeit
- 2.3 Neueinstellungen von Älteren
- 2.4 Austritt aus der Erwerbsphase
- 2.5 Resümee
- 3 Arbeitsmarkt und Arbeitsmarktsituation älterer Erwerbspersonen: Theoretische Ansätze und Diskurse
- 3.1 Theorien zur Leistungs- und Lernfähigkeit älterer Erwerbspersonen
- 3.1.1 Das Defizitmodell
- 3.1.2 Differentielle psychologische Gerontologie
- 3.1.3 Stigmatheorie
- 3.1.4 Arbeitspsychologische und arbeitswissenschaftliche Ansätze
- 3.2 Arbeitsmarkttheorien
- 3.2.1 Neoklassische Arbeitsmarkttheorie
- 3.2.2 Humankapitaltheorie
- 3.2.3 Segmentationstheorien
- 3.2.4 Vakanzkettentheorie
- 3.2.5 Organisationsdemografischer Ansatz
- 3.3 Industriesoziologische Ansätze
- 3.3.1 Polit-ökonomischer Erklärungsansatz
- 3.3.2 Produktionsregimespezifischer Ansatz
- 3.4 Sozialpolitikwissenschaftliche Ansätze
- 3.5 Geschlechtsspezifische Theorien
- 3.6 Diskurse zur Entwicklung der Erwerbstätigkeit
- 3.7 Resümee
- 4 Erwerbsbiografisch orientiertes Handeln älterer Erwerbspersonen
- 4.1 Handlungstheoretische Diskurse
- 4.1.1 Ausgewählte Entwicklungen innerhalb der soziologischen Handlungstheorie
- 4.1.2 Handlungstheoretische Implikationen aus den Diskursen zur Theorie der reflexiven Modernisierung
- 4.1.3 Handlungstheoretische Implikationen aus den Diskursen der Biografieforschung
- 4.2 Handeln und Alter
- 4.2.1 Diskurse der Alternssoziologie
- 4.2.2 Zentrale Handlungsdimensionen aus der Perspektive des höheren Lebensalters
- 4.3 Handeln im erwerbsbiografischen Kontext
- 4.3.1 Typologie zu Arbeitsmarktstrategien und Orientierungen von Facharbeitern im berufsbiografischen Verlauf (nach Baumeister, Bollinger, Geissler und Osterland)
- 4.3.2 Berufsbiografische Gestaltungsmodi (BGM) junger Fachkräfte (nach Zinn)
- 4.3.3 Cluster berufsbiografischer Orientierungen und Ausprägungen von Kompetenzen von (ehemaligen) WeiterbildungsteilnehmerInnen (nach Hendrich)
- 4.3.4 Die Typologien nach Baumeister et al., Zinn und Hendrich im Vergleich
- 4.3.5 Weitere Typologien
- 4.4 Resümee
- 5 Qualitative Analyse gelungener betrieblicher Wechsel und Reintegrationen in höherem Lebensalter: Forschungsdesign
- 5.1 Inhalte der qualitativen Analyse
- 5.2 Methodologie und Methodik
- 6 Qualitative Analyse gelungener betrieblicher Wechsel und Reintegrationen in höherem Lebensalter: Forschungsergebnisse
- 6.1 Beschreibung des Samples
- 6.2 Erwerbsverläufe
- 6.3 Spezifik der Umbruchphasen in höherem Lebensalter
- 6.4 Vorgehen bei der Stellensuche
- 6.5 Qualität der in höherem Lebensalter neu aufgenommenen Stelle
- 6.6 Erwerbsbiografische Handlungsmodi in der Umbruchphase
- 6.7 Stellensuchende in höherem Lebensalter aus der Perspektive der einstellenden Unternehmen
- 6.7.1 Unternehmen, die Stellensuchende ab 50 Jahren eingestellt haben
- 6.7.2 Sichtweisen und Engagement von Personalräten in Bezug auf die Einstellung von Stellensuchenden ab 50 Jahren
- 7 Resümee
- 7.1 Analytisch-kategoriale Ergebnisse – ein Analysemodell erwerbsbiografischer Umbruchphasen in höherem Lebensalter
- 7.2 Empirische Ergebnisse – theoretisch-konzeptionelle Diskussion und Forschungsdesiderata
- Literatur- und Quellenverzeichnis
- Danksagung
Tabellenverzeichnis
Tab. 1:Überblick über die Typologien nach Baumeister et al., Zinn und Hendrich
Tab. 2:Struktur der interviewten Erwerbspersonen nach Altersgruppe und Geschlecht
Tab. 3:Berufsfelder der befragten Erwerbspersonen nach Erstausbildung und aktueller bzw. letzter Stelle
Tab. 4:Stellendiskontinuität der befragten Erwerbspersonen
Tab. 5:Stellenbeendigungsgründe nach Anzahl und Region
Tab. 7:Berufsfeldwechsel
Tab. 8:Partielle Auf- und Abstiege nach Personen
Tab. 9:Partielle Auf- und Abstiege nach Alter
Tab. 10:Differenzierung der Arbeitsmarktlage nach Arbeitslosenquote 1991–2012
Tab. 12:Typologie: Erwerbsverläufe nach beruflichen Orientierungen und deren Realisierung
Tab. 13:Stellenaufnahmen und Arbeitslosigkeit nach Typen beruflicher Orientierungen und deren Realisierung
Tab. 17:Qualität der aktuellen bzw. letzten Stelle im erwerbsbiografischen Kontext←13 | 12→
Tab. 19:Operationalisierung der Subkategorien zur Realisierung von Orientierungen
Tab. 23:Erfahrungen von UnternehmensvertreterInnen mit eingestellten älteren Personen
Abbildungsverzeichnis
Abb. 1:Erwerbstätigkeit in höherem Lebensalter zwischen Wollen, Können und Müssen
Abb. 13:Altersspezifische Arbeitslosigkeitsdauern (in Wochen) und Anteile Langzeitarbeitsloser (in %) in Deutschland im Jahr 2015←13 | 14→
Abb. 15:Biografische Prozesskette und Interviewzeitpunkte
Abb. 16:Arbeitslosenquote bezogen auf abhängige zivile Erwerbspersonen 1991–2012
Glossar
Ausgewiesen sind nur Begriffe, die in der vorliegenden Arbeit spezifisch definiert wurden, zu übernommenen Definitionen sonstiger Begriffe s. die angegebenen Literaturverweise.
Arbeitshandeln: alle Versuche des Einwirkens auf die Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen; diese sind nur im Zusammenhang mit der Deutung durch die Handelnden verstehbar (z.B. hinsichtlich der unterschiedlichen Bedeutung eines Berufsfeldwechsels)
Arbeitsverwaltung: alle Einrichtungen der Leistungsverwaltung für Arbeitslose und der Arbeitsförderung in Trägerschaft des Bundes (Agenturen der Bundesagentur für Arbeit), der Kommunen oder in gemeinsamer Trägerschaft von Bund und Kommunen (Arbeitsgemeinschaften bzw. „ARGEN“)
Aushalten: Ausharren in schwierigen Bedingungen und deren Ertragen
Ausweichen: die ungewünschte oder gezwungene Wahl einer anderen als der originär gewünschten Alternative
Berufsfeldwechsel: Berufliche Wechsel auf der Berufsgruppen-Ebene entsprechend der „Klassifikation der Berufe 2010“ der Bundesagentür für Arbeit
Bewältigung: (Neu-)Ausrichtung verfolgter Ziele und Orientierungen an die Handlungsmöglichkeiten in einer Umbruchphase, mit denen den Individuen zumindest eine Teilidentifikation möglich ist
Diskontinuität der Berufs-/Erwerbsbiografie: jegliche, vor dem regulären Rentenalter erfolgten Unterbrechungen, Beendigungen oder Wechsel von Arbeitsstelle, Erwerbsstatus, Beruf sowie Tätigkeits- und Berufsstatus
Entfalten: eine Form des Entwickelns, nämlich Veränderung von Handeln, Einstellungen und Handlungsweisen, die eine Zunahme von Handlungsmöglichkeiten zur Realisierung eigener Wert- und Zielsetzungen bedeuten
Entwickeln: Veränderung von Handeln, Einstellungen und Handlungsweisen, vereinbar mit eigenen Wert- und Zielsetzungen
Erwerbsbiografisch orientiertes Handeln: Handeln, das über eine konkrete Handlungssituation hinausgehend sich auch auf grundlegendere Weichenstellungen der Erwerbsbiografie bezieht
←15 | 16→Erwerbsbiografische Handlungsmodi in der Umbruchphase in höherem Lebensalter: Umgehensweisen mit der Umbruchphase in höherem Lebensalter, die die jeweilige Zuwendung zu der Umbruchphase selbst wie auch deren Verortung in Verhältnis zu früher erwerbsbiografisch Erreichtem umfassen und damit die Grundlage für verfolgte Handlungsstrategien bilden
Erwerbsverlauf: der gesamte Erwerbs- und Berufsweg bis zum Interviewzeitpunkt inkl. der Umbruchphase in höherem Lebensalter
Gelingende Realisierung von Orientierungen im Erwerbsverlauf: eine (fast) durchgängige Erwerbsbeteiligung entsprechend dieser Orientierungen (ohne Berücksichtigung von freiwilligen familiär bedingten Erwerbsunterbrechungen und von Weiterbildungsphasen) mit einer summiert max. 12-monatigen Arbeitslosigkeitsdauer; der Gelingensbegriff trifft keine Aussagen über die Qualität des Erreichten
Gelingende Realisierung von Orientierungen in der Umbruchphase in höherem Lebensalter: Bewältigung der Umbruchphase durch Realisierung der bestehenden Orientierungen oder spezifischer (neuer) Ziele oder durch Arrangieren mit einer erfahrenen erwerbsbiografischen Verschlechterung (Nicht-Gelingen als Nichtbewältigung einer erwerbsbiografischen Verschlechterung); der Gelingensbegriff trifft keine Aussagen über die Qualität des Erreichten
Geplante Strategie: ein Handlungsplan, nach dem das Handeln einem entworfenen Ziel und einem intendierten Vorgehen folgt
Höheres Lebensalter: i.d.R. nach dem 50. Lebensjahr, aber ohne stringente Festlegung auf diese Altersgrenze, z.B. im Falle früher oder später gelegener altersbezogener Thematisierungen, arbeitsmarktstatistischer Datenausweisungen etc.
Orientierungen: handlungsleitende Vorstellungen, deren Vorhandensein und Wirksamkeit von den handelnden Individuen nicht unbedingt bewusst wahrgenommen und reflektiert werden müssen
Berufliche Orientierungen: berufsfachliche, auf der Identifikation mit einem spezifischen Beruf basierende Orientierungen oder arbeitsorientierte, das generelle Ausüben einer Arbeitstätigkeit priorisierende Orientierungen (in Abgrenzung zu sonstigen erwerbsarbeitsbezogenen Orientierungen)
Änderung der beruflichen Orientierung: berufsfachliche Neuorientierung hin zu einem neuen Berufsfeld als Wunschalternative
←16 | 17→Konstanz der beruflichen Orientierung: Festhalten an der konstanten berufsfachlichen Orientierung auf den Ausbildungsberuf bzw. an einer überwiegenden Arbeitsorientierung
Sonstige erwerbsarbeitsbezogene Orientierungen: Orientierungen u.a. auf soziale Integration, Beschäftigungssicherung, Existenzsicherung oder erwerbsarbeitsbezogene Reintegration (in Abgrenzung zu beruflichen Orientierungen)
Ressourcenlimitation von Stellensuchenden: Aspekte, die die berufliche Einsetzbarkeit begrenzen oder die in der Arbeitsmarktförderung als Vermittlungshemmnis gelten und spezifische Förderungen begründen
Ressourcenstärke von Stellensuchenden: Aspekte, die die Stellensuchenden aufgebaut und entwickelt haben und ihre berufliche Einsetzbarkeit aus der Perspektive der einstellenden Unternehmen befördern
Umbruchphase in höherem Lebensalter: Phase der Suche und Neuaufnahme einer oder mehrerer neuer Stellen in höherem Lebensalter, i.d.R. nach dem 50. Lebensjahr, die mit dem Ende der letzten vorhergehenden regulären Stelle oder einer eigeninitiativen Wechselabsicht eingeleitet wurde, teils aber auch in weiter zurückliegenden erwerbsbiografischen Entwicklungen, wie z.B. einem Ausscheiden aus dem Ausbildungsberuf nach Eintreten einer Berufskrankheit, begründet ist – dies schließt zusätzliche, anderweitige Umbruchphasen in der früheren Erwerbsbiografie nicht aus
Zusammenfassung
In der vorliegenden Dissertation werden betriebliche Wechsel aus Beschäftigung in Beschäftigung und Reintegrationen aus Arbeitslosigkeit oder Nichterwerbsarbeit in Erwerbsarbeit analysiert, die Erwerbspersonen in höherem Lebensalter, i.d.R. nach dem 50. Lebensjahr, gelungen sind. Das Thema greift damit ein Problem auf, das mit Verweis auf die demografische Entwicklung seit den 1990er Jahren in Wissenschaft und Politik auf Bundesebene wie auch international in zahlreichen Industrieländern intensiv thematisiert und forciert wird – die Steigerung der Erwerbstätigkeit in höherem Lebensalter. Für viele ältere Erwerbspersonen führten die eingeleiteten Gesetzesreformen allerdings zu einer zunehmenden Dilemma-Situation, in der die Anforderungen zu einem längeren Verbleib in Erwerbstätigkeit mit den für sie nach wie vor ausgeprägteren Arbeitsmarktrisiken konfligieren.
Welche subjektiven Erwerbsorientierungen die älteren Erwerbspersonen hierbei vor dem Hintergrund ihrer jeweiligen Erwerbsbiografien und Lebenslagen verfolgen, welche Erfahrungen sie auf dem Arbeitsmarkt machen, und wie sie hiermit umgehen, stellt einen eigenständigen Faktor in diesem Spannungsfeld dar. Diese Fragen sind bislang kaum erforscht, insbesondere nicht mit qualitativer Methodik, die in dem Forschungsfeld aber unverzichtbar ist, wenn erwerbsbiografische Orientierungen und Handlungsstrategien erkundet werden sollen. Das Erkenntnisinteresse richtete sich insbesondere auf ggf. identifizierbare spezifische Vorgehensweisen und Handlungsmodi der Erwerbspersonen in der Umbruchphase in höherem Lebensalter, auf die Qualität der dann neu aufgenommenen Stelle und ihren Vergleich zur vorhergehenden Erwerbsbiografie sowie auf einstellungsrelevante Kriterien der einstellenden Unternehmen.
Im Rahmen einer empirischen Erhebung wurden halbstrukturierte Leitfadeninterviews mit 24 Erwerbspersonen, neun betrieblichen Leitungskräften und zwei ArbeitnehmerInnenvertretungen geführt. In der Auswertung wurde das Verfahren der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring kombiniert mit dem axialen und selektiven Kodieren der grounded theory methodology nach Strauss und Corbin sowie mit der Entwicklung von Typologien nach Kelle und Kluge. Im Ergebnis wurden die im Auswertungsprozess gebildeten Analysekategorien zu einem transferierbaren Analysemodell für erwerbsbiografische Umbruchphasen in höherem Lebensalter verdichtet. Die inhaltlichen Befunde verdeutlichten eine große Heterogenität in den Vorgehensweisen und Handlungsmodi der Erwerbspersonen in der Umbruchphase in höherem Lebensalter, eingebettet ←21 | 22→in unterschiedliche Erwerbsbiografien und sozio-ökonomische Kontexte. In der letztmalig aufgenommenen Stelle konnte sich eine große Mehrheit der befragten Erwerbspersonen gegenüber der vorhergehenden Stelle bzgl. Vergütung, Status und sozialer Absicherung verbessern oder dessen Niveau zumindest partiell verbessern oder halten. Die Hälfte der Befragten hatte hingegen bei der Stellenaufnahme in höherem Lebensalter Verschlechterungen in diesen Kategorien gegenüber ihrem früher erreichten besten Niveau hinzunehmen. Für einige Handlungsebenen wurden schließlich Möglichkeiten zur Unterstützung von Erwerbsverläufen in höherem Lebensalter aufgezeigt.
Abstract
This thesis analyses how economically active individuals in the 50 or over 50 age group succeed in changing employers or reintegrating into the workforce after being unemployed or not having actively sought gainful employment. In doing so, the study takes up a problem that, with reference to demographic trends, has been intensely thematised and pushed in science and politics on the federal level in Germany as well as internationally in many industrial countries since the 1990s: the rise in gainful employment among older individuals. However, related legislative reforms instituted confront many of the older gainfully employed and unemployed with a growing dilemma, as pressures to remain economically active conflict with the more pronounced labour market hazards they continue to face.
In this conflict situation, the subjective employment orientations that guide older employed and unemployed persons against the background of individual work biographies and life circumstances, and how they handle what they encounter in the labour market, constitute independent factors. To date, these questions have scarcely been investigated, particularly not with the qualitative methods that are indispensable in this research field if work biography-related attitudes and action strategies are to be explored. The investigation focuses especially on 1) identifiable specific approaches and action modes that employed and unemployed persons resort to when undergoing radical change at an older age, on 2) the quality of the new position obtained in the context of the preceding work history, and, 3) on employer recruiting criteria.
This empirical study relied on semi-structured guided interviews with 24 economically active individuals, nine business managers, and two employee representatives. The evaluation phase combined the qualitative content analysis method after Mayring with axial and selective coding under the grounded theory methodology after Strauss and Corbin and the construction of typologies ←22 | 23→after Kelle and Kluge. The analytical categories generated in the evaluation phase were distilled into a transferable analytical model of radical changes in the work biography at an older age. The contentual findings illustrated widely heterogeneous approaches and action modes grounded in differing work biographies and socioeconomic contexts pursued by the older economically active individuals during periods of upheaval. In the last job taken, a large majority of the survey subjects bettered, or at least equaled, the pay, status, and benefits they had obtained in their most recent prior position. Nevertheless, half of the survey subjects also indicated that they fared worse with the new employer in comparison with the peak jobs held in their previous work history. The study in conclusion points to possible interventions on certain levels in support of work biographies of older individuals.
1 Einleitung
Die Themenwahl der vorliegenden Forschungsarbeit zur „Arbeitsmarktmobilität in höherem Lebensalter“ war neben dem sozialwissenschaftlichen Interesse an der Arbeitsmarkt- und Biografieforschung auch aus der Neugier motiviert, die zunehmend restriktiver gestalteten Renten- und Arbeitsmarktreformen aus der subjektiven Perspektive der Erwerbspersonen zu beleuchten. Die eigene parallel zum Forschungsprozess eintretende Erfahrung von „Umbruchphasen in höherem Lebensalter“ stellte dabei eine unvermittelte Nähe zum Forschungsthema her, die herausfordernd war.
Zur näheren Erläuterung dieses Forschungsthemas wird nachfolgend die politische Rahmung vorgestellt, die auf eine Ausweitung der Erwerbstätigkeit in höherem Lebensalter abzielt. Relevante sozialwissenschaftliche Forschungskontexte, an die das Thema anschließt, werden dargelegt sowie Forschungslücken aufgezeigt. Im Weiteren werden Ziel und Methodik der vorliegenden Forschungsarbeit ausgeführt und zentrale Forschungsergebnisse zusammengefasst. Die Erläuterung der Gliederung und ein Lesehinweis schließen das Kapitel ab.
Politische Rahmung: Ausweitung der Erwerbstätigkeit in höherem Lebensalter
Erwerbstätigkeit in höherem Lebensalter wurde in den 1990er und insbesondere den 2000er Jahren in Wissenschaft und Politik auf Bundesebene wie auch international in zahlreichen Industrieländern intensiv thematisiert. Ausgelöst wurde dies wesentlich durch demografische Prognosen, die für die kommenden Jahrzehnte eine massive Abnahme der Bevölkerung bei gleichzeitiger Zunahme des Anteils der Altersgruppe ab 65 Jahren voraussagten. In der Folge wurde ein Handlungs- und Forschungsbedarf prioritär für die Erwerbsintegration älterer Erwerbspersonen, die Sozialversicherungen, speziell die Rentenversicherung, sowie die technische und soziale Infrastruktur gesehen.
Ohne an dieser Stelle eine nähere Auseinandersetzung über die Nichtfundierbarkeit langzeitiger Bevölkerungsprognosen und deren teils apokalyptisch ausfallende Rezeption in Forschung und Medien1 führen zu wollen, wurden in ←25 | 26→der Folge entscheidende Weichenstellungen vorgenommen, die u.a. auf eine vermehrte und verlängerte Erwerbstätigkeit in höherem Lebensalter abzielten.
Zu deren Kern zählte die Reformierung des Rentenrechts. Durch den Abbau vorzeitiger Renteneintrittsmöglichkeiten und die Heraufsetzung des regulären Renteneintrittsalters stieg die Anforderung zu einem längeren Verbleib in Erwerbstätigkeit für ältere Erwerbspersonen, sofern sie nicht über hinreichend alternative Einkommensquellen verfügten. Diese Reformen erfolgten in mehreren Schritten seit 1992 und unter allen seitherigen Koalitionen, verstärkt ab Ende der 1990er Jahre (vgl. Deppe & Förster 2014, Bäcker et al. 2009, BfA DRV-Gemeinschaft o.J.).
Komplementär hierzu wurde in der Arbeitsmarktpolitik beginnend mit dem Job-AQTIV-Gesetz 2002 und insbesondere den sog. Hartz-Gesetzen 2003–2005 ein Paradigmenwechsel eingeleitet, mit dem die Eigenbemühungen von Arbeitslosen generell wie auch von älteren Arbeitslosen u.a. durch „Aktivierung“, und „Fordern und Fördern“ sanktionsuntersetzt erhöht werden sollten, während ein bis 2007 möglicher Arbeitslosengeldbezug auch ohne aktive Arbeitsuche für Arbeitslose ab 58 Jahren nach § 428 SGB III und § 65 SGB II ab 2008 auslief (vgl. Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz o.J.h, dass. o.J.g). Für Arbeitslose resultierten hieraus – wenn auch für Ältere abgemilderte – Kürzungen der Leistungsbezugsdauer, vielfach finanzielle Verschlechterungen im Arbeitslosengeld II-Bezug, aber auch geringere Zugänge zu Weiterbildungsmaßnahmen in der unter dem Druck von Vermittlungserfolgen agierenden Bundesagentur für Arbeit. (Vgl. Frerichs 2007, S. 80 ff., Hans-Böckler-Stiftung 2006, S. 12 ff., 33 f.)
Parallel wiesen die politischen Bestrebungen auf EU-Ebene in eine ähnliche Richtung. Die Beschäftigungsquote älterer Erwerbspersonen wurde im Zuge der „Lissabon-Strategie“2 des Europäischen Rates in seiner Tagung am 23./24.03.2000 in Lissabon als zu niedrig problematisiert (vgl. Europäischer Rat 2000, S. 1). In seiner Tagung am 23./24.03.2001 in Stockholm formulierte der Europäische Rat diesbezüglich als konkrete Zielvorgaben für die EU die Steigerung der durchschnittlichen EU-Beschäftigungsquote der 55–64-jährigen Männer und Frauen auf 50 % bis 2010 (vgl. Europäischer Rat 2001, S. 2). Als ←26 | 27→ergänzendes Ziel benannte der Europäische Rat in seiner Tagung in Barcelona am 15./16.03.2002 die Steigerung des realen Durchschnittsalters bei Beendigung des Arbeitslebens in der EU um 5 Jahre bis 2010, was u.a. durch Altersteilzeitregelungen und einen „echten“ Zugang zum lebenslangen Lernen bei einer gleichzeitigen Reduktion von Vorruhestandsanreizen realisiert werden sollte (vgl. Europäischer Rat 2002, S. 12). Tatsächlich verweisen die Daten zur Erwerbstätigkeit auf beachtliche Anstiege, wonach im Jahr 2016 die 55–64-Jährigen in Deutschland im EU-Vergleich die zweithöchste Erwerbstätigenquote in Höhe von 68,6 % erreichten (vgl. Eurostat 2017, S. 4).
Die skizzierten Gesetzesreformen in der Bundesrepublik wurden begleitet durch die Förderung von Forschungs- und Entwicklungsprojekten, Initiativen und Kampagnen zur Bearbeitung von Hemmnissen für die Erwerbstätigkeit in höherem Lebensalter inkl. der Motivierung von Unternehmen zur Weiterbeschäftigung und Neueinstellung älterer Erwerbspersonen.3 Hierzu zählten laut Stellungnahme des Bundesfamilienministeriums zum dritten Altenbericht u.a. der im Jahr 1994 eingerichtete Förderschwerpunkt „Demographischer Wandel und Zukunft der Erwerbsarbeit in Deutschland“ im Rahmen des Forschungs- und Entwicklungsprogramms „Arbeit und Technik“ sowie das 1999 initiierte Transferprojekt „Öffentlichkeits- und Marketingstrategie demographischer Wandel“ (vgl. BMFSFJ 2001, S. 31). Weitere Ansätze umfassten beispielsweise die 2005 gestartete Initiative „Erfahrung ist Zukunft“, die von sechs Bundesministerien, Wirtschaftsverbänden, Gewerkschaften und anderen gesellschaftlichen Organisationen getragen wird und für den „Erfolgsfaktor Erfahrung“ wirbt (vgl. BMFSFJ 2008a, S. 8, 79 ff., Presse- und Informationsamt der Bundesregierung 2013), oder die von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) getragene Initiative Neue Qualität der Arbeit (INQA), die ebenfalls von mehreren Bundesministerien und zahlreichen wirtschaftlichen, gewerkschaftlichen und gesellschaftlichen Organisationen unterstützt wird (vgl. Internetpräsentation Initiative Neue Qualität der Arbeit o.J.: www.inqa.de, INQA 2008).
Ein Fokus dieser Initiativen richtete sich darauf, die Leistungsfähigkeit, Innovationsfähigkeit und Produktivität älterer Erwerbspersonen positiv herauszustellen. So untersuchte der fünfte Altenbericht der Bundesregierung das Thema „Potenziale des Alters in Wirtschaft und Gesellschaft – Der Beitrag älterer Menschen zum Zusammenhalt der Generationen“ (vgl. Sachverständigenkommission „5. Altenbericht der Bundesregierung“ 2005). Als weiteres Beispiel sei auf ←27 | 28→die vom BMFSFJ herausgegebene prognos-Studie verwiesen, die sich mit der Frage auseinandersetzte: „Kosten Ältere wirklich mehr?“ (vgl. BMFSFJ 2008b, S. 54 ff.).
In zahlreichen psychologischen Studien wurde die physische und psychische Leistungsfähigkeit älterer Menschen vermessen und in volkswirtschaftlichen Analysen ihre Produktivität berechnet – mit kontroversen Ergebnissen (vgl. kritisch hierzu: Kruse 2000, S. 76 f., Börsch-Supan, Düzgün & Weiss 2005, S. 10 ff.). Diesen Ergebnissen kann, wie in der vorliegenden Arbeit gezeigt wird, auf der Deutungs- und Handlungsebene der ArbeitsmarktakteurInnen und damit für die Arbeitsmarktchancen älterer Erwerbspersonen eine hohe Wirkmacht unterstellt werden, zugleich erweisen sich aber jedwede Altersbegründungen und -generalisierungen als nicht tragfähig (vgl. Kap. 3.1). Zu hinterfragen ist hierbei nicht nur, wieso überhaupt die Leistungsfähigkeit älter werdender Menschen im Hinblick auf ihr Lebensalter berechnet wird, sondern auch, wieso der forschungs- und wirtschaftspolitische Fokus nicht längst von der individuellen Leistungsfähigkeit spezifischer Personengruppen hin zu einer gesundheitsförderlichen Gestaltung von Arbeit gerichtet wurde, die für Erwerbspersonen unterschiedlicher Leistungsprofile ausführbar und attraktiv ist.
Relevante sozialwissenschaftliche Forschungskontexte
Details
- Seiten
- 608
- Erscheinungsjahr
- 2018
- ISBN (Hardcover)
- 9783631763407
- ISBN (PDF)
- 9783631767719
- ISBN (ePUB)
- 9783631767726
- ISBN (MOBI)
- 9783631767733
- DOI
- 10.3726/b14916
- Open Access
- CC-BY-NC-ND
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2018 (Dezember)
- Schlagworte
- Arbeitsmarkthandeln Erwerbsbiografien Erwerbsorientierungen Qualitative Forschung Biografieforschung Demografischer Wandel
- Erschienen
- Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 2018. 608 S., 25 Tab., 17 Graf.
- Produktsicherheit
- Peter Lang Group AG