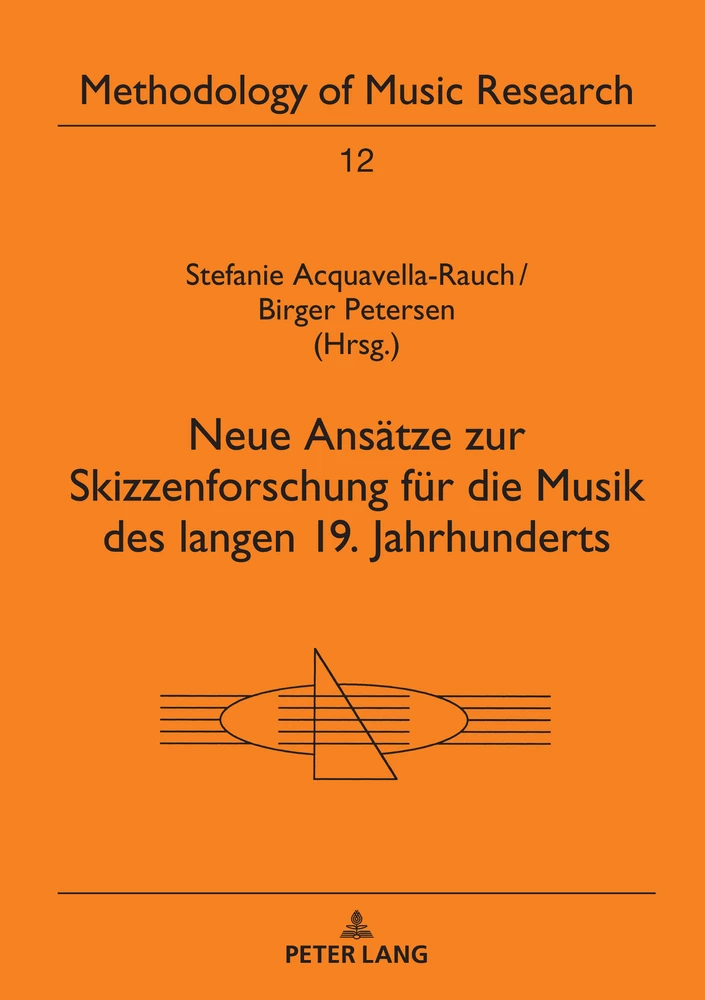Neue Ansätze zur Skizzenforschung für die Musik des langen 19. Jahrhunderts
Summary
Excerpt
Table Of Contents
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Inhalt
- Skizzenforschung für die Musik des langen 19. Jahrhunderts. Überlegungen zu neuen Ansätzen: (Stefanie Acquavella-Rauch und Birger Petersen)
- Schriftbildlichkeit
- Die frühesten Handschriften von Richard Strauss. Zu Manuskriptsorten und Kompositionsprozess in der ersten Schaffensdekade: (Marcel Klinke)
- Rheinbergers Skizzen. Neue (Be-)Funde zur Orgelmusik: (Birger Petersen)
- Idiosynkrasie und Schriftlichkeit. Textgenetische Spuren in den Skizzenmanuskripten Max Regers: (Franziska Reich)
- Schriftbildlichkeit bei Ludwig van Beethoven: (Julia Ronge)
- Rekonstruktion des musikalischen Denkens
- »… a humble […] approach toward[s]; perfection.« Skizzierung bei Arnold Schönberg in Unterricht und Kompositionspraxis: (Eike Feß)
- Max Regers Schreibprozess und seine Entwicklungen in der Wiesbadener Zeit (1890–1898): (Stefan König)
- Vom »Studieren« und »Zergliedern«. Zu Peter Cornelius' Abschriften aus der komponierten Literatur: (Stephan Zirwes)
- Interdisziplinärer Methodendiskurs
- Von romantischer Ironie zu ernsthafter Realität. Ein Beitrag zur kompositorischen Schaffensästhetik: (Stefanie Acquavella-Rauch)
- Interpretationsskizzen: (Manuel Bärtsch)
- »In effigie«. Skizze, Improvisation und Ausarbeitung bei Carl Loewe: (Martin Loeser)
- Personenregister
- Reihenübersicht
Stefanie Acquavella-Rauch und Birger Petersen
Skizzenforschung für die Musik des langen
19. Jahrhunderts. Überlegungen zu neuen
Ansätzen
Wer mit dem Begriff ›Skizze‹ zunächst »die autographe Spur eines kompositorischen Schaffensprozesses, die nicht den Status eines abgeschlossenen und ausgeführten Werktextes hat und sowohl zum Quellenkomplex eines konkreten Kompositionsprojektes gehört, als auch unabhängig davon entstehen kann« bezeichnet,1 versteht Komponieren als Entwerfen und Entwickeln von Musik und so als Schreibvorgang und gedanklichen Prozess. Damit verbunden ist ein jeweils spezifisches neuzeitliches Künstlerbild – ebenso wie ein spezifischer Kunstbegriff:2 Die Verknüpfung von Denken, Schreiben und Skizzieren qualifiziert das Komponieren als intellektuellen Vorgang.3 Das Notieren von Ideen, Entwürfen oder Kontexten begleitet den kompositorischen Schaffensprozess. Das sich zwischen den Materialien verschiedener Ebenen und Medialität entwickelnde Beziehungsgeflecht kann unterschiedlich fixierte Gestalt annehmen.
Während die Erforschung von Skizzen und Fragmenten, insbesondere auch deren Edition, in der Literaturwissenschaft bereits sehr präsent ist4 und oft entscheidende Aufschlüsse bei philologischen, aber auch hermeneutischen Problemstellungen geben kann, gehört die musikalische Skizzenforschung erst seit ←7 | 8→relativ kurzer Zeit zum methodischen Repertoire der historischen Musikwissenschaft.5 Parallel zur Entwicklung etwa der ›critique génétique‹ in der (zunächst französischen) Literaturwissenschaft der 1960er Jahre, die den Akt des Schreibens untersucht und bislang zu bemerkenswerten Differenzierungen gelangt ist,6 ist in der Musikwissenschaft eine ernsthafte Skizzenforschung aus der Intensivierung einer methodisch reflektierten und philologisch fundierten ›Werkstattforschung‹ erwachsen, die erst im späten 20. Jahrhundert einsetzt.7 Pate standen ←8 | 9→neben der ›critique génétique‹ auch andere Perspektiven, etwa die der ›material philology‹ oder der Schriftbildlichkeitsforschung.8
Die musikalische Editionspraxis verfährt im Umgang mit Skizzenmaterial meist pragmatisch – unter Berufung auf bewährte philologische Operationen, um eine plausible Ordnung in fragmentarische Überlieferungen zu bringen oder nur noch rudimentär erkennbare Konzeptionen zu erkennen. Das grundlegende Dilemma, ob Skizzen und Fragmente Sonderformen der Überlieferung darstellen oder ein Textgebilde eigener Kohärenz9 mit einem speziellen Verhältnis zum ›Werk‹ sind, teilt die Musikwissenschaft mit der Literaturwissenschaft als offene Frage des editionswissenschaftlichen Diskurses. Bereits die humanistischen Philologen erkannten im Fragment »ein wesentliches Merkmal der Überlieferung antiker und mittelalterlicher Literatur«10 und prägten die Bedeutung eines ›literarischen Bruchstücks‹. Eine besondere Qualität besitzen dabei Skizzen wie Fragmente in der Nachfolge der Romantik im späten 19. und 20. Jahrhundert: Das Fragment als ›ästhetische Idee‹ mag als Charakteristikum der Moderne gelten, in der die Orientierung an einer werkorientierten Idee in Zweifel gezogen wird11 – festgemacht etwa an den Fragmenten bei Novalis oder Hölderlin bis hin zum Schaffen Georg Heyms.
Die eigentlichen Methoden bleiben dabei variabel – mit Blick auf das eigentliche philologische Ziel. Die Dissertation Fabian Czolbes etwa nimmt Methoden ←9 | 10→musikalischer Skizzenforschung zum Ausgangspunkt und verknüpft sie mit aktuellen Theorien zur Schriftbildlichkeit, um daraus den Entwurf einer schriftbildlichen Skizzenforschung zu Musik zu erarbeiten, der anhand von Skizzen und deren Konfiguration den kompositorischen Schaffensprozess nachzuzeichnen sucht.12
Musikalische Skizzenforschung zum späten 19. Jahrhundert im Vergleich der Arbeitsweisen verschiedener Komponisten
Im kulturhistorischen Kontext der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ist – gemessen an den Erkenntnissen aus der Literaturwissenschaft – nach der Relevanz von Skizzenmaterial und nach dem Ort des zum Teil sehr umfangreichen Materials zu fragen. Dass die Skizzenforschung insbesondere für die Musik des 19. und 20. Jahrhunderts besonders aktiv ist, dürfte nicht nur der historischen Nähe zum musikalischen Gegenstand geschuldet sein.13 Eine große Rolle spielte dabei ursprünglich der traditionelle – und inzwischen zu erweiternde – Ansatz, das Schaffen und Wirken bedeutender ›Komponistengenies‹, beginnend mit Ludwig van Beethoven, nachvollziehen zu wollen.
Allerdings ist die Lage der musikalischen Skizzenforschung zum späten 19. Jahrhundert grundlegend anders geartet und sehr stark differenziert: So hat etwa Johannes Brahms – anders als Wolfgang Amadé Mozart oder Arnold Schönberg, der ausdrücklich seinen eigenen Skizzen und Fragmenten Bedeutung zumaß – sein gesamtes Werkstattmaterial vernichtet.14 Ähnlich wie bei Ludwig van Beethoven, dessen 70 überlieferte ›Skizzenbücher‹ vorzüglich erschlossen, aber bislang nur zu einem kleinen Teil in Quelleneditionen zugänglich gemacht worden sind,15 sind auch die Skizzen und Entwürfe Max Regers (bei denen es sich in erster Linie um Verlaufsskizzen handelt, die deutliche Abweichungen zu ←10 | 11→Beethovens Arbeitsskizzen aufweisen) dokumentiert,16 werden aber gegenwärtig in einer hybriden Editionsform in der Reger-Werkausgabe aufgearbeitet und für eine digitale Präsentationsform aufbereitet.17
Es ist bisher vor allem im Fall Beethovens (und bislang nur eingeschränkt bei Mozart) gelungen, die Skizze als gleichrangiges Quellenmaterial anzuerkennen, das bisweilen über besondere Schlüsselfunktionen verfügt. Während bei Beethoven, der musikalische Ideen in stets mitgeführten Notizheften sofort festzuhalten bemüht war,18 aber auch bei Schönberg zwischen Skizzenbüchern einerseits und Arbeitsmanuskripten andererseits, die bereits das Werk klar hervortreten lassen und als Zwischenstufe zur fertigen Partitur zu verstehen sind, eine klare archivarische und bedingt auch eine arbeitstechnische Trennung herrscht – wobei zwischen Skizzenbuch und Arbeitsmanuskript ein Hiatus besteht –,19 erklärt sich die Fülle an Skizzenmaterial bei Josef Gabriel Rheinberger neben der grundsätzlich anderen Schaffensweise des Komponisten durch seine intensive Unterrichtstätigkeit. Auch bei Rheinberger können sich Werkstattmanuskripte finden, die – wie bei Beethoven – »letzten Endes eine Serie von ›Skizzen‹«20 sind. Wie in der Literaturwissenschaft auch ist die Frage, welche Rolle Skizzen in der Entstehung letztgültiger Partituren spielen, autortypisch und nicht ausgehend von Modellvorstellungen zu lösen. Ein interdisziplinärer Austausch kann an dieser Stelle das Methodenspektrum ebenso weitergehend voranbringen wie ein Vergleich unterschiedlichen Skizzenmaterials verschiedener Komponisten.
←11 | 12→Skizzenforschung und Möglichkeiten einer Rekonstruktion musikalischen Denkens
Zu den vornehmsten Aufgaben der Musiktheorie gehört die Analyse. Die besondere Situation der Musiktheorie als Disziplin innerhalb der Musikwissenschaft ermöglicht aufgrund der besonderen Expertise von Musiktheoretiker*innen in der Differenzierung und Identifikation von musikalischen Notationen entscheidende Perspektivwechsel für die musikalische Skizzenforschung auch außerhalb einer verengten philologischen Fragestellung: Mit Hilfe der Musiktheorie kann sich die musikalische Skizzenforschung aus der unmittelbaren Verbindung zur philologischen Erschließung von Werkgenesen im Kontext von Editionsprojekten lösen und sich in den größeren Kontext einer Schreibforschung stellen.21 Dabei gilt die Bemerkung Almuth Grésillons: Selbst bei hervorragenden Überlieferungsbedingungen »bieten die Handschriften nur einen kleinen Teil von Indizien für die gesamten mentalen Prozesse, die zwischen dem Beginn eines Projekts im Kopf oder im Unterbewussten des Autors und der Übergabe eines fertigen Textes an den Drucker erfolgen.«22 Aber der Einblick in die Komponistenwerkstatt macht nicht nur das Prozesshafte des kompositorischen Schaffens greifbar:23 Er versetzt die Interessierten in die Lage, komplexe musikalische Denkvorgänge nachzuvollziehen. In erweiterter Perspektive trägt das Studium der Skizzen zu einer bis heute ausstehenden, als Problemgeschichte des Komponierens zu definierenden Kulturgeschichte musikalischen Schaffens auf einer stark individualisierten Ebene bei – und verpflichtet gleichzeitig die hermeneutisch ausgerichtete Kulturgeschichte auf ein philologisch fundiertes Quellenfundament,24 indem die Skizzenforschung einheitsstiftenden Verstehensbemühungen die genaue Quellenlektüre entgegensetzt.
Die unterschiedlichen Bereiche der Musikwissenschaft – etwa die (digitale) Musikedition und die Musiktheorie – verbinden dabei unterschiedliche methodische Zugangsweisen zu musikalischen Phänomenen. Die Möglichkeiten digital basierter Musikeditionen bieten – insbesondere in Hinsicht auf die Darstellung graphischer Prozesse oder anderer metatextueller Informationen in Digitalisaten – neue Zugangswege, wie beispielsweise derzeit anhand der Aufarbeitung ←12 | 13→des Skizzenmaterials Beethovens deutlich wird.25 Diese Ansätze sind auch für eine Aufarbeitung anderer und andersgearteter ›Komponistenwerkstätten‹ etwa derjenigen Rheinbergers von großem Interesse. In seinen Skizzenbüchern und Arbeitsmanuskripten stehen beispielsweise unterschiedliche Stadien des Komponierens und der Ausarbeitung nebeneinander, wozu eine Fülle an tendenziell ungeordneten Mitschriften aus seiner Unterrichtstätigkeit kommt. Modalitäten des Skizzierens sind voneinander zu unterscheiden, die den Kompositionsprozess als solchen durchdringen, aber kategorial verschiedenen kompositorischen Arbeitsformen angehören können. Gerade die Auseinandersetzung mit Material aus musikalisch-kompositorischen Lehrkontexten stellt einen neuen Ansatz für die Skizzenforschung dar, den es mit Hilfe des Bandes erstmals auszuloten gilt.
Themenkomplexe
Der vorliegende Band ist das Ergebnis einer gleichnamigen Tagung, die zwischen dem 20. und 22. September 2018 am Alfried Krupp-Wissenschaftskolleg Greifswald stattfand. Dabei wurden die folgenden Themenkomplexe berücksichtigt und sind nun mit eigenen Beiträgen vertreten:
1. Schriftbildlichkeit. Unterschiedliche Schriftbilder zeitigen unterschiedliche Arbeitsweisen – auch und vor allem bei Komponisten. Trotz der insbesondere für das 19. Jahrhundert günstigen Quellensituation ist dieser Bereich weitgehend unerforscht. Die Tagung und diese Publikation haben die diesbezügliche Diskussion durch Beiträge zum (Hand)Schriftbild verschiedener Komponisten wie Richard Strauss, Josef Gabriel Rheinberger, Max Reger oder Ludwig van Beethoven auch bezogen auf einen Vergleich kompositorischer Arbeitsweisen erweitert. Es ist bisher nur in wenigen Fällen (insbesondere bei Ludwig van Beethoven und Wolfgang Amadé Mozart) gelungen, die Skizze als gleichrangiges Quellenmaterial mit Schlüsselfunktion anzuerkennen. Ein interdisziplinärer Austausch kann an dieser Stelle das Methodenspektrum ebenso voranbringen wie komparatistische Fragestellungen. Dabei stehen eher traditionelle Ansätze wie etwa zu Beethoven neueren – z. B. zu neu erschlossenen Quellengattungen – gegenüber.
←13 | 14→2. Rekonstruktion des musikalischen Denkens. Während häufig vor allem Skizzenbücher und Arbeitsmanuskripte Einblicke in das kreative Denken zulassen, erklärt sich die Fülle an Skizzenmaterial bei Josef Gabriel Rheinberger u. a. durch seine intensive Unterrichtstätigkeit. Anhand des nachgelassenen Materials zu musikalisch-kompositorischen Lehrkontexten etwa von Peter Cornelius, Rheinberger oder Arnold Schönberg lassen sich die Werkstätten des 19. Jahrhunderts als Lehrwerkstätten rekonstruieren.
3. Interdisziplinärer Methodendiskurs. Skizzenforschung bietet einen der wenigen Zugänge dazu, wie künstlerische Gedanken im weitesten Sinne entstehen können. Ein intensiver Austausch mit der Literaturwissenschaft sowie gerade auch neue Ansätze etwa zu Interpretationsskizzen aus dem Kontext von Rollenaufnahmen für Reproduktionsklaviere sowie zum Thema Improvisation sind im Hinblick auf eine Öffnung der Thematik über Fächergrenzen hinaus sehr vielversprechend. Aus redaktionellen Gründen können die Tagungsbeiträge von Federica Rovelli (»Die Beethoven-Skizzenforschung zwischen deiktischen Darstellungsstrategien und multiperspektivischen Vermittlungsformen«) und Eckhard Schumacher (»Digitale Literaturwissenschaft – die Edition von Jugend von Wolfgang Koeppen als Beispiel für neue Ansätze der literaturwissenschaftlichen Skizzenforschung«) leider nicht in diesem Band erscheinen.
Anhand dieser verschiedenen Schwerpunkte werden das bisherige Methodenspektrum der musikalischen Skizzenforschung genauso wie die in diesem Kontext außerdem zu beachtenden Themenbereiche erweitert und neue Diskussionen angestoßen.
Der vorliegende Band zeigt daher nicht nur neue Ansätze auf, sondern bringt auch verschiedene Teildisziplinen der Musikwissenschaft miteinander in den Dialog. Der Erforschung des kreativen Denkens von Kunstschaffenden kommt damit eine wichtige Aufgabe zu und rückt das Feld der musikalischen Skizzenforschung zudem wieder näher an aktuelle musikwissenschaftliche Diskussionen rund um musikhistoriographische Zugänge und die Ausbildung von musikästhetischen Ansätzen. Übergeordnet handelt es sich damit um einen Beitrag dazu, das Studium der Skizzen als eine als Problemgeschichte des Komponierens zu definierende Kulturgeschichte musikalischen Schaffens formulieren zu können.
Die Herausgeberin und der Herausgeber danken der Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung, Essen, für die großzügige Unterstützung der Tagung in Greifswald sowie den Freunden der Universität Mainz e. V. für die Finanzierung dieser Publikation. Abschließend sei außerdem Nico Schüler für die unkomplizierte Unterstützung beim Peer Review-Prozess und die Aufnahme des Bands in die Reihe Methodology of Musicological Research sowie dem Verlag Peter Lang für die professionelle Betreuung bei der Publikation gedankt.
Details
- Pages
- 206
- Publication Year
- 2020
- ISBN (Hardcover)
- 9783631797341
- ISBN (PDF)
- 9783631835975
- ISBN (ePUB)
- 9783631835982
- ISBN (MOBI)
- 9783631835999
- DOI
- 10.3726/b17609
- Open Access
- CC-BY
- Language
- German
- Publication date
- 2020 (December)
- Keywords
- Skizzenforschung Werkstattforschung Schaffensprozess Kreativitätsforschung 19. Jahrhundert Schriftbildlichkeit musikalisches Denken Komposition Skizzen
- Published
- Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 2020. 206 S., 15 farb. Abb., 50 s/w Abb., 2 Tab.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG