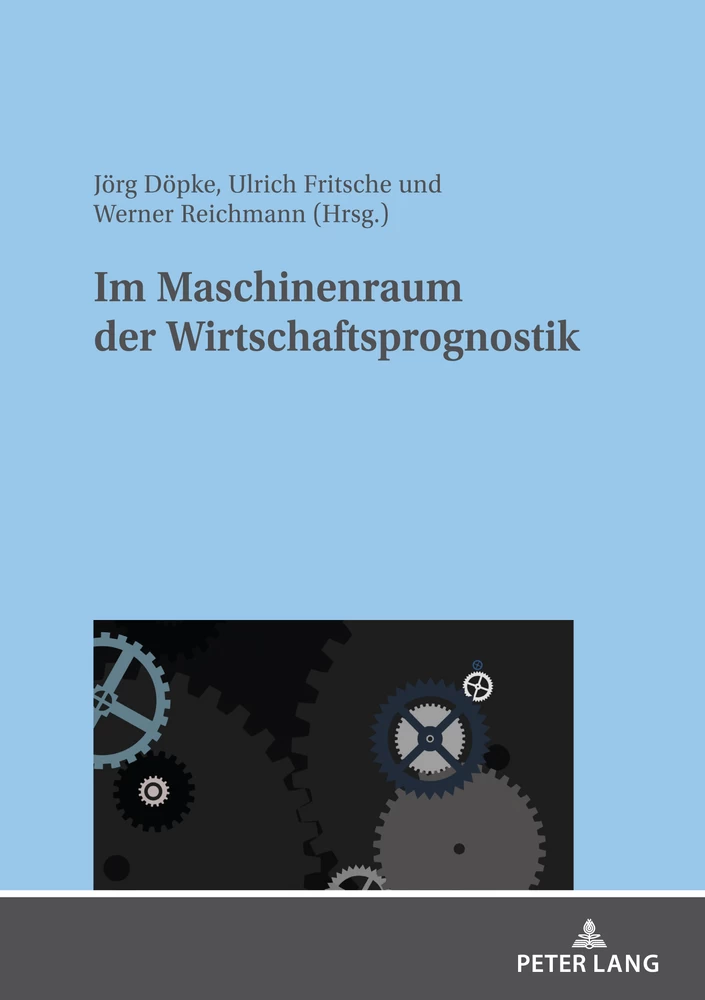Im Maschinenraum der Wirtschaftsprognostik
Summary
Ergebnissen ökonomischer Forschung und Beratung. Sie sind wesentlicher Bestandteil
ökonomischer Erwartungsbildung, sie dienen als Grundlage für politische
Entscheidungen und sind wichtige Stichwortgeber in Debatten über wirtschaftliche
Entwicklungen. Gleichzeitig sind Wirtschaftsprognosen auch umstritten.
Dieser Band versammelt elf Gespräche mit Personen, die in den letzten 40 Jahren
einen maßgeblichen Anteil an der Herstellung, Weiterentwicklung und Verbreitung
von Wirtschaftsprognosen in Deutschland hatten. Sie gewähren umfassende Einblicke
in den „Maschinenraum der Wirtschaftsprognostik“. Dabei berichten sie u.a. von
der Herausforderung, Aussagen über die Zukunft zu tätigen, von kleinen und großen
prognostischen Erfolgen und von den Problemen, die Politikberatung mit sich
bringen kann.
Excerpt
Table Of Contents
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Danksagung
- Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Im Maschinenraum der Wirtschaftsprognostik: Einleitung
- 1. Die ökonomische Perspektive
- 1.1. Die Bedeutung von Konjunkturprognosen
- 1.2. Die Qualität von Konjunkturprognosen
- 1.3. Ursachen von Prognosefehlern
- 1.4. Das Zusammenwirken von Prognostikern und der Einfluss der Politik
- 2. Die soziologische Perspektive
- 2.1. Wissenschaftliches Wissen über die wirtschaftliche Zukunft
- 2.2. Die Konkurrenz um die Zukunft
- 3. Methodik
- 4. Ausblick
- 5. Editorische Notizen
- Prof. Dr. Enno Langfeldt
- Prof. Dr. Joachim Scheide
- Dr. Eckhardt Wohlers
- Prof. Dr. Heiner Flassbeck
- Prof. Dr. Gustav Horn
- Karin Müller-Krumholz
- Dr. Dieter Vesper
- Dr. Rudolf Zwiener
- Prof. Dr. Udo Ludwig
- Prof. Dr. Ullrich Heilemann
- Gerhard Ziebarth
Abkürzungsverzeichnis
|
ARD |
Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland |
|
BIP |
Bruttoinlandsprodukt |
|
BIZ |
Bank für Internationalen Zahlungsausgleich/Bank for International Settlements; 1930 gegründet, mit Sitz in Basel |
|
CERN |
Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire/Europäische Organisation für Kernforschung. |
|
CIA |
Central Intelligence Agency, der Auslandsgeheimdienst der Vereinigten Staaten von Amerika |
|
DAX |
Der Deutsche Aktienindex ist der wichtigste deutsche Aktienindex. Er misst die Wertentwicklung der größten Unternehmen des deutschen Aktienmarktes. |
|
DDR |
Deutsche Demokratische Republik |
|
DIHK |
Deutsche Industrie- und Handelskammer |
|
DIW |
Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung |
|
ECB |
European Central Bank/Europäische Zentralbank |
|
EDV |
Elektronische Datenverarbeitung |
|
ESMA |
European Securities and Markets Authority/Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde |
|
ESVG |
Europäisches System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen/European System of Accounts |
|
EUROFRAME |
European Forecasting Research Association for the Macro-Economy |
|
EWS |
Das Europäische Währungssystem war eine Form der währungspolitischen Zusammenarbeit zwischen den Ländern der Europäischen Gemeinschaft, die von 1979 bis 1998 Bestand hatte. |
|
EZB |
Europäische Zentralbank/European Central Bank |
|
FAZ |
Frankfurter Allgemeine Zeitung |
|
FED |
Federal Reserve System, das Zentralbanksystem der Vereinigten Staaten von Amerika |
|
FH |
Fachhochschule |
|
FU Berlin |
Freie Universität Berlin |
|
Gemeinschaftsdiagnose. Eine Konjunkturanalyse und -prognose, die von der Bundesregierung beauftragt und von führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstituten jeweils im Frühjahr und im Herbst eines Jahres gemeinschaftlich erstellt wird. | |
|
HWWA |
Hamburgische Welt-Wirtschafts-Archiv. Das HWWA war ein deutsches Wirtschaftsforschungsinstitut, das 2007 aufgelöst und teilweise in das Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft (ZBW) integriert wurde. Ein anderer Teil wurde in das 2005 gegründete Hamburgische WeltWirtschaftsInstitut (HWWI) überführt. |
|
HWWI |
Hamburgisches WeltWirtschaftsInstitut |
|
ifo |
Das ifo-Institut wurde 1949 als Informations- und Forschungsstelle für Wirtschaftsbeobachtung gegründet, heute ist es das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Ludwig-Maximilians-Universität München. |
|
IFW |
Institut für Weltwirtschaft an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel |
|
IHK |
Industrie- und Handelskammer |
|
IMF |
International Monetary Fund/Internationaler Währungsfonds |
|
IMFS |
Institute for Monetary and Financial Stability an der Goethe-Universität Frankfurt am Main |
|
IMK |
Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung, Düsseldorf |
|
IWH |
Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (Saale) |
|
IWF |
Internationaler Währungsfonds/auch bekannt als Weltwährungsfonds/International Monetary Fund |
|
MIT |
Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, USA |
|
NIESR |
National Institute of Economic and Social Research, London, Großbritannien |
|
NBER |
National Bureau of Economic Research, Cambridge, USA |
|
OECD |
Organisation for Economic Co-operation and Development/Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung |
|
RWI |
Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung (vormals Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung), Essen |
|
SNA |
System on National Accounts, internationale Norm zur Erstellung der nationalen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen |
|
USA |
United States of America/Vereinigte Staaten von Amerika |
|
Verein für Socialpolitik, Berlin | |
|
VGR |
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung |
|
VW |
Volkswagen, eine deutsche Automobilmarke |
|
VWL |
Volkswirtschaftslehre |
|
ZDF |
Zweites Deutsches Fernsehen (Anstalt des öffentlichen Rechts) |
|
ZEW |
Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung, Mannheim |
Im Maschinenraum der Wirtschaftsprognostik: Einleitung
Konjunkturprognosen1 gehören wohl zu den in der Öffentlichkeit am stärksten beachteten Ergebnissen der ökonomischen Forschung und Beratung. Diese Aufmerksamkeit ist oft sogar zum Leidwesen von Ökonomen, die andere Teile ihrer Wissenschaft nicht genügend beachtet finden, oder auch den mitunter reichlich vorhandenen Spott über die Genauigkeit der Vorhersagen als nachteilig für die Reputation ihrer Zunft empfinden (Heilemann et al., 2009). Umgekehrt wird die auch durch die Prognosen erzielte Beachtung der Wirtschaftswissenschaften durch andere Disziplinen oft skeptisch bis zuweilen geradezu neidvoll betrachtet (Fourcade et al., 2015).
Zwar füllen wissenschaftliche und andere Publikationen über dieses Thema bereits ganze Bibliotheken, trotzdem gibt es Gründe, sich in diesem Band mit Wirtschaftsprognosen und ihrer Erstellung noch einmal aus veränderter Perspektive zu beschäftigen. Zum ersten ist dieses Buch durch eine interdisziplinäre Zusammenarbeit entstanden: Es gibt – je nach wissenschaftlicher Disziplin – unterschiedliche Sichtweisen auf das Phänomen Konjunkturprognosen. Diese werden in den einzelnen Abschnitten dieser Einleitung ausführlicher beschrieben. Zum zweiten erschien es den Herausgebern sinnvoll, nicht immer nur über Prognosen und PrognostikerInnen zu reden, sondern auch mit ihnen: Stellt sich die Rolle von Prognosen aus der Sicht derjenigen, die sie machen, anders dar, als aus der Sicht derjenigen, die sie nutzen? Drittens spiegelt sich natürlich auch das persönliche Interesse der Herausgeber: Zwei von ihnen waren eine Zeitlang selbst Konjunkturprognostiker, der Dritte im Bunde hat einen nicht geringen Teil seiner wissenschaftlichen Arbeit eben diesen als Forschungsobjekt gewidmet.←13 | 14→
Wir haben uns in den Interviews an nicht mehr in der Wirtschaftsprognostik unmittelbar aktive Personen gewandt, die aber über lange Zeit in ihren Institutionen die Vorhersagen (mit-) verantworteten. Zum einen versprachen wir uns von dieser Auswahl eine eher längerfristige Perspektive, die es beispielsweise erlaubt, die Finanzmarktkrise und die darauffolgende starke Rezession mit den Erfahrungen früherer Krisen zu vergleichen. Zum anderen kann von diesem Personenkreis wohl auch eine freimütigere Stellungnahme zu den Rahmenbedingungen der Prognose, etwa zu den oft vermuteten politischen Einflüssen, erhofft werden.
Bei der Auswahl der InterviewpartnerInnen haben wir uns grob von der Überlegung leiten lassen, eine Reihe von unterschiedlichen Aspekten des Prognosegeschäfts widerzuspiegeln. So sollten VertreterInnen alternativer Denkschulen (etwa „Keynesianer“ oder „Monetaristen“) zu Wort kommen. Zudem sollten einflussreiche Institutionen der Prognostik, also beispielsweise wichtige Wirtschaftsforschungsinstitute oder die Bundesbank, vertreten sein. Um einen Einblick in den Produktionsprozess der Vorhersagen zu gewährleisten war es hilfreich, mit Menschen zu sprechen, die an verschiedenen Positionen in der Hierarchie ihrer jeweiligen Institution gewirkt haben. Auch sollten alternative methodische Herangehensweisen wie ökonometrisch-statistische Modelle oder eher theoriegestützte Ansätze ebenso berücksichtigt werden, wie differierende inhaltliche Schwerpunkte (etwa Geldpolitik, Finanzpolitik oder Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen).
Die Interviews sind für diesen Band redigiert worden (Details zum editorischen Vorgehen finden sich in Abschnitt 5). Wer sich einen persönlichen Eindruck von den Interviews in filmischer Form verschaffen möchte, kann dies auf der Seite
Details
- Pages
- 378
- Publication Year
- 2022
- ISBN (PDF)
- 9783631866887
- ISBN (ePUB)
- 9783631866894
- ISBN (Hardcover)
- 9783631865019
- DOI
- 10.3726/b19012
- Language
- German
- Publication date
- 2022 (June)
- Published
- Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 2022. 378 S., 11 s/w Abb.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG