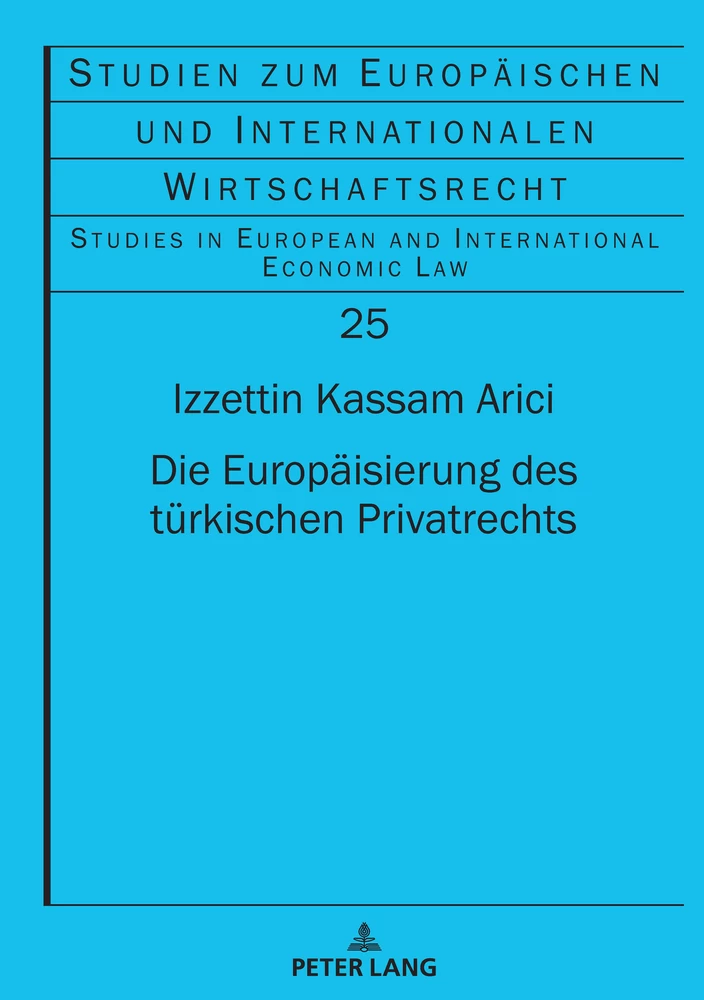Die Europäisierung des türkischen Privatrechts
Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Vorwort
- Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- 1. Kapitel: Einleitung
- A. Gegenstand der Untersuchung
- B. Gang der Untersuchung
- 2. Kapitel: Grundlagen
- A. Übernahme rechtlichen Gedankenguts
- I. Rechtsrezeption – Rechtsvereinheitlichung – Rechtsangleichung
- II. Autonomer Nachvollzug
- B. Einflüsse europäischen Rechts in der Türkei
- I. Entstehung der modernen türkischen Rechtsordnung
- 1. Epoche des Osmanischen Reichs
- a) Rechtssystem bis zur Zeit des Tanzimat
- aa) Das islamische Recht
- (1) Primäre Quellen und Methoden der Ableitung von Normen
- (2) Sekundäre Quellen und Methoden
- (3) Umfasste Bereiche
- (4) Anwendung im Osmanischen Reich
- bb) Erlasse des Sultans
- cc) Religionsrechtliche Bestimmungen der anerkannten Religionsgemeinschaften
- dd) Regionsspezifische Bestimmungen
- ee) Rechtliche Behandlung von Sachverhalten mit Auslandsberührung
- ff) Zusammenfassende Würdigung
- b) Reformen ab der Zeit des Tanzimat
- aa) Ursprünge der Tanzimat-Ära
- bb) Grundlagen der Tanzimat-Ära
- (1) Das Edikt von Gülhane
- (a) Inhalt
- (b) Würdigung
- (2) Das Reformedikt von 1856
- (a) Entstehung
- (b) Inhalt
- (c) Würdigung
- cc) Maßnahmen ab der Zeit des Tanzimat
- (1) Strafrecht
- (a) Kodifizierungen
- (b) Zuständige Gerichte
- (2) Handelsrecht
- (3) Bodenrecht
- (4) Allgemeines Zivilrecht
- (a) Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyye
- (b) Hukûk-ı Âile Kararnâmesi
- dd) Würdigung der Maßnahmen
- 2. Epoche der Republik Türkei
- a) Der Türkische Befreiungskrieg und die Friedenskonferenz von Lausanne
- aa) Reziprozität von Verhandlungsverlauf und Reformarbeiten
- bb) Analyse des Vorgehens der türkischen Seite
- b) Die Totalrezeption des schweizerischen ZGB
- aa) Motive der Rezeption
- bb) Modifikationen im Zuge des Gesetzgebungsverfahrens
- (1) Willentliche Modifikationen
- (a) Strukturell bedingte Modifikationen
- (b) Finanziell bedingte Modifikationen
- (c) Kontextuell bedingte Modifikationen
- (d) Traditionell bedingte Modifikationen
- (e) Intentionell bedingte Modifikationen
- (f) Nicht zuordenbare Modifikationen
- (2) Unwillentliche Modifikationen
- (3) Würdigung
- cc) Modifikationen im Zuge der Anwendung
- dd) Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Rezeption
- (1) Sprache, Sprachreform und Sprachlosigkeit
- (2) Imam-Ehe und Polygamie
- (3) Außergrundbuchliche Übertragung von Grundstücken
- (4) „Totes“ Recht
- II. Änderungen, Reformen und Reformversuche
- 1. Phase bis 1994
- a) Entwurf von 1971
- b) Entwurf von 1984
- c) Teilrevisionen
- aa) Teilrevision von 1988
- bb) Teilrevision von 1990
- 2. Phase ab 1994
- a) Das neue ZGB von 2001
- b) Das neue OR von 2011
- aa) Allgemeine Bestimmungen
- bb) Besondere Schuldverhältnisse
- (1) Kaufrecht
- (a) Neuerungen und Änderungen
- (b) Einordnung im Licht der jüngeren europäischen Rechtsentwicklung
- (c) Verhältnis zum Handelsgesetzbuch
- (2) Mietrecht
- (3) Dienstvertragsrecht
- (4) Bürgschaftsrecht
- (5) Die einfache Gesellschaft
- cc) Würdigung
- c) Das neue HGB von 2011
- d) Sonstige Reformen
- III. Islamisches Roll-back durch Gesetzgeber und Rechtsprechung?
- 1. Das Primat der Ziviltrauung und die standesamtlichen Befugnisse der Muftis
- 2. Nachträgliche Ziviltrauung als Strafaufhebungsgrund bei sexuellem Missbrauch von Kindern
- 3. Vergleichender Blick auf die Rechtsentwicklungen in Japan und in Äthiopien
- IV. Zusammenfassende Würdigung
- C. Beziehungen der Türkei zur EU
- I. Formen der Zugehörigkeit
- 1. Vollmitgliedschaft
- a) Beitrittskriterien
- aa) Europäischer Staat
- bb) Achtung und Förderung der in Art. 2 EUV genannten Werte
- cc) Kopenhagener Kriterien
- b) Ablauf des Verfahrens
- c) Justiziabilität
- d) Rechtsfolge des Beitritts
- 2. Assoziierung
- a) Freihandelsassoziierung
- aa) Europäischer Wirtschaftsraum
- bb) Sektorielle Verträge mit der Schweiz
- b) Beitrittsassoziierung
- aa) Generelle Charakteristika
- bb) Assoziationsabkommen mit der Türkei von 1963
- c) Entwicklungsassoziierung
- 3. Alternative Integrationsmodelle
- a) Privilegierte Partnerschaft
- b) Erweiterte assoziierte Mitgliedschaft
- c) Differenzierte Integration
- II. Auswertung der Zugehörigkeitsformen im Hinblick auf die Übernahme von EU-Recht durch die Drittstaaten
- III. Entwicklung und Stand der Türkei-EU-Beziehungen
- 1. Auf dem Weg zur Zollunion
- 2. Auf dem Weg zur Vollmitgliedschaft?
- 3. Türkei-EU-Beziehungen: Quo vadis?
- 3. Kapitel: Autonomer Nachvollzug von Richtlinien zum Verbrauchervertragsrecht in der Türkei
- A. Historische Entwicklung des Verbraucherschutzrechts in der Türkei
- I. Epoche des Osmanischen Reiches
- II. Epoche der Republik Türkei
- B. Normativer Nachvollzug
- I. Gesetz Nr. 4077
- 1. Entstehungsgeschichte und Motive
- 2. Struktur und Inhalt des Gesetzes
- 3. Anwendungsbereich
- a) Persönlicher Anwendungsbereich
- aa) Verbraucher
- bb) Verkäufer
- b) Sachlicher Anwendungsbereich
- 4. Verhältnis zu anderen Vorschriften der türkischen Rechtsordnung
- 5. Nachvollzug der Richtlinie 85/577/EWG
- a) Anwendungsbereich
- b) Informationspflichten
- c) Widerrufsrecht
- d) Rechtsfolgen des Widerrufs
- e) Sonstige Bestimmungen
- f) Zusammenfassende Würdigung
- 6. Nachvollzug der Richtlinie 87/102/EWG
- a) Anwendungsbereich
- b) Informationspflichten
- c) Vorzeitige Erfüllung
- d) Erhalt von Einwendungen
- e) Rücknahme der Kaufsache und Wechselbegebung
- f) Einwendungsdurchgriff
- g) Gewerberechtliche Regelungen
- h) Zusammenfassende Würdigung
- 7. Analyse der Maßnahmen
- II. Änderungen und Ergänzungen mit der Gesetzesnovelle Nr. 4822
- 1. Entstehungsgeschichte und Motive
- 2. Inhalt und Struktur des Gesetzes
- 3. Anwendungsbereich
- a) Persönlicher Anwendungsbereich
- aa) Verbraucher
- bb) Verkäufer und Anbieter
- b) Sachlicher Anwendungsbereich
- 4. Änderungen am bisherigen Nachvollzug durch die Gesetzesnovelle
- a) Änderungen am Nachvollzug der Richtlinie 85/577/EWG
- aa) Anwendungsbereich
- bb) Informationspflichten
- cc) Widerrufsrecht
- dd) Rechtsfolgen des Widerrufs
- ee) Zusammenfassende Würdigung
- b) Änderungen am Nachvollzug der Richtlinie 87/102/EWG
- aa) Anwendungsbereich
- bb) Informationspflichten
- cc) Vorzeitige Erfüllung
- dd) Wechselbegebung
- ee) Einwendungsdurchgriff
- ff) Zusammenfassende Würdigung
- 5. Nachvollzug weiterer Richtlinien durch die Gesetzesnovelle
- a) Nachvollzug der Richtlinie 90/314/EWG
- aa) Anwendungsbereich
- bb) Informationspflichten
- cc) Einsetzungsbefugnis
- dd) Änderungsvorbehalt
- ee) Rücktritt durch den Vertragspartner des Verbrauchers
- ff) Nichterfüllung und Schlechtleistung
- gg) Sonstiges
- hh) Zusammenfassende Würdigung
- b) Nachvollzug der Richtlinie 93/13/EWG
- aa) Anwendungsbereich
- bb) Transparenzgebot und Auslegung in Zweifelsfällen
- cc) Missbrauchskontrolle
- dd) Sonstiges
- ee) Zusammenfassende Würdigung
- c) Nachvollzug der Richtlinie 94/47/EG
- aa) Anwendungsbereich
- bb) Informationspflichten
- cc) Vertragsmodalitäten
- dd) Widerrufsrecht
- ee) Rechtsfolgen des Widerrufs
- ff) Verbundene Verträge
- gg) Sonstiges
- hh) Zusammenfassende Würdigung
- d) Nachvollzug der Richtlinie 97/7/EG
- aa) Anwendungsbereich
- bb) Informationspflichten
- cc) Vertragsmodalitäten
- dd) Widerrufsrecht
- ee) Rechtsfolgen des Widerrufs
- ff) Lauterkeitsrechtliche Regelungen
- gg) Verbundene Verträge
- hh) Zahlung mittels Karte
- ii) Zusammenfassende Würdigung
- e) Nachvollzug der Richtlinie 1999/44/EG
- aa) Anwendungsbereich
- bb) Vertragsmäßigkeit
- cc) Rechtsbehelfe des Verbrauchers
- dd) Fristen und Verjährung
- ee) Beweislastumkehr
- ff) Rückgriffsrechte
- gg) Garantie
- hh) Sonstiges
- ii) Zusammenfassende Würdigung
- 6. Analyse der Maßnahmen
- III. Gesetz Nr. 6502
- 1. Entstehungsgeschichte und Motive
- 2. Struktur und Inhalt des Gesetzes
- 3. Anwendungsbereich
- a) Persönlicher Anwendungsbereich
- aa) Verbraucher
- bb) Verkäufer, Anbieter und Unternehmer
- b) Sachlicher Anwendungsbereich
- 4. Änderungen am bisherigen Nachvollzug
- a) Änderungen am Nachvollzug der Richtlinie 90/314/EWG
- aa) Anwendungsbereich
- bb) Informationspflichten
- cc) Einsetzungsbefugnis
- dd) Änderungsvorbehalt
- ee) Rücktritt
- ff) Nichterfüllung und Schlechtleistung
- gg) Sonstiges
- hh) Zusammenfassende Würdigung
- b) Änderungen am Nachvollzug der Richtlinie 93/13/EWG
- aa) Anwendungsbereich
- bb) Transparenzgebot und Auslegung
- cc) Missbrauchskontrolle
- dd) Sonstiges
- ee) Zusammenfassende Würdigung
- c) Änderungen am Nachvollzug der Richtlinie 1999/44/EG
- aa) Anwendungsbereich
- bb) Vertragsmäßigkeit
- cc) Rechtsbehelfe des Verbrauchers
- dd) Fristen und Verjährung
- ee) Beweislastumkehr
- ff) Rückgriffsrechte
- gg) Garantie
- hh) Sonstiges
- ii) Zusammenfassende Würdigung
- 5. Nachvollzug weiterer Richtlinien
- a) Nachvollzug der Richtlinie 2008/48/EG
- aa) Anwendungsbereich
- bb) Informationspflichten
- (1) Standardinformationen in der Werbung
- (2) Vorvertragliche Informationspflichten
- (3) Vertragliche Informationspflichten
- (4) Sonstige Informationspflichten
- cc) Vorvertragliche Pflichten
- dd) Kündigung
- ee) Widerrufsrecht
- ff) Vorzeitige Erfüllung
- gg) Erhalt von Einwendungen
- hh) Einwendungsdurchgriff
- ii) Sonstiges
- jj) Zusammenfassende Würdigung
- b) Nachvollzug der Richtlinie 2008/122/EG
- aa) Anwendungsbereich
- bb) Informationspflichten
- cc) Vertragsmodalitäten
- dd) Widerrufsrecht
- ee) Rechtsfolgen des Widerrufs
- ff) Akzessorische Verträge
- gg) Sonstiges
- hh) Zusammenfassende Würdigung
- c) Nachvollzug der Richtlinie 2011/83/EU und der Richtlinie 2002/65/EG
- aa) Anwendungsbereich
- (1) Richtlinie 2011/83/EU
- (a) AußerGeschRaumVertr
- (b) Fernabsatzverträge
- (2) Richtlinie 2002/65/EG
- bb) Informationspflichten
- (1) Richtlinie 2011/83/EU
- (a) Verbraucherverträge im Allgemeinen
- (b) AußerGeschRaumVertr
- (c) Fernabsatzvertrag
- (d) Gemeinsamkeiten und Unterschiede
- (2) Richtlinie 2002/65/EG
- cc) Vertragsabschluss und Bestätigungspflichten
- (1) Richtlinie 2011/83/EU
- (a) AußerGeschRaumVertr
- (b) Fernabsatzverträge
- (2) Richtlinie 2002/65/EG
- dd) Vertragsmodalitäten
- (1) Richtlinie 2011/83/EU
- (2) Richtlinie 2002/65/EG
- ee) Widerrufsrecht
- (1) Richtlinie 2011/83/EU
- (a) AußerGeschRaumVertr
- (b) Fernabsatzverträge
- (c) Gemeinsamkeiten und Unterschiede
- (2) Richtlinie 2002/65/EG
- ff) Rechtsfolgen des Widerrufs
- (1) Richtlinie 2011/83/EU
- (a) AußerGeschRaumVertr
- (b) Fernabsatzverträge
- (c) Gemeinsamkeiten und Unterschiede
- (2) Richtlinie 2002/65/EG
- gg) Akzessorische Verträge
- (1) Richtlinie 2011/83/EU
- (2) Richtlinie 2002/65/EG
- hh) Sonstiges
- (1) Richtlinie 2011/83/EU
- (a) AußerGeschRaumVertr
- (b) Fernabsatzverträge
- (c) Verbraucherkaufverträge und Verbraucherverträge im Allgemeinen
- (2) Richtlinie 2002/65/EG
- ii) Zusammenfassende Würdigung
- 6. Analyse der Maßnahmen
- C. Prozeduraler Nachvollzug
- I. Gesetz Nr. 4077
- 1. Verbraucherschiedsausschüsse
- 2. Verbrauchergerichte
- II. Änderungen und Ergänzungen mit der Gesetzesnovelle Nr. 4822
- 1. Verbraucherschiedsausschüsse
- 2. Verbrauchergerichte
- III. Gesetz Nr. 6502
- 1. Verbraucherschiedsausschüsse
- 2. Verbrauchergerichte
- IV. Zusammenfassende Würdigung
- D. Judikativer Nachvollzug
- E. Zusammenfassende Würdigung
- 4. Kapitel: Schlusszusammenfassung
- A. Übernahme rechtlichen Gedankenguts
- B. Rezeptionen im Osmanischen Reich
- C. Rezeptionen in der Frühphase der Republik Türkei
- D. Autonomer Nachvollzug von Richtlinien zum Verbrauchervertragsrecht
- Literaturverzeichnis
- Onlinequellen
- Reihenübersicht
Abkürzungsverzeichnis
a.a.O. |
am angegebenen Ort |
AA |
Ankara-Abkommen |
ABD |
Ankara Barosu Dergisi |
ABGB |
Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch |
ABl. |
Amtsblatt |
Abs. |
Absatz |
ADFI |
Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul |
AEUV |
Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union |
AGB |
Allgemeine Geschäftsbedingungen |
AGBG |
Gesetz zur Regelung des Rechts der Allgemeinen Geschäftsbedingungen |
AJP |
Aktuelle Juristische Praxis |
AKP |
Adalet ve Kalkınma Partisi |
Anm. |
Anmerkung |
ApuZ |
Aus Politik und Zeitgeschichte |
AS |
Amtliche Sammlung des Bundesrechts |
ATAMD |
Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi |
Aufl. |
Auflage |
AußerGeschRaumVertr |
außerhalb von Geschäftsräumen abgeschlossener Vertrag |
AÜEHFD |
Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi |
AÜHFD |
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi |
AÜİFD |
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi |
AÜSBFD |
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi |
BATİDER |
Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi |
BBl |
Bundesblatt |
BG |
Bundesgericht |
BGB |
Bürgerliches Gesetzbuch |
BGE |
Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts |
BGE |
Bundesgerichtsentscheidungen |
bspw. |
beispielsweise |
ca. |
|
CCV |
Internationales Übereinkommen über den Reisevertrag |
CESL |
Common European Sales Law |
CISG |
United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods |
ÇATY |
Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı |
DCFR |
Draft Common Frame of Reference |
ders. |
derselbe |
DEÜHFD |
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi |
dies. |
dieselbe |
DM |
Deutsche Mark |
DÜHFD |
Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi |
EAD |
Ekev Akademi Dergisi |
EMB |
Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte vom 26. August 1789 |
ECU |
European currency unit |
EFTA |
Europäische Freihandelsassoziation |
EGV |
Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft |
EJPD |
Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement |
EL |
Ergänzungslieferung |
EMRK |
Europäische Menschenrechtskonvention |
etc. |
et cetera |
EU |
Europäische Union |
EuR |
Europarecht (Zeitschrift) |
EUV |
Vertrag über die Europäische Union |
EWG |
Europäische Wirtschaftsgemeinschaft |
EWGV |
Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft |
EWR |
Europäischer Wirtschaftsraum |
f. |
folgende |
FernAbsFinDL-RL |
Richtlinie 2002/65/EG über den Fernabsatz von Finanzdienstleistungen |
FernAbsVertr |
Fernabsatzvertrag |
FEUTURE |
The Future of EU-Turkey Relations (Projekt) |
ff. |
fortfolgende |
Fn. |
Fußnote |
forost |
Forschungsverbund Ost- und Südosteuropa |
FS |
Festschrift |
FZA |
Freizügigkeitsabkommen |
GEK |
Gemeinsames Europäisches Kaufrecht |
gem. |
|
gest. |
gestorben |
GmbH |
Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
GPR |
Zeitschrift für das Privatrecht der Europäischen Union |
GÜHFD |
Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi |
HGB |
Handelsgesetzbuch |
HPD |
Hukuki Perspektifler Dergisi |
HS |
Halbsatz |
HSFK |
Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung |
İBD |
İstanbul Barosu Dergisi |
İKV |
İktisadi Kalkınma Vakfı |
İTO |
İstanbul Ticaret Odası |
İÜHFD |
İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi |
İÜHFM |
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası |
JURA |
Juristische Ausbildung |
KED |
Kastamonu Eğitim Dergisi |
LeGes |
LeGes – Gesetzgebung & Evaluation |
m.w.N. |
mit weiteren Nachweisen |
Mecelle |
Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyye |
Mio. |
Million |
MOEL |
mittel- und osteuropäische Länder |
Mrd. |
Milliarde |
N. |
Nummer |
n. Chr. |
nach Christus |
NATO |
North Atlantic Treaty Organization |
NEÜİFD |
Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi |
NVwZ |
Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht |
OR |
Obligationenrecht |
PECL |
Principles of European Contract Law |
PETL |
Principles of European Tort Law |
PICC |
Principles of International Commercial Contracts |
RabelsZ |
Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht/ Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht |
RL |
Richtlinie |
Rn. |
Randnummer |
S. |
Seite |
sic |
sīc erat scriptum |
SJZ |
Schweizerische Juristen-Zeitung |
SKAD |
|
sog. |
sogenannt |
StAZ |
Das Standesamt |
str. |
strittig |
SÜHFD |
Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi |
SÜTAD |
Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi |
SWP |
Stiftung Wissenschaft und Politik |
TBBD |
Türkiye Barolar Birliği Dergisi |
TDA |
Türk Dünyası Araştırmaları |
TOBB |
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği |
TSE |
Türk Standardları Enstitüsü |
türk. |
türkisch |
usw. |
und so weiter |
ÜGA |
Abkommen zwischen den EFTA-Staaten zur Errichtung einer Überwachungsbehörde und eines Gerichtshofes |
VerbrRRL |
Verbraucherrechterichtlinie |
vgl. |
vergleiche |
wörtl. |
wörtlich |
Yasa HD |
Yasa Hukuk İçtihat ve Mevzuat Dergisi |
ZEuP |
Zeitschrift für Europäisches Privatrecht |
ZGB |
Zivilgesetzbuch |
ZHK |
Zeitschrift für das Gesamte Handelsrecht und Konkursrecht |
zit. |
zitiert |
ZSR |
Zeitschrift für Schweizerisches Recht |
ZVglRWiss |
Zeitschrift für Vergleichende Rechtswissenschaft |
1. Kapitel: Einleitung
A. Gegenstand der Untersuchung
Gegen Ende der 1990er Jahre kamen innerhalb der deutschen Literatur Publikationen zu einer Thematik auf, die den zivilrechtlichen Diskurs der darauffolgenden Jahre wesentlich prägen sollte und schon jetzt als eine der tiefgreifendsten Entwicklungen der jüngeren Rechtsgeschichte Europas bezeichnet werden kann: die Europäisierung des Privatrechts.1
Gemeint ist hiermit die „[…] Einflussnahme des Gemeinschaftsrechts auf die nationalen Privatrechte“,2 die zu einer allmählich voranschreitenden Angleichung und Vereinheitlichung des Privatrechts der Mitgliedstaaten geführt hat.
Wesentlich älter ist die Diskussion über eine Europäisierung des Privatrechts dagegen in der Türkei: Sie reicht dort bis in die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts zurück und ist Teil einer im Grunde bis heute andauernden Kontroverse über die allgemeine politische Ausrichtung des Landes. Unbeschadet der geografischen Verortung der heutigen Republik Türkei war die ursprüngliche Rechtsordnung ihres Vorgängerstaates – des Osmanischen Reiches – nicht europäischer Herkunft (siehe dazu S. 36 ff.). Vor diesem Hintergrund bezieht sich der Begriff der Europäisierung im Kontext des türkischen Rechts auf die Übernahme rechtlichen Gedankenguts aus Europa, das heißt auf die Übernahme rechtlichen Gedankenguts europäischer Herkunft. Trotz der zahlreichen politischen und gesellschaftlichen Umwälzungen bildet diese Übernahme rechtlichen Gedankenguts aus Europa seither eine Kontinuitätslinie der türkischen Rechtsgeschichte: beginnend mit den ersten Rezeptionsversuchen im Osmanischen Reich über die weitbekannten Totalrezeptionen der frühen türkischen Republik bis hin zum autonomen Nachvollzug europäischer Richtlinien im Zuge des Beitrittsprozesses zur EU. Die europäischen Rechtsordnungen bilden seit nunmehr fast zwei Jahrhunderten den Orientierungspunkt der türkischen Rechtsentwicklung.
Was treibt diesen kontinuierlichen Prozess der Europäisierung an? Wie wird bei der Übernahme europäischen Gedankenguts verfahren? Welche Schwierigkeiten stellen sich dabei und wie wird diesen begegnet? Welche Implikationen ←25 | 26→ergeben sich für die Rechtsordnung im Übrigen? Und nicht zuletzt: Was ist der letzte Stand dieser Entwicklung?
Eine ganzheitliche Analyse der Europäisierung des türkischen Privatrechts findet sich innerhalb der deutschsprachigen Literatur nicht. Es existieren lediglich Publikationen zu Teilaspekten wie den Rezeptionen in der Frühphase der Republik,3 den späteren Reformen4 oder dem autonomen Nachvollzug.5 Vor diesem Hintergrund will die vorliegende Arbeit den oben aufgeworfenen Fragen im Rahmen einer ganzheitlichen Analyse des Kernbereichs des türkischen ←26 | 27→Zivilrechts nachgehen. Besonderes Augenmerk soll dabei auf den seit 1995 zu beobachtenden autonomen Nachvollzug europäischer Richtlinien im Bereich des Verbrauchervertragsrechts gerichtet werden. Dies findet seine Begründung zum einen darin, dass das Verbraucherschutzrecht ein relativ junger Rechtsbereich ist, der in Europa maßgeblich durch die EU vorangetrieben wurde und – losgelöst von spezialrechtlichen Bereichen des Privatrechts – die Entwicklung des europäischen Privatrechts in seinem bürgerlich-rechtlichen Kernbereich in den letzten Jahren stark beeinflusst hat. Zum anderen findet dies seine Begründung darin, dass die Implementierung dieser nicht-technischen verbrauchervertragsrechtlichen Regelungen häufig eine große Herausforderung für die betroffenen Rechtsordnungen darstellt, da diese Regelungen unmittelbaren Einfluss auf das nationale Vertragsrecht haben. Ihre Implementierung dient daher in besonderem Maße als Gradmesser für den Umsetzungsstand und die Umsetzungsfähigkeit einer Rechtsordnung in Bezug auf den acquis communautaire. Schließlich weist der Bereich des Verbrauchervertragsrechts eine besonders hohe Praxisrelevanz auf.
Neben den vorstehend genannten Zielen soll die vorliegende Arbeit als Rechtstransplantationsanalyse von Kernbereichen des türkischen Zivilrechts zugleich einen Beitrag zu einem besseren Verständnis des gegenwärtigen türkischen Rechts leisten.
B. Gang der Untersuchung
Nach einer kurzen Einordnung geläufiger Begrifflichkeiten und der Erläuterung und Abgrenzung des Begriffs des „autonomen Nachvollzugs“ soll sich die Untersuchung in einem ersten Schwerpunkt den generellen Einflüssen europäischen Rechts in der Türkei widmen. Hierzu ist zunächst die Entstehung der modernen türkischen Rechtsordnung nachzuzeichnen. Unerlässlich zum Verständnis dieser Entwicklung ist die Epoche des Osmanischen Reiches, dessen Rechtssystem im Folgenden deshalb genauer zu betrachten ist. Die Betrachtung soll dabei in einem ersten Schritt das Rechtssystem des Osmanischen Reiches bis zum Beginn der Tanzimat-Ära darstellen, um in einem zweiten Schritt die Wandlungen, die dieses Rechtssystem innerhalb der Reformperiode des Tanzimat erfahren hat, deutlicher herausstellen zu können.
Danach sollen die Phase des Übergangs zur Epoche der türkischen Republik und die Implikationen, die sich daraus für die türkische Rechtsordnung ergaben, genauer betrachtet werden. Anhand dieser Betrachtungen sollen sodann die Faktoren herausgearbeitet werden, die letztlich zu einer Totalrezeption europäischer Kodifikationen, allen voran des schweizerischen ZGB, geführt haben. ←27 | 28→Modalitäten und Schwierigkeiten dieser Rezeptionen bilden dabei gleichermaßen einen Betrachtungsgegenstand dieses Abschnitts.
Im Anschluss an diese Schilderung der Entstehung der modernen türkischen Rechtsordnung sollen die Änderungen, Reformen und Reformversuche betrachtet werden, die diese Rechtsordnung in den darauffolgenden Jahren erfahren hat. Ihrer unterschiedlichen Intensität entsprechend, sind die gesetzgeberischen Aktivitäten hierbei in eine Phase bis 1994 und eine Phase ab 1994 zu unterteilen. Im Rahmen der Betrachtung der Phase ab 1994 soll neben dem neuen ZGB von 2001 und dem neuen HGB von 2011 insbesondere das neue OR von 2011 genauer in den Blick genommen werden. Die Schlussbetrachtungen dieses Abschnitts sind zudem auch auf die Frage zu richten, ob seit den Totalrezeptionen der Frühphase der Republik ein islamisches Roll-back durch den Gesetzgeber und die Rechtsprechung zu verzeichnen ist.
Nach dieser umfassenden Analyse der generellen Einflüsse europäischen Rechts in der Türkei sollen die Beziehungen zwischen der Türkei und der EU näher betrachtet werden. In einem ersten Schritt sind hierzu zunächst die unterschiedlichen Formen der Zugehörigkeit zur EU darzustellen. Besonderes Augenmerk ist dabei auf die Beitrittsassoziierung zu richten, die am Beispiel des Ankara-Abkommens von 1963 zu konkretisieren ist. Den zweiten Schritt hat sodann die Betrachtung der Entwicklung und des gegenwärtigen Stands der Türkei-EU-Beziehungen zu bilden.
Im Anschluss hieran soll die eigentliche Untersuchung des autonomen Nachvollzugs von Richtlinien zum Verbrauchervertragsrecht in der Türkei erfolgen. Hierbei ist zunächst ein kurzer Überblick über die historische Entwicklung des Verbraucherschutzrechts in der Türkei zu geben, dem sich alsdann die Untersuchung des normativen Nachvollzugs anzuschließen hat. Diese Untersuchung soll in drei Etappen die Entwicklung seit 1995 betrachten und bewerten, beginnend mit dem ersten Verbraucherschutzgesetz Nr. 4077 über die Revision dieses Gesetzes mit dem Gesetz Nr. 4822 bis hin zur Neuregelung durch das Gesetz Nr. 6502.
Die Untersuchung soll indes nicht bei der Betrachtung des normativen Nachvollzugs stehenbleiben, sondern auch den prozeduralen Nachvollzug in den Blick nehmen. Auch insoweit ist der vorangehend beschriebenen Dreiteilung zu folgen. Zudem hat die Untersuchung ihren Blick auf einen etwaigen judikativen Nachvollzug zu richten, um die Untersuchung des autonomen Nachvollzugs anschließend mit einer zusammenfassenden Würdigung abzuschließen.
Die Arbeit soll schließlich mit einer Schlusszusammenfassung enden.
1 Siehe bspw. Gebauer, Grundfragen der Europäisierung des Privatrechts (1998) und Klauer, Die Europäisierung des Privatrechts (1998).
2 Schmidt-Kessel, Europäisches Zivilgesetzbuch, in: Basedow/Hopt/Zimmermann, Handwörterbuch des Europäischen Privatrechts, S. 552.
3 Siehe dazu Bandak, Die Rezeption des schweizerischen Zivilgesetzbuches in der Türkei; Buz, Die Rezeption des Schweizerischen OR in der Türkei, in: Sirmen/Kırca/Buz, Symposium anlässlich des 80. Jahrestages, S. 31 ff.; Hirsch, Das Schweizerische Zivilgesetzbuch in der Türkei, SJZ 1954, 337 ff.; Hirsch, Vom schweizerischen Gesetz zum türkischen Recht, ZSR 95 (1976), Nr. 1, 223 ff.; Krüger, Fragen des Familienrechts: Osmanisch-islamische Tradition versus Zivilgesetzbuch, ZSR 95 (1976), Nr. 1, 287 ff.; Plagemann, Die Einführung des ZGB im Jahre 1926, in: Kieser/Meier/Stoffel, Revolution islamischen Rechts, S. 21 ff.; Pritsch, Das Schweizerische Zivilgesetzbuch in der Türkei, ZVglRWiss 59 (1957), 123 ff.; Velidedeoğlu, Erfahrungen mit dem schweizerischen Zivilgesetzbuch in der Türkei, ZSR 81 (1962), Nr. 1, 51 ff.
4 Siehe dazu Atamer, Rezeption und Weiterentwicklung des schweizerischen Zivilgesetzbuches in der Türkei, RabelsZ 72 (2008), 723 ff.; Gören-Ataysoy, Die Fortbildung rezipierten Rechts, ZSR 95 (1976), Nr. 1, 263 ff.; Hirsch, Die Einflüsse und Wirkungen ausländischen Rechts auf das heutige türkische Recht, ZHK 116 (1953), Nr. 1, 201 ff.; Hirsch, Das neue Türkische Handelsgesetzbuch, ZHR 119 (1956), 157 ff.; Inceoğlu, Das neue türkische Obligationenrecht, in: Werro/Baysal/Heckendorn Urscheler, Einfluss des Europarechts, S. 89 ff.; Krüger, 70 Jahre westliches Schuld- und Handelsrecht in der Türkei, in: Scholler/Tellenbach, Westliches Recht in der Republik Türkei 70 Jahre nach der Gründung, S. 125 ff.; Okur, Eine kritische Untersuchung zu den Rechtsbehelfen des Käufers im alten und im neuen türkischen Warenkaufrecht; Öztan, Türkisches Familienrecht nach 70 Jahren ZGB, in: Scholler/Tellenbach, Westliches Recht in der Republik Türkei 70 Jahre nach der Gründung, S. 85 ff.; Rumpf, Das neue türkische Zivilgesetzbuch, StAZ 2002, 97 ff.
5 Siehe dazu Akdağ-Güney, Umsetzung der Haustürwiderrufsrichtlinie 85/77/EWG in das türkische Recht, GPR 5 (2008), 20 ff.; Akdağ-Güney, Die Umsetzung der Verbraucherschutzrichtlinien in der Türkei am Beispiel der missbräuchlichen Klauseln, ZEuP 2009, 109 ff.; Atamer, Die autonome Umsetzung der Verbrauchsgüterkaufrichtlinie 1999/44/EG in der Türkei, ZEuP 2005, 566 ff.; Atamer/Hopt, Kompatibilität des türkischen und europäischen Wirtschaftsrechts; Akdağ-Güney, Die Umsetzung von Verbraucherschutz-Richtlinien in der Türkei, GPR 3 (2006), 59 ff.; Küçükdağlı, Unterschiedliche Schutzstandards im Recht der Allgemeinen Geschäftsbedingungen; Oguz, Das türkische und das europäische Verbraucherrecht.
2. Kapitel: Grundlagen
A. Übernahme rechtlichen Gedankenguts
Das Phänomen der Übernahme rechtlichen Gedankenguts findet sich in fast all seinen Formen innerhalb der türkischen Rechtsgeschichte. Dies macht es notwendig, zu Beginn einer Untersuchung über die Europäisierung des türkischen Privatrechts, deren Betrachtungsgegenstand wesentliche Phasen ebendieser Rechtsgeschichte bilden, eine Einordnung der verschiedenen Begrifflichkeiten vorzunehmen, die eine Übernahme rechtlichen Gedankenguts beinhalten. Hierbei soll jedoch keine ausgefeilte Typologie dieses Phänomens geliefert werden, da aus einer solchen aufgrund der inhaltlichen Spannweite einiger etablierter Begriffe keine konkreteren Folgerungen gezogen und damit kein bedeutender Mehrwert geschaffen werden könnte.
Vor dem Hintergrund dieses Überblicks soll sodann der Begriff des „autonomen Nachvollzugs“ erläutert und abgegrenzt werden, der als eine weitere Form der Übernahme rechtlichen Gedankenguts den Betrachtungsgegenstand des 3. Kapitels der vorliegenden Arbeit darstellt und begrifflich innerhalb der deutschen Literatur nur in geringem Maße präsent ist.
I. Rechtsrezeption – Rechtsvereinheitlichung – Rechtsangleichung
Die Interaktion verschiedener Rechtsordnungen als Teil der allgemeinen kulturellen Interaktion zwischen verschiedenen Nationen, Regionen und Völkern ist ein sowohl historisch als auch gegenwärtig feststellbares Phänomen.6 Recht ist in seiner Geltung insbesondere seit der Ablösung des Personalitäts- durch das Territorialitätsprinzip zwar grundsätzlich geographisch beschränkt, dass ihm zugrundeliegende rechtliche Gedankengut besteht jedoch unabhängig eines Geltungs- oder Anwendungsbefehls und kann dementsprechend seit alters zirkulieren und auch außerhalb seines ursprünglichen Geltungsbereichs zur Geltung gebracht werden.7
←29 | 30→Viele Vorgänge unterschiedlicher rechtssprachlicher Bezeichnung beinhalten eine Übernahme rechtlichen Gedankenguts. Den bekanntesten unter ihnen dürfte die Rechtsrezeption – häufig auch kurz Rezeption genannt – darstellen.8 Dieser Begriff, der innerhalb der deutschen Rechtssprache weniger als Gattungsbegriff, denn als rechtshistorischer Fachterminus für „[…] die überwiegende Verdrängung des älteren deutschen Privatrechts durch die Herrschaft des justinianischen Rechts in privatrechtlicher Rechtslehre, Gesetzgebung und Rechtsanwendung“ zwischen 1400 und 1550 bekannt ist,9 bezeichnet im Kern die Übernahme einzelner Rechtssätze, -institute oder sogar ganzer Gesetzbücher einer fremden Rechtsordnung durch eine übernehmende Rechtsordnung.10 Häufig finden sich in der Literatur Begriffe, die synonym zu demjenigen der Rezeption gebraucht werden. Ohne eine abschließende Aufzählung bieten zu wollen, können in diesem Zusammenhang die Begriffe Rechtstransplantation (häufig auch in seiner ursprünglichen englischen Form als legal transplant bezeichnet), Rechtstransfer, Rechtsimport und Adaption genannt werden.11
Obgleich seiner ubiquitären Verwendung, ist der Inhalt des Rezeptionsbegriffs in vielerlei Hinsicht umstritten. Unter diesen Streitpunkten dürfte derjenige am wesentlichsten sein, ob der Begriff der Rezeption die Freiwilligkeit der Übernahme voraussetzt.12 Insbesondere in Abgrenzung zur Oktroyierung fremden Rechts im Rahmen einer Kolonisation oder einer Usurpation wird von einigen Autoren die Freiwilligkeit der Übernahme als notwendiges Element des Rezeptionsbegriffs betrachtet.13 Jedoch erscheint das Vorliegen einer solchen Freiwilligkeit selbst in Bezug auf die Übernahme des schweizerischen ZGB durch die türkische Republik, die gemeinhin als eines der herausragendsten Beispiele ←30 | 31→einer Totalrezeption gilt, äußerst fraglich.14 Nichtsdestotrotz ist der Auffassung Wieackers zuzustimmen, dass die Übernahme fremden Rechts infolge einer „[…] Vernichtung oder Überwältigung […] die Identität der rezipierenden Rechtsgemeinschaft selbst zerstören [würde], die als Subjekt, nicht als Objekt des mit dem Worte Rezeption bezeichneten Handelns oder Erleidens vorgestellt ist“15. Es bedarf daher weiterhin eines Kriteriums, um die Rezeption von einer Oktroyierung abzugrenzen. Geeigneter als der mit einer psychologischen Konnotation aufgeladene Begriff der Freiwilligkeit erscheint insoweit der der politischen Theorie entlehnte Begriff der Souveränität. Erst dort, wo eine solche Souveränität nicht mehr besteht, erfolgt die Übernahme fremden Rechts durch Oktroyierung.16 Große Ähnlichkeit mit einer Oktroyierung weist freilich die politisch zwar souveräne, aber faktisch gleichermaßen aufgezwungene Rezeption fremder Rechte durch eine „Erziehungsdiktatur“ auf.17 Zur Kenntlichmachung dieser Nähe könnte in diesen Fällen von einer oktroyierten Rezeption gesprochen werden.18 Die Totalrezeptionen in der Frühphase der türkischen Republik ließen sich durchaus unter einer solchen Begriffskombination einordnen.19
Ebenfalls umstritten ist, ob es sich bei der Rezeption um einen einmaligen Akt oder einen Vorgang handelt.20 Der vorliegenden Arbeit liegt die Auffassung zugrunde, dass es sich bei einer Rezeption um einen „sozialen Prozess“ handelt, ←31 | 32→der sich nicht in der formalen Aufnahme des rechtlichen Gedankenguts in den Normenbestand der rezipierenden Rechtsordnung erschöpft.21 Maßnahmen, die sich auf die formale Aufnahme beschränken, werden in der vorliegenden Arbeit zur Abgrenzung von Rezeptionen im eigentlichen Sinne als „Formalrezeptionen“ bezeichnet.
Zu unterscheiden ist der Begriff der Rechtsrezeption von demjenigen der Rechtsvereinheitlichung. Unter dem Begriff der Rechtsvereinheitlichung ist das Verfahren zur Schaffung identischen Rechts in mind. zwei verschiedenen Rechtsordnungen zu verstehen.22 Dies geschieht allen voran durch die Festlegung internationalen Einheitsrechts in völkerrechtlichen Verträgen, die von den jeweiligen Staaten sodann durch Ratifizierung in Kraft gesetzt werden. Einheitsrecht wird zudem auch durch die Europäische Union geschaffen, indem sie durch Verordnungen in allen Mitgliedstaaten unmittelbar anwendbares Recht schafft.23 Letztere Rechtsvereinheitlichung bleibt dabei natürlich auf das Gebiet der Europäischen Union beschränkt.24
Freilich wird bei der Ausarbeitung einheitlichen Rechts unter Rückgriff auf die Methode der Rechtsvergleichung versucht die geeignetste Lösung für die zu regelnde Materie zu ermitteln.25 Hierbei kann rechtlichem Gedankengut einer bestimmten Rechtsordnung der Vorzug gegenüber einer anderen eingeräumt, eine Synthese aus dem rechtlichen Gedankengut verschiedener Rechtsordnungen gewonnen oder gar eine vollständig neue Regelung in Ansatz gebracht werden. Enthält das geschaffene Einheitsrecht rechtliches Gedankengut einer anderen Rechtsordnung als derjenigen, die das betreffende Einheitsrecht in Kraft setzt, handelt es sich insoweit genau genommen um eine Rezeption. Auch wird durch die klassische Rezeption eines Rechtsinstituts oder eines Gesetzbuches einer anderen Rechtsordnung zumindest rein normativ eine identische Regelung geschaffen. Allerdings fehlt es einer solchen klassischen Rezeption an der obligatorischen „Zielsetzung der Schaffung einheitlichen Rechts“, die die Rechtsvereinheitlichung charakterisiert.26 Die Rechtsrezeption ist daher häufig ←32 | 33→als „Minus“ in der Rechtsvereinheitlichung enthalten. Die Rechtsvereinheitlichung selbst geht aufgrund ihrer Zielsetzung aber begrifflich über die Rezeption hinaus.
Von den Begriffen der Rechtsrezeption und der Rechtsvereinheitlichung wiederum zu unterscheiden ist derjenige der Rechtsangleichung. Wie schon der allgemeine Sprachgebrauch des Begriffs „Angleichung“ nahelegt, handelt es sich hierbei um eine Annäherung des Rechts von mind. zwei verschiedenen Rechtsordnungen, die in ihrer Intensität jedoch unterhalb der Schwelle der Vereinheitlichung verbleibt.27 Letzteres grenzt sie von der Rechtsvereinheitlichung ab.
Eine Rechtsangleichung kann sowohl negativ als auch positiv erfolgen.28 Negativ erfolgt sie durch den Erlass „negativer Ausgestaltungsverbote“, die die Souveränität der Gesetzgeber zur Regulierung bestimmter Materien beschränken.29 Auf europäischer Ebene dienen hierzu die Grundfreiheiten.30 Positiv erfolgt eine Rechtsangleichung dagegen durch die Statuierung „positiver Ausgestaltungsgebote“, die im jeweils bestimmten Maße einen gemeinsamen Normenbestand innerhalb der betroffenen Rechtsordnungen schaffen, wie dies bei Richtlinien der Fall ist.31 Bei der Festlegung des zu schaffenden gemeinsamen Normenbestands greift die erlassende Institution wie auch im Rahmen der Schaffung von Einheitsrecht auf die Methode der Rechtsvergleichung zurück. Auch in diesem Rahmen kann rechtlichem Gedankengut einer Rechtsordnung der Vorzug gegenüber einer anderen eingeräumt, eine Synthese aus dem rechtlichen Gedankengut verschiedener Rechtsordnungen gewonnen oder gar eine vollständig neue Regelung in Ansatz gebracht werden. Enthält der zu schaffende gemeinsame Normenbestand rechtliches Gedankengut einer anderen Rechtsordnung als derjenigen, die die betreffenden Vorgaben umsetzen soll, handelt es sich insoweit genau genommen ebenfalls um eine Rezeption. Jedoch erfolgt diese hierbei stets unter der besonderen Zielsetzung der gegenseitigen Annäherung der Rechtsordnungen. Die Rechtsrezeption ist daher häufig auch als „Minus“ in der Rechtsangleichung enthalten. Die Rechtsangleichung selbst geht aber ebenso aufgrund ihrer Zielsetzung begrifflich über die Rezeption hinaus.
←33 | 34→Synonym zu dem Begriff der Rechtsangleichung werden die Begriffe der Harmonisierung und der Koordinierung gebraucht.32
II. Autonomer Nachvollzug
Der Begriff des „autonomen Nachvollzugs“ findet sich vornehmlich in der schweizerischen Literatur und wird dort im Zusammenhang mit der sog. europaverträglichen Ausgestaltung des schweizerischen Rechts33 verwendet.34
In der vorliegenden Arbeit bezeichnet der Begriff des autonomen Nachvollzugs dagegen im Allgemeinen das Phänomen, dass Nicht-EU-Staaten bestimmte Bereiche des EU-Rechts oder das EU-Recht im Ganzen für eine gewisse Dauer und ohne Bestehen einer völkervertraglichen Verpflichtung hierzu systematisch und fortgesetzt in ihre nationalen Rechtsordnungen übernehmen.
Freilich bildet auch insoweit nicht das EU-Recht selbst, sondern das diesem zugrunde liegende rechtliche Gedankengut den Gegenstand der Übernahme. Streng genommen handelt es sich hierbei damit wiederum um eine Rezeption, sofern dieses Gedankengut einer anderen Rechtsordnung entstammt. Im Unterschied zur Rezeption erfolgt der autonome Nachvollzug jedoch nicht eklektizistisch, sondern für eine gewisse Dauer systematisch und fortgesetzt. Zudem erfolgt er mit der ausschließlichen Zielsetzung, die übernehmende Rechtsordnung den Vorgaben des EU-Rechts entsprechend auszugestalten. Zur Herausstellung dieser beiden Unterschiede dient das Begriffselement des „Nachvollzugs“. Die Rechtsrezeption ist daher ebenfalls häufig als „Minus“ im autonomen Nachvollzug enthalten. Der autonome Nachvollzug selbst geht aufgrund seines Verfahrens und seiner Zielsetzung aber begrifflich über die Rezeption hinaus.
Daneben führt der Nachvollzug von EU-Verordnungen auch zu der Schaffung zumindest normativ identischer Rechtsnormen und der Nachvollzug von EU-Richtlinien zu einer Annäherung der nachvollziehenden und der mitgliedstaatlichen Rechtsordnungen. Im Unterschied zu der regionalen Rechtsvereinheitlichung und -angleichung innerhalb der EU erfolgt der Nachvollzug durch Nicht-EU-Staaten jedoch außerhalb des europäischen Rechtsraumes. Weder genießen die EU-Verordnungen innerhalb dieser Staaten unmittelbare Geltung ←34 | 35→noch besteht für sie eine Umsetzungspflicht in Bezug auf die EU-Richtlinien. Zur Herausstellung dieses Unterschieds betont das erste Begriffselement explizit, dass der Nachvollzug „autonom“ erfolgt. Möglicherweise würde die Verwendung des Wortes „souverän“ anstelle des Wortes „autonom“ die staatshoheitliche Eigenständigkeit des Nachvollzugs noch deutlicher hervorheben. Zudem würde sie auch zu einem begrifflichen Gleichlauf mit dem Kriterium führen, dass weiter oben zur Abgrenzung der Rechtsrezeption von der Oktroyierung vorgeschlagen wurde („Souveränität“).35 Aufgrund der Geläufigkeit der Bezeichnung als „autonomer Nachvollzug“ und des nur geringfügigen Bedeutungsunterschieds wird im Folgenden aber von einer abweichenden Bezeichnung abgesehen.
Von einer allgemeinen Maßnahme der Rechtsvereinheitlichung schließlich hebt sich der autonome Nachvollzug ebenfalls durch sein systematisches und fortgesetztes Verfahren und seine Beschränkung auf EU-Recht ab.
B. Einflüsse europäischen Rechts in der Türkei
I. Entstehung der modernen türkischen Rechtsordnung
Wesentlichen Anstoß zu den Entwicklungen, die mittelbar zur Entstehung der modernen türkischen Rechtsordnung geführt haben, gaben Wandlungen der Statik des osmanischen Rechtssystems36 im 19. Jahrhundert. Seither hat das Rechtssystem sowohl des Vorgängerstaates, des Osmanischen Reichs, als auch des Nachfolgestaates, der Republik Türkei, fortwährend Wandlungen erfahren. Orientierungspunkt bildeten dabei immer die europäischen Rechtssysteme, wenn auch in unterschiedlicher Intensität und mit durchaus unterschiedlichen Folgen. Gewissermaßen können auch die Maßnahmen im Zuge des EU-Beitrittsprozesses der Türkei als eine Art Fortführung dieser europäisch orientierten Wandlungen begriffen werden.37
←35 | 36→Die Ursachen für die Wandlungen im 19. Jahrhundert und der folgenden Entwicklungen, die mit ihnen ihren Anstoß fanden, reichen dabei teilweise bis in die Frühphase des Osmanischen Reichs zurück. Teilweise wurzeln sie aber auch in europäischen Strömungen des 18./19. Jahrhunderts. Die Herausarbeitung dieser Determinanten bildet daher den Schlüssel zum Verständnis der Entstehung der modernen türkischen Rechtsordnung.
1. Epoche des Osmanischen Reichs
a) Rechtssystem bis zur Zeit des Tanzimat
Die osmanische Rechtsordnung war keine originäre Rechtsordnung, sondern fußte im Wesentlichen auf dem islamischen Recht hanafitischer38 Prägung. Sie war damit selbst Folge eines Rezeptionsprozesses, den die verschiedenen turksprachigen Reiche infolge der Annahme des Islams vollzogen hatten.39 Laut Ekinci sollen sich die turksprachigen Reiche dabei an den Staats-, Rechts-, Verwaltungs- und Politiktraditionen des Kalifats der Abbasiden orientiert haben.40 Die Dynastie der Abbasiden bestand von 750–1258 n. Chr. in ihrer größten Ausdehnung auf den Gebieten der arabischen Halbinsel, des heutigen Irans und Teilen Nordafrikas. Nichtsdestotrotz trug das osmanische Rechtssystem zu einer Weiterentwicklung des islamischen Rechts bei und setzte damit auch eigene ←36 | 37→Akzente.41 Die osmanische Rechtsordnung kann daher als islamische Rechtsordnung osmanischer Prägung verstanden werden.42
Hauptbestandteile der osmanischen Rechtsordnung waren einerseits das islamische Recht (şer’î hukuk) und andererseits die Erlasse des Sultans (örfî hukuk). Daneben bestanden aufgrund der charakteristischen interpersonalen und interlokalen Rechtsspaltung die religionsrechtlichen Bestimmungen der anerkannten Religionsgemeinschaften (cemaatler hukuku) und regionsspezifische Bestimmungen (mahallî hukuk). Nichtmuslimische Ausländer unterlagen Sonderregelungen (ecnebîler hukuku).
aa) Das islamische Recht
Zur inhaltlichen Konturierung des islamischen Rechts ist eine Abgrenzung seiner Materie zu den Begriffen Scharia, fıkıh usûlü und fıkıh notwendig.
Die Verwendung des Begriffs Scharia erfolgt uneinheitlich43 und gegenwärtig häufig mehr als Schlagwort, denn als terminus technicus. Sprachlich wurde unter diesem Begriff in der vorislamischen Zeit „der Weg zur Tränke“ verstanden.44 Mit dem Aufkommen des Islams nahm die Bedeutung religiösen Inhalt an,45 wobei der Begriff in der islamischen Frühphase noch in einem sehr weitgehenden, die gesamte Religion umfassenden Sinne verstanden wurde.46 Erst mit Herausbildung der einzelnen Wissenschaftsdisziplinen und der damit einhergehenden Verselbständigung der spekulativen Theologie als eigener Disziplin erfolgte eine Verengung des Begriffsinhalts.47
Details
- Seiten
- 592
- Erscheinungsjahr
- 2022
- ISBN (PDF)
- 9783631886847
- ISBN (ePUB)
- 9783631886854
- ISBN (MOBI)
- 9783631886861
- ISBN (Hardcover)
- 9783631886090
- DOI
- 10.3726/b20115
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2022 (August)
- Erschienen
- Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 2022. 592 S.
- Produktsicherheit
- Peter Lang Group AG