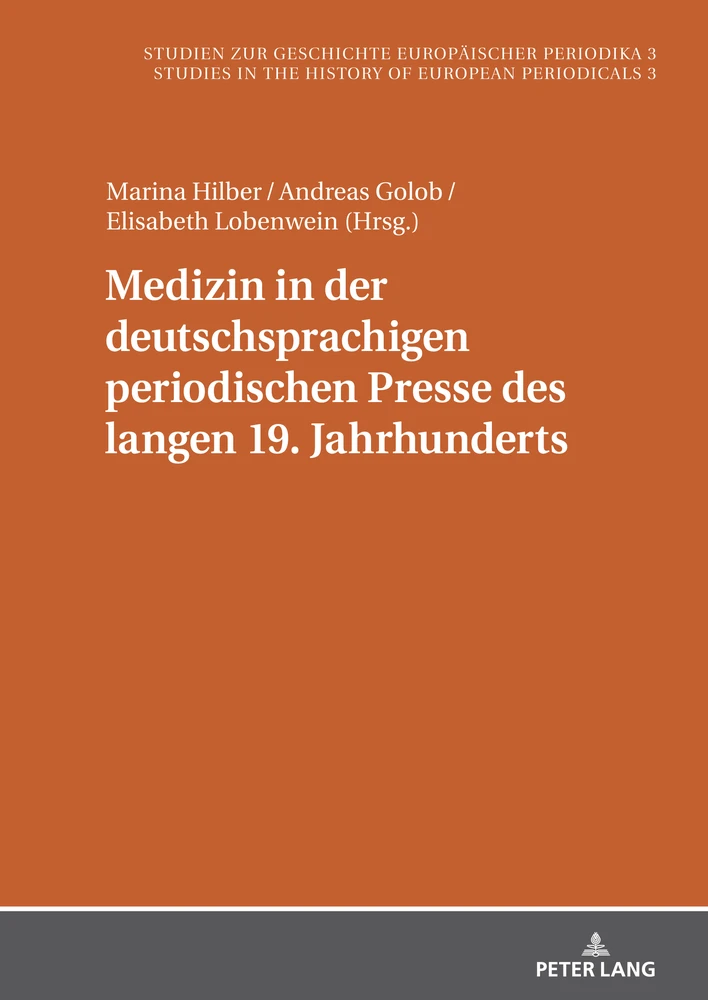Medizin in der deutschsprachigen periodischen Presse des langen 19. Jahrhunderts
Akteure, Praktiken und Formate
Summary
Excerpt
Table Of Contents
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Inhaltsverzeichnis
- Forschungsstand und Perspektiven einer Geschichte des Publizierens medizinischer Wissensbestände im langen 19. Jahrhundert
- Körper, Gesundheit, Krankheit und Medizin in den Politischen Gesprächen der Todten
- „Zur Warnung für Nichtkranke und zum Troste für Leidende“. Die (Populäre) Oesterreichische Gesundheits-Zeitung, 1830–1840
- Die Medicinisch-chirurgische Zeitung (1790–1840/64). Akteure und Praktiken der medizinischen Wissensvermittlung
- Die Vierteljahrschrift für die praktische Heilkunde (1844–1879). Repräsentation und Dissemination am Beispiel der Prager Geburtshilflichen Schule
Andreas Golob / Marina Hilber / Elisabeth Lobenwein
Forschungsstand und Perspektiven einer Geschichte des Publizierens medizinischer Wissensbestände im langen 19. Jahrhundert
Die periodische Presse der Frühen Neuzeit und des langen 19. Jahrhunderts trug im Tages-, Wochen-, Monats- und Jahresrhythmus in Berichterstattung, Räsonnement, Kommerzialisierung, Wissensgenerierung und Wissensvermittlung wesentlich zu Traditionen und Innovationen in der (Sozial- und Kultur-)Geschichte der Medizin bei. Aus diesem Spektrum wird das Zeitungs- und Zeitschriftenwesen, das zeitnah zu Zeiterscheinungen Stellung nehmen konnte, privilegiert. Während Kalender schon im 16. Jahrhundert Gesundheitswissen etwa in Form von Aderlassterminen boten,1 hielten gesundheitsbezogene Inhalte hingegen vergleichsweise bescheiden Einzug in das Zeitungswesen. Die frühen Zeitungen thematisierten im Rahmen der Hofberichterstattung die Gesundheit der Herrschenden als einen wesentlichen Faktor staatlicher Handlungsfähigkeit.2 Naturkatastrophen, Unfälle oder Sensationen (zu denken ist im medizinischen Feld etwa an außerordentliche Mehrlingsgeburten, besonders hohes Alter oder auffällige Fehlbildungen) kamen zwar ebenfalls vor, fanden sich aber tendenziell häufiger in geschriebenen Zeitungen und akzidentiellen Nachrichtendrucken, die sukzessive zurückgedrängt und im 18. Jahrhundert obsolet wurden.3 In diesem Jahrhundert begann sich im deutschen Sprachraum, nach französischen und englischen Beispielen, auch das Intelligenzwesen zu etablieren: Verlautbarungs- und Anzeigenblätter enthielten die legislativen Schritte der einzelnen Territorien, einen Bauchladen an Anzeigen und zunehmend auch unterhaltende sowie allgemeinbildende Artikel.4 Die Medikalisierung äußerte sich hier etwa mit der Gesetzgebung in Sachen medizinischer Polizei mit ihren Geboten sowie Verboten, in der Ausschreibung von Stellen im öffentlichen Gesundheitswesen, durch Maßnahmen zur Prävention und Bekämpfung von Epidemien. Diese regulierenden Bestrebungen wurden von Wissensvermittlung begleitet, teils aber auch durch beworbene Wundermittel geradezu konterkariert.
Im letzten Drittel des 17. Jahrhunderts entstanden neben dem skizzierten Strang der allgemeinen Informations-, Meinungs- und Intelligenzpresse als bedeutende neue Faktoren gelehrte und in weiterer Folge allgemeinen oder speziellen Inhalten verpflichtete Zeitschriften, zuerst für kleinere Kommunikationszirkel, zunehmend aber, vor allem ab dem letzten Drittel des 18. Jahrhunderts, für die sich ausweitende adelige und insbesondere bürgerliche Leserschaft. Daneben etablierten sich stärker fachlich orientierte Rezensionsorgane und Formate, in denen die Kritik den Ton angab. Fragen nach Beschaffenheit und Funktion des Körpers unter Berücksichtigung des zeitgenössisch vorhandenen naturkundlichen Wissens, Gesundheit und Krankheit sowie Prävention und Therapie waren in diesen Medien mehr oder weniger konzentriert vertreten.5 In Karl Philipp Moritz’ (1756–1793) Gnothi Sauton oder Magazin zur Erfahrungsseelenkunde als ein Lesebuch für Gelehrte und Ungelehrte (1783–1793) wurden etwa auch psychologisch-anthropologische Dimensionen interaktiv ausgelotet. Diese generellen und differenzierteren gelehrten Fragen verhandelte eine facettenreich zusammengesetzte gebildete Leserschaft, in der die Ärzteschaft tendenziell von der gewichtigen Mitsprache zur Meinungshoheit strebte. Der ärztliche Anspruch, „gesellschaftliche Führungsrollen“ übernehmen zu können, spiegelte sich demnach nicht nur in ihrer erstarkenden Rolle in der öffentlichen Gesundheitsverwaltung und in der zunehmenden Ausdifferenzierung medizinischer Teildisziplinen wider, sondern lässt sich auch anhand der periodischen Presse nachvollziehen. Es kam zu einer quantitativen Zunahme von medizinischen Zeitungen und Zeitschriften im Laufe des 19. Jahrhunderts, in denen Ärzte als Herausgeber, Redakteure, Beiträger oder Rezensenten und so als „Medienmacher“ aktiv wurden.6
Fachjournale zielten nicht zuletzt darauf ab, neues und neuestes medizinisches Wissen innerhalb der Academia beziehungsweise an den praktischen Arzt zu vermitteln. Dabei wurden bis weit in die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts hinein weiterhin Lehrbücher beziehungsweise monografisch vermitteltes Wissen als Grundlage für kurze und prägnante Rezensionen herangezogen. Diese sollten die Mediziner oder interessierte Laien dabei unterstützen, den Überblick über die stetig wachsende Fülle an medizinischen Publikationen zu bewahren und sie so über aktuelle Entwicklungen und „Fortschritte“ im Feld unterrichten. Für niedergelassene Ärzte war der „Konsum“ derartiger Schriften nicht nur eine kostengünstigere Alternative zum Erwerb teurer Monografien, sondern auch ein Nachrichtenmedium. Viel Raum nahmen in diesen medizinischen Periodika nämlich auch tagesaktuelle und systematisch gesammelte Informationen ein: meteorologische Beobachtungen, statistische Mitteilungen zu den häufigsten Infektionskrankheiten oder zur allgemeinen Bevölkerungsbewegung in einer Region; des Weiteren Verordnungen das Sanitätswesen und die medizinische Ausbildung betreffend, Preisfragen sowie Biografisches wie Berufungen, Beförderungen, Pensionierungen und Nekrologe. Erst Schritt für Schritt konnte sich der gelehrte Austausch über eigene klinische Observationen in Form von Originalbeiträgen etablieren.7 Dabei war das periodische Medium lange Zeit insbesondere von den gelehrten Gesellschaften mit Argwohn beäugt worden.8 Der Medizinhistoriker Max Neuburger (1868–1955) begründete die – aus seiner Sicht – vergleichsweise späte Hinwendung der Wiener Medizin zur periodischen Presse mit einem zeitgenössischen Vorurteil: So liefen Studenten und praktizierende Ärzte durch das Lesen von Journalen Gefahr, vom Studium etablierter Werke abgelenkt zu werden und sich nur gefährliches Halbwissen anzueignen,9 denn gesichertes, kanonisiertes Wissen wurde primär in den traditionellen Formaten eines Lehr- oder Handbuches verortet. Diesen Befund der Vorläufigkeit und Kurzlebigkeit von Journalbeiträgen stilisierte auch der Wissenschaftstheoretiker Ludwik Fleck zu einem Charakteristikum der periodischen Presse.10 Für die Zeitgenossen bedeutete diese Hinwendung zur Periodizität also einen Paradigmenwechsel, den Sigrid Stöckel pointiert beschreibt:
„Die Periodizität der Texte bedeutete eine Abkehr vom Konzept eines fixierten Wissenskorpus, der mit dem Anspruch auf Vollständigkeit und entsprechend in Buchform erschienen war. An seine Stelle traten Beobachtungen und Experimente, deren Ergebnisse in vergleichsweise kurzen Kommunikationsformen notiert werden konnten und fortgeschrieben werden sollten.“11
Die einschlägige periodische Presse wurde dadurch zu einem Raum, in dem neue Erkenntnisse ausgehandelt und bewertet, ergänzt oder verfeinert werden sollten.
In der traditionellen Medizingeschichte fristeten Periodika – wohl entsprechend der Vorurteile, aber auch aufgrund arbeitsökonomischer Momente – lange Zeit ein Schattendasein. „Wer alte medizinische Zeitschriften […] in die Hand nimmt, um sich in die Heilkunde des neunzehnten Jahrhunderts zu vertiefen, wird leicht vor der gewaltigen, scheinbar amorphen Masse des Stoffes resignieren,“12 urteilte der Pulmologe, Medizinhistoriker und langjährige Herausgeber der Deutschen Medizinischen Wochenschrift Walter Albert Leopold von Brunn (1914–1971) in seinem 1963 erschienenen historischen Überblick zur internationalen medizinischen Fachpresse. Er schien damit erklären zu wollen, warum die Historiografie medizinischer Zeitschriften in seiner Generation noch in den Kinderschuhen steckte.13 Die schiere Fülle an kurz- oder langlebigen Zeitschriften, populären oder stark wissenschaftlich differenzierten Medien zu diversen Facetten der Medizin – die nicht erst seit dem beginnenden 19. Jahrhundert existierte – stellte einen riesigen, aber methodisch schwer zugänglichen Quellenfundus dar. Aus einem positivistischen, auf Fortschritt orientierten Medizinverständnis heraus mag es müßig erschienen sein, die Rezensionsorgane des 18. und frühen 19. Jahrhunderts zu konsultieren. Ebenso wenig waren die vielen kasuistischen Mitteilungen und vorläufigen Erkenntnisse, die in der Fachpresse ausgehandelt und diskutiert wurden, in den Forschungszugängen einer traditionellen Medizingeschichte verwertbar. Die zahlreichen kurzlebigen Zeitschriften waren überdies per se nicht interessant, denn schon der zeitgenössische Markt hatte ihnen – vorurteilsbehaftet – fehlende Qualität bescheinigt und einen untergeordneten Platz in der Geschichte zugewiesen. Lediglich der akteurszentrierte Zugang, der Lob und Anerkennung für die Arbeit der Redakteure einzelner „erfolgreicher Zeitschriften“ transportierte, wurde von Brunn mit gewisser Akribie verfolgt.14 Die 1960er Jahre, in denen Brunn diese Überlegungen anstellte und letztendlich nicht über ältere Ansätze hinausging, markierten in der allgemeinen deutschsprachigen Presseforschung allerdings durchaus eine Wende hin zur Integration von Sozial- und Kulturgeschichte.15 Allerdings wirkten diese Ansätze sich noch nicht auf die Auseinandersetzung mit populären oder gelehrten medizinischen Zeitschriften und mit den einschlägigen Inhalten der Tagespresse aus.16 Erst im Zuge der sozialgeschichtlichen Wende der 1970er und 1980er Jahre ergaben sich wesentliche Perspektivenwechsel und engere Verschränkungen zwischen Sozialgeschichte und Pressegeschichte in der Erforschung medizinischer Periodika, die sich im deutschen Sprachraum ab den 1990er Jahren materialisierten. Grundsätzliche Überlegungen zu Spielregeln der Gattung,17 Austauschprozesse zwischen popularisierender Wissensvermittlung oder regulatorischen Maßnahmen einerseits und ausgewählten Fachzeitschriften andererseits,18 die Verflechtung von relevanten Medien zum einen und dem Markt sowie der Öffentlichkeit zum anderen19 stecken deskriptiv und diskursiv die Rahmenbedingungen ab, wie die ärztliche Stimme in öffentlichen Debatten um Gesundheit und Krankheit mit anderen beteiligten Gelehrten oder Beamten, letztendlich mit der mehr oder weniger gebildeten Leserschaft insgesamt ins mediale Gespräch kommen konnte. Die Retrodigitalisierung und die damit verbundene leichtere Zugänglichkeit großer Zeitungs- und Zeitschriftenbestände seit der Jahrtausendwende führten zu einem letzten Schub in der Nutzung historischer medizinischer Wissensbestände in Periodika auch abseits klassisch-medizingeschichtlicher Themen.20 Prominente medizinische Zeitschriften wurden beispielsweise zur Untersuchung des Politikbegriffs in der Medizin beziehungsweise der Biologisierung des politischen Denkens des 19. Jahrhunderts herangezogen.21
Während die Nutzbarmachung von Periodika für innovative Fragestellungen also wesentliche Fortschritte gemacht hat, bleibt die Frage nach dem medienspezifischen Beitrag, der Periodika im Gegensatz zu anderen Medien und Kommunikationsformen ausmacht, unterrepräsentiert. Am konzentriertesten gingen diesem Desiderat bislang anglo-amerikanische Bestrebungen nach.22 Die britischen Historiker William F. Bynum, Stephen Lock und Roy Porter warfen in ihrem 1992 herausgegebenen Sammelband Medical Journals and Medical Knowledge innovative Blicke auf Wissenschaftszeitschriften und eröffneten ein neues Forschungsfeld innerhalb der Sozialgeschichte der Medizin. Analysiert wurde dabei anhand von britischen Journalen der Einfluss von medizinischen Periodika auf die Etablierung und Professionalisierung der einschlägigen medical community.23 Themen wie die spezifischen Entstehungskontexte medizinischer Zeitschriften, Karrierestrategien von medizinischen Autoren, die Verantwortung von Herausgebern und die Rezeption durch die informierte Leserschaft, die ebenfalls bereits durch Bynum, Lock und Porter angestoßen worden waren, fanden in der Forschung aber bis vor kurzem nur punktuell Berücksichtigung.24 Erst seit wenigen Jahren sind international eine Rückbesinnung auf das Forschungspostulat der genannten Sozial- und Medizinhistoriker und ein signifikanter Aufschwung einschlägiger Studien zu verzeichnen, wobei in den rezenten Forschungsprojekten vor allem im weitesten Sinne naturwissenschaftliche Periodika im Fokus stehen. Der untersuchte Raum blieb bislang weiterhin größtenteils auf Großbritannien und Frankreich beschränkt.25 Alex Csiszar konstatierte 2018, dass eben diese westeuropäischen Regionen federführend in der Ausformung und langfristigen Etablierung wissenschaftlicher Periodika waren. Doch musste er ebenfalls zugeben, dass in einem globalen Kontext andere (Sprach-)Regionen noch deutlich unterbelichtet seien. Insbesondere den deutschsprachigen Periodika schreibt Csiszar eine nicht zu unterschätzende Bedeutung am internationalen Markt zu, die diese erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts einbüßten.26 Während der Index Medicus 1879 noch 201 deutschsprachige medizinische Zeitschriften aufwies, was einem Marktanteil von 25 Prozent entsprach, reduzierte sich deren Anteil in der Folge signifikant und lag 2008 bei nur mehr 1,9 Prozent. Englischsprachige medizinische Periodika nahmen seit 1879 deutlich an Bedeutung zu und erweiterten ihren Anteil von 35 Prozent auf annähernd 90 Prozent. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts setzte sich nicht nur das Englische als Wissenschaftssprache durch, sondern auch der konzise anglo-amerikanische Stil, Medizin und Naturwissenschaft zu schreiben. Csiszar plädiert dafür, die Evolution wissenschaftlicher Zeitschriften im deutschsprachigen Raum eingehender zu studieren, um zu klären, ob sich die von ihm untersuchten Prozesse auch hier ähnlich vollzogen haben.27
Der vorliegende Band legt seinen Fokus explizit auf die Verschränkung von Medien- und Wissenschafts- beziehungsweise Wissensgeschichte der Medizin und analysiert anhand von vier geografisch und zeitlich gestreuten Fallstudien einige Facetten der medizinisch relevanten periodischen Presse in der Habsburgermonarchie seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert. Dabei wird die Habsburgermonarchie nicht als ein abgeschlossener Wissenschaftsraum gedacht, sondern als eng verwoben mit dem übrigen deutschsprachigen Raum Mitteleuropas. Allerdings sind unsere Fallstudien vor dem Hintergrund einer ähnlich strukturierten Wissenschafts- und Universitätslandschaft zu verstehen, die durch den Medikalisierungs- und Professionalisierungsprozess seit den Reformen Maria Theresias (1717–1780) wechselseitig beeinflusst wurde. Wir nehmen bei unseren Analysen nicht nur Beispiele aus den Zentren Wien und Prag in den Blick, sondern auch periphere Publikationsstandorte wie das erst 1816 endgültig in die Monarchie eingegliederte ehemalige Erzstift Salzburg sowie überregional verbreitete Lektüren. Dass unser Fokus auf deutschsprachigen Periodika liegt, baut auf der Tatsache auf, dass die deutsche Sprache nicht nur in der Monarchie die führende Verwaltungs- und Wissenschaftssprache darstellte, sondern gerade im Feld der Medizin auch im globalen Kontext neben Englisch und Französisch zu den am breitesten rezipierten Sprachen zählte.
Mit der zeitlichen Eingrenzung auf das lange 19. Jahrhundert nehmen wir somit jene Phase als Ausgangspunkt, in der die periodische Presse Momentum in diesem Raum gewann und verfolgen anhand unserer Beispiele die Entwicklung von Medien mit medizinischen Inhalten bis um die Jahrhundertwende. Aus sozial-, kultur-, wirtschafts- sowie wissenschaftshistorischen und standespolitischen Perspektiven nehmen wir medial breit differenziert Tages- und Wochenzeitungen ebenso in den Blick wie „klassische“ Rezensionszeitschriften, populäre Gesundheitszeitungen sowie Zeitschriften mit einem dezidiert wissenschaftlichen Anspruch. Besonderes Augenmerk legen die Einzelfallstudien auf die jeweiligen Entstehungs- und Erscheinungszusammenhänge sowie die verantwortlichen Herausgeberpersönlichkeiten und die Praktiken der Wissensvermittlung. Wir folgen damit Sigrid Stöckels Postulat, wissenschaftliche Zeitschriften nicht länger als passive Vermittlungsorgane zu verstehen, sondern ihre „Doppelstruktur – als vermittelndes Medium einerseits und Eigeninteressen verfolgender Akteur andererseits“28 – stärker wahrzunehmen. Diesen Aspekt, der auch auf die periodische Presse insgesamt angewendet werden kann, arbeitete auch der Wissenschaftssoziologe Peter Weingart29 heraus, indem seiner Argumentation zufolge Wissenschaft erst durch einen gewissen Grad an Öffentlichkeit legitimiert wird. Obwohl im Fall von Wissenschaftszeitschriften häufig nur eine partikulare Öffentlichkeit erreicht wird,30 stellen Zeitschriften nicht nur ein Vehikel des Fachdiskurses dar, sondern erlauben durch redaktionelle Entscheidungen auch eine gezielte Steuerung desselben. Auch im Hinblick auf die Frühe Neuzeit zeigt die positive oder negative mediale Resonanz von Wissen ähnliche Grundzüge. Das Periodikum wird in der historischen Betrachtung dadurch nicht nur zur wissensbasierten Erkenntnisquelle für die Rekonstruktion der Geschichte einzelner medizinischer Teildisziplinen, medizinischer Technologien und medizinischer Kontroversen, sondern muss als sozial strukturierendes Instrument in (Allgemein-)Bildung, Gelehrsamkeit beziehungsweise Wissenschaft wahrgenommen werden. Dabei lassen sich anhand der Praktiken des Publizierens nicht nur soziale, professionelle oder politische Hierarchien abbilden, sondern – indem man die Zeitschrift tatsächlich als Akteur versteht – auch Strategien der Stratifizierung des Wissens und des Handelns im Sinne eines Marktes nachvollziehen.31 Zeitschriften schaffen einen sozialen Raum, sind somit gewissermaßen „soziale Institutionen“, wie der Politologe Gerhard Göhler sie definiert.32 Diesen Gedanken ausführend, argumentiert Stöckel: „Die Präsentation und Organisation des Wissens wird nicht ausschließlich durch wissenschaftliche Kriterien bestimmt, sondern durch soziale Gegebenheiten, Präferenzen und professionelle Hierarchien oder politische Konstellationen.“33 Die verschiedenen Beispiele in diesem Band zeigen diese sozialen Netzwerke und vielfältigen professionellen Beziehungen deutlich auf.
Die versammelten Beiträge verfolgen die medizinische Publizistik von der Spätaufklärung über Romantik und Vormärz bis zur Entfaltung der Moderne und somit entlang wesentlicher Entwicklungslinien des langen 19. Jahrhunderts und der Medizingeschichte. Andreas Golobs Beitrag bewegt sich an der Schwelle vom 18. zum 19. Jahrhundert. Das Beispiel der Politischen Gespräche der Todten (1786–1810), eines in Neuwied und danach in Frankfurt am Main gedruckten, jedoch in der Habsburgermonarchie flächendeckend verbreiteten Presseorgans, zeigt hervorragend, dass Information über Medizinisches im weitesten Sinn zur Allgemeinbildung gerechnet werden kann, wie die habsburgische Medizinische Polizei wahrgenommen wurde und welchen Verschriftlichungsgrad der Heilmittelmarkt bereits erreicht hatte. Durch die aufgeklärt-absolutistische Schulreform in der Habsburgermonarchie stieg die Alphabetisierung, und die damit ermöglichte direkte Partizipation an der Schriftlichkeit schritt über das Bürgertum hinaus. Auch wenn Erfolge im katholischen süddeutschen Raum beachtlich waren, sind allerdings nach wie vor orale Vermittlungsinstanzen wie vorlesende Lehrer und Predigten sicherlich nicht wegzudenken, obwohl die steigende Alphabetisierung zur zunehmenden Stigmatisierung des Analphabetismus führte, wie etwa Siegert argumentiert;34 jedenfalls kann insgesamt aufgrund der Erreichung einer kritischen Masse an Leser*innen von einer „Gesellschaft“ ausgegangen werden, „in der jeder vom geschriebenen Wort erreicht werden kann, sobald Interesse daran besteht“35 – und Interesse wird basalen Themen wie Gesundheit, Krankheit und Körperlichkeit kaum abgesprochen werden können. Der Redakteur der äußerst populären Politischen Gespräche, der gebildete medizinische Laie Moritz Flavius Trenck von Tonder (1746–1810), setzte das Genre der Totengespräche effektvoll ein, um Bilanz zu ziehen und Kritik zu üben, in letzter Instanz, um Einfluss auszuüben. Bedeutende verstorbene Akteure der habsburgischen Reformen in der akademisch-medizinischen und klinischen Ausbildung sowie in der Medizinalgesetzgebung von Gerard van Swieten (1700–1772) abwärts kamen zu Wort und beurteilten, meist kulturpessimistisch, die Lage gegen Ende des 18. Jahrhunderts, die nur noch einen Abglanz der Großtaten der Jahrhundertmitte darstelle.36 In der populären politischen Polemik, die das Medium ausmachte und zu einem Vorreiter des Vormärz etablierte, bediente sich der brachiale und nicht selten suggestive Satiriker aus einem breiten Repertoire von Körperauffassungen, das zwischen Humoral- und Nervenpathologie changierte. Dies zeigt, wie sehr sich am Ende des 18. Jahrhunderts und in der Sattelzeit vormoderne und moderne Konzepte vermischten. Religiös konnotierte Heilungen wurden zudem skeptisch, jedoch nicht vollkommen ablehnend beäugt, während materialistische Ansätze – entsprechend den Zensurvorgaben der Zeit – generell Rückweisung erfuhren. Der überzeugte Josephiner Trenck von Tonder nahm in den Tagesnachrichten auch sozial- sowie kulturgeschichtlich facettenreich Anteil am Leiden und Sterben seines Idols Kaiser Joseph II. (1741–1790). Der Öffentlichkeitscharakter der Inszenierung des aufgeklärt-absolutistischen Kranken, mythologische stellvertretende Schauplätze und schließlich das Unbehagen mit medizinischen Beratern des Kaisers prägten das Bild. Die schließlich ebenfalls zuhauf vorhandenen Annoncen des Anzeigenblatts geben nicht nur einen Überblick über den umkämpften Heilmittelmarkt der Herkunftsregion des Mediums, sondern veranschaulichen auch zahlreiche überregionale Vernetzungen der Akteur*innen in Mitteleuropa. Diese Protagonist*innen verstanden es bereits, die Klaviatur der Medien für ihre Zwecke zu nutzen und zeigen mit ihren öffentlichen Anpreisungen nicht zuletzt auch Schwachpunkte der regulierenden medizinischen Polizei auf. In aller Schärfe ausgetragene Kontroversen zwischen Ärzten demonstrieren letztendlich, dass Status und Rechtfertigung keineswegs bloß in den inneren (medialen) Zirkeln der Gelehrsamkeit ausgehandelt, sondern auch vor einer breiten Leserschaft verhandelt wurden.
Maria Heidegger nimmt in ihrem Beitrag ein Periodikum in den Blick, das dezidiert an ein breites Lesepublikum gerichtet war und mit dem Vormärz einer Ära angehörte, die Trenck von Tonder wesentlich vorbereitet hatte. Die zwischen 1830 und 1840 in Wien erscheinende (Populäre) Österreichische Gesundheits-Zeitung sah ihr Hauptmotiv in der fundierten Information ihrer bürgerlichen Leserschaft, um (gefährliches) medizinisches Halbwissen zu beseitigen und den Status akademischer Ärzte zu stärken. Die Urteile über die vom Arzt Anton Dominik Bastler (1802–1886) herausgegebene Zeitschrift wirken in der Rückschau ambivalent: Während der Wiener Medizinhistoriker Isidor Fischer (1868–1943) die Bestrebungen Bastlers als legitim und erfolgreich bezeichnete,37 fällt das Urteil seines Kollegen Max Neuburger differenzierter aus. Mit Blick auf die Wiener Leserschaft wäre das Unterfangen einer belehrenden Gesundheitszeitung von vornherein zum Scheitern verurteilt, denn, so Neuburger: „Das Publikum, namentlich das Wiener, ist kein gar großer Freund von diätetischen Schriften. Man will in Dingen der Sinnlichkeit nicht reprimandiert, nicht gehofmeistert werden.“38 Bastler selbst problematisierte die Lektüre, wie die Autorin ausführt, als zweischneidiges Schwert. Einerseits ging es um Wissensvermittlung, die andererseits aber gerade zu pathologischer, gegenderter Hypochondrie/Hysterie und zu Lesewut/Lesesucht – Begriffe des spätaufklärerischen und romantischen pädagogisch-medizinischen Diskurses – Anlass geben konnte. Die zahlreichen Beispiele weisen auf lokale, regionale sowie internationale Vernetzungen hin. Auch Intertextualität und Intermedialität mit häufigen, vor der Formulierung des Copyrights üblichen, nicht referenzierten Übernahmen lassen sich an konkreten Beispielen nachweisen.39 Interdisziplinarität, sofern sie die Leserschaft nicht mit Spezialwissen überforderte, wurde in Bastlers Periodikum ebenfalls gepflegt. Das hinter der Fassade der Artikel stehende „Betriebssystem“ der romantischen Medizin äußert sich in Beiträgen, die Psyche sowie Emotionen thematisieren, Anknüpfungspunkte zur Belletristik oder, wenngleich dezent, zur Religion bieten und insgesamt ein holistisches Menschenbild vertreten. Der konkrete Hintergrund ist durch die Cholera und die Machtlosigkeit der Medizin prekär. Populär werdende, empfohlene und beworbene Kurbäder sollten Abhilfe schaffen. Die vormärzliche Zensur zwang zur Anonymität in besonderer Weise, zusätzlich zur Vorsicht gegenüber den kritischen Instanzen der Öffentlichkeit und der Fachkollegenschaft. Der spezielle Blick auf das Klima erkundet das Nebeneinander von Vorstellungen über Miasmen einerseits und den wissenschaftlichen, physikalischen und chemischen Erkenntnissen des 18. Jahrhunderts (Joseph Priestley 1733–1804, Antoine Laurent de Lavoisier 1743–1794) sowie statistischen, vergleichenden Methoden andererseits – der Übergang vom naturphilosophischen zum naturwissenschaftlichen Paradigma, hin zur „zweiten Wiener medizinischen Schule“,40 deutet sich an.
Einblicke in die Redaktionsstube, die bereits Heidegger aus gedruckten Quellen und in ihrer Nähe zum Buchdruckergewerbe plastisch wiedererstehen lässt, gewähren Elisabeth Lobenwein und Alfred Stefan Weiß sogar aus archivalischen Quellen und decken für die prominente Medicinisch-chirurgische Zeitung (gegründet 1790) zusammen mit paratextuellen Belegen Verlagsmodalitäten, Netzwerke, intellektuelle Soziabilität und moralische Ansprüche beziehungsweise Wirklichkeiten, Informationsbeschaffung, Finanzierung, Konkurrenz und interne Animositäten auf. Diese Einsichten ergänzen in seltener Weise das Bild eines eminenten Rezensionsorgans, das in seiner Blütezeit rund 2.500 Abonnenten im gesamten europäischen Raum auf sich vereinte und über das der Medizinhistoriker Neuburger anerkennend urteilte, es wäre „niemals bloß regionalen Charakters [gewesen], sondern hatte schon früh die Bedeutung eines der wichtigsten Repertorien der deutschen Medizin, einen weit über die Grenzen Deutschlands und Österreichs hinausreichenden Ruf erlangt“.41 Dennoch war die Zeitschrift, wie Lobenwein und Weiß ausführen, nicht davor gefeit, unter der Demarkationslinie zwischen Norden und Süden, die den gelehrten und literarischen deutschen Sprachraum durchschnitt, zu leiden. Als Rezensionszeitschrift informierte das verlagstechnisch Salzburger, später Innsbrucker, kurz Augsburger und schließlich Münchener Medium über Entwicklungen in der sich ausdifferenzierenden und spezialisierenden Medizin. Durch ihre lange Lebensdauer (1790–1864) und ihre inhaltliche Ausrichtung muss die Medicinisch-chirurgische Zeitung als bedeutendes Bindeglied zu den späteren Fachzeitschriften gelten. Das enzyklopädische Wissen in Medizin und Chirurgie, unter Berücksichtigung von Geburtshilfe, Epidemiologie, Veterinärwesen, Botanik, Physik und Chemie, Spitalswesen, Medizinalverwaltung und Medizinalgesetzgebung zeigt die weitreichenden Verästelungen des medikalen Feldes. Qualitätskontrolle insbesondere populärer Schriften und Besprechung der neuesten Fortschritte steckten die Pole ab.42 Die Ordnung des Wissens erfolgte in Registern, die der Zeitschrift mit der Recherchemöglichkeit auch über den Tag hinaus deutlichen Mehrwert verliehen. Für die Forschung ergeben sich Einblicke in Konjunkturen der Wissensgenerierung und Mitte der 1840er in die wissenschaftlich-akademische Ausdifferenzierung in Spezialfächer. Das Zurückdrängen und letztendliche Auslaufen der Rezensionen, das im zeitlichen Verlauf untersucht wird, zeigt, dass sich das ursprüngliche mediale und kommunikative Konzept überlebt hatte, und die Zukunft in Originalbeiträgen liegen würde. Attraktivierungsversuche durch neue Schwerpunktsetzung oder simple Umbenennungen und hoher Turnover in der Redaktion zeugen vom Abglanz der einstmaligen Größe.
Im letzten Beitrag, der den letzten Schritt zur modernen naturwissenschaftlichen Medizin vollzieht, rekonstruiert Marina Hilber schließlich am Beispiel der böhmischen Vierteljahrschrift für die praktische Heilkunde den strukturellen Wandel von der Vormacht der Sammelbesprechungen und Rezensionen hin zur Dominanz kasuistischer und klinischer Studien. Die Prager Zeitschrift erschien nach einer längeren Planungsphase erstmals 1844. Ähnlich den Vorbehalten, die Csiszar und Fyfe für den englischen und französischen Raum beschreiben, galt es auch in Prag zunächst auszuhandeln, welche Form und welche Ausrichtung das Periodikum erhalten sollte. Die Vierteljahrschrift wurde schließlich mit einem klaren Sendungsbewusstsein konzipiert und sollte als Sprachrohr und Leuchtturmprojekt der medizinischen Fakultät über die Grenzen des Universitätsstandortes hinaus wirken. Damit erhofften die Fakultätsverantwortlichen eine Profilierung des Wissenschaftsstandortes zu erreichen und die Konkurrenzfähigkeit mit der Hauptstadtuniversität Wien aufrecht zu erhalten. Die Fokussierung auf die praktische Heilkunde sollte integrativ die gesamte medizinische Fakultät repräsentieren, bediente aber gleichzeitig über einen gewissen Bildungsauftrag die Nachfrage nach praktisch anwendbarem Wissen für niedergelassene Ärzte in Böhmen und darüber hinaus. Mit der nosologischen Neuausrichtung des Publikationsorgans, die eine strikte Abkehr vom Verständnis der Humoralpathologie sowie eine besondere Affinität zur Anatomie und Pathologie Wiener Ausprägung erkennen ließ und damit Krankheiten primär in den Organen verortete, nahm die Vierteljahrschrift in den 1840er Jahren eine Vorreiterrolle in der Begründung der modernen Medizin ein. Strukturell versuchten die Herausgeber zunächst ein Gleichgewicht zwischen empirisch fundierten Originalbeiträgen aus der klinischen Praxis und breitgefächerten Literaturübersichten aus den zentralen Feldern der Medizin, die die stetig wachsenden Wissensbestände der Teildisziplinen widerspiegelten, zu gewährleisten. Doch gerade die Zusammenschau des State of the art in Form von kritischen Besprechungen von Originalarbeiten aus anderen prominenten Zeitschriften des In- und Auslandes schien bald deutlich an Gewicht zu gewinnen und zog mehrfach die nahezu verzweifelte Bitte der Herausgeber nach sich, diesen Bereich möglichst konzise abzuhandeln. Doch gerade mit der Abfassung der sogenannten Analekten konnten die damit betrauten Mediziner ihren beruflichen Status ausbauen und sich als aufstrebende Experten gerieren.
Details
- Pages
- 226
- Publication Year
- 2024
- ISBN (PDF)
- 9783631898079
- ISBN (ePUB)
- 9783631898086
- ISBN (Hardcover)
- 9783631898062
- DOI
- 10.3726/b21261
- Language
- German
- Publication date
- 2024 (April)
- Keywords
- Wissenschaft Körper Gesundheit Krankheit Entwicklungszusammenhang Wissensvermittlung Medizin Zeitschrift
- Published
- Berlin, Bruxelles, Chennai, Lausanne, New York, Oxford, 2024. 226 S., 17 s/w Abb.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG