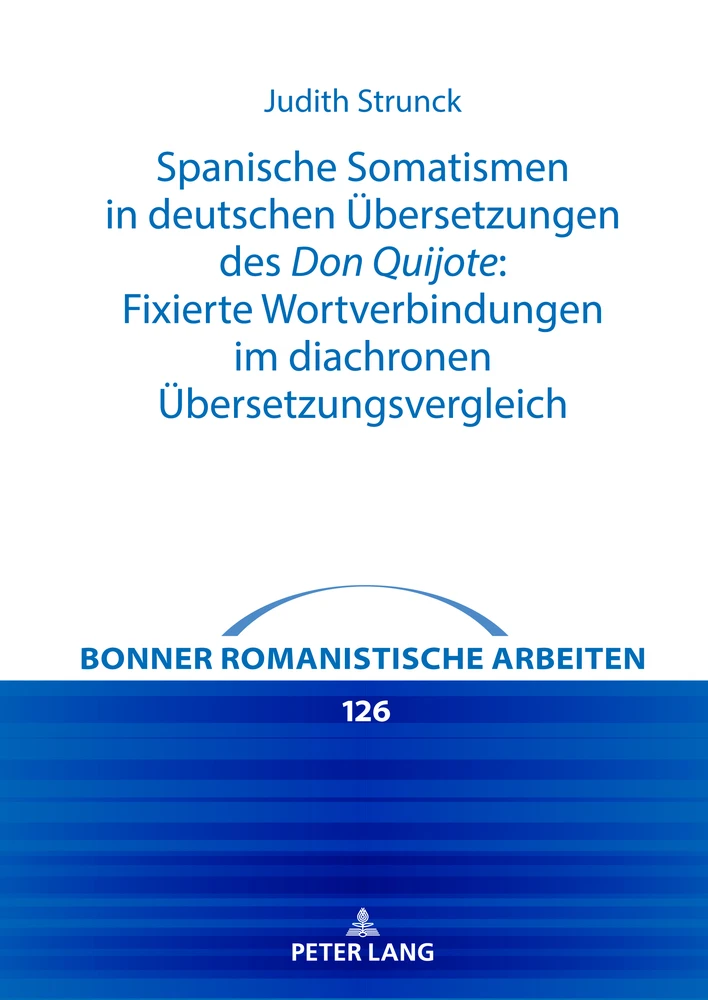Shakespeare: Humanität im Spannungsfeld von Kontrast und Konflikt
Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Shakespeare: Frauenliebe/Männerliebe
- „Love“, „Lust“ und „Shame“ in William Shakespeares „Dark Lady“-Sonetten
- King Lear oder die Erziehung des Herzens
- Shakespeares Sturm
- Herders Shakespeare-Essay in literarischen und theoretischen Konstellationen
- Literaturverzeichnis
- Nachweise der Erstdrucke
Einleitung
He was not of an age, but for all time!
Ben Jonson
Alle Fühler ausgestreckt, tastet [der Schriftsteller]
nach der Gestalt der Welt, nach den Zügen des
Menschen in dieser Zeit. […] Die Wahrheit
nämlich ist dem Menschen zumutbar
Ingeborg Bachmann.1
Im 9. Kapitel von James Joyce’ Roman Ulysses diskutieren ein paar Dubliner Intellektuelle in den Räumen der irischen Nationalbibliothek über Shakespeare, über seine Bedeutung und die Möglichkeiten der Werkinterpretation. Der Bibliothekar Mr. Best feiert den Dramatiker als „a myriadminded man, […] Coleridge called him myriadminded.“2 Und Stephen Dedalus, einer der beiden Hauptfiguren des Werks, spricht von: „his glory of greatest shakescene in the country.“3
Mit Superlativen kommt niemand an Shakespeare heran. Das wusste natürlich auch James Joyce. In einer mittlerweile alt gewordenen englischen Literaturgeschichte hat David Daiches ganz anders argumentiert.4 Daiches lässt die großen Worte auf sich beruhen und beginnt gleichsam induktiv mit Shakespeares Entwicklung vom Schauspieler zum Theaterautor. Dabei hebt er die einzigartige Kompetenz des Theatermanns, eines Praktikers von Gnaden hervor. Shakespeare beherrschte seinen Beruf mit allen Techniken und Konventionen seiner Zeit, war aber zugleich – und das ist ausgesprochen selten – ein literarisches Genie. Daiches spricht von einem „unheimlich intuitiven Verstehen der menschlichen Psyche“ sowie von der „Einsicht, mit der [Shakespeare] die Bewusstseinszustände und Verhaltenskomplexitäten“ präsentiert. Auch zeigt der Dichter „mit unübertrefflicher Brillanz wie er den Äußerungen seiner Charaktere durch ihre poetische Sprache Überzeugungskraft und neue Dimensionen verleiht.“
Ich habe in diesem kleinen Buch meine Arbeiten zu Shakespeare aus den letzten drei Jahrzehnten zusammengestellt. Dies geschah unter der Prämisse, dass es unzählige Zugänge zu Shakespeare gibt. Darunter verborgen befindet sich aber auch die Möglichkeit, aus wenigen Texten die Auffassung Shakespeares von der Welt und vom Menschen zu erschließen. Der Dichter legt bekanntlich keine theoretischen Auseinandersetzungen vor. Er tut etwas anderes: er erschafft mit seinen in sich vernetzten Dichtungen, vor allem mit seinen dramatischen Werken eine komplexe Welt, die weder einer plakativen Ideologie verpflichtet ist, noch ihrer bedarf. Shakespeare zeigt eine unglaubliche Vielfältigkeit und Spannweite menschlichen Denkens, Handelns und Empfindens. Dabei eröffnen sich dem Zuschauer wie dem Leser die unendlichen Verstrickungen der Menschen in ihrem Inneren sowie in den Handlungen der Außenwelt. Wie tief Shakespeare auch immer in die Abgründe des Menschen blickt, er gibt keine Definition des Menschen. Wir finden weder die These, dass der Mensch von Natur aus gut sei (so Rousseau im 18. Jahrhundert5), noch die Gegenthese, die Kant vertrat.6 In dem gewaltig differenzierten Spektrum zwischen Gut und Böse findet Shakespeare in seinen Werken immer wieder zu der sinnfälligen Aufforderung, sich um das Gute zu bemühen. Somit durchdringt durchaus ein Bild vom Humanum das gesamte Werk. Daher möchte ich den Gedanken formulieren, dass wir in Shakespeares Werk keine wissenschaftliche Anthropologie finden können, die es im 16. Jahrhundert ja auch noch nicht gab. Was aber ist es, was sich in den Werken gleichsam zwischen den Zeilen abzeichnet? Ich nenne dies Shakespeares poetische Anthropologie.7
Ich bin davon überzeugt, dass Shakespeares Humanum aus den Werken aufscheint, die hier betrachtet werden. Das Frauen- und Menschenbild, das durchaus nicht im Einklang mit den Vorstellungen in seiner Zeit steht, kommt in den beiden ersten Arbeiten zur Sprache, zum einen im 1. Kapitel, welches das Gender-Thema auf der Bühne anspricht und im 2. Kapitel, das an den „Dark Lady“-Sonetten Shakespeares natürliche Vorstellungen von Liebe und Leidenschaft verdeutlicht. In Kapitel 3 über König Lear und Kapitel 4 über den Sturm treffen wir auf Schwergewichte seines dramatischen Werks, in denen der Kampf des Menschen um Humanität und Dignität in den Abgründen politischer Machenschaften, inmitten von Grausamkeit, Betrug und Mord sichtbar gemacht werden. Das letzte und 5. Kapitel des Buches befasst sich mit einer umgekehrten Perspektive. Am Beispiel von Herder wird von Deutschland aus der große englische Dichter beleuchtet, nicht zuletzt aus einer defizitären kulturellen und politischen Situation eines Territoriums heraus, das 1773 noch in Hunderte von Einzelstaaten zerrissen war.
In Kapitel 1, das sich mit Frauenliebe/Männerliebe bei Shakespeare befasst, wird deutlich, dass der Dichter eine offene Sicht auf Geschlechterverhältnisse favorisiert. Shakespeare bedient keine männlichen Vorurteile gegenüber Frauen, welch letztere in seinem dramatischen Werk oft herausragende Persönlichkeiten verkörpern. Das Verbot im elisabethanischen Zeitalter für Frauen als Schauspielerinnen auf der Bühne zu agieren, hatte zur Folge, dass junge Männer Frauenrollen spielten. Die damit verbundenen Verwischungen der Geschlechtsunterschiede sollten nicht abgewertet, sondern eher als frühe Form von Liberalisierung verstanden werden. Das Theatergeschehen überschreitet die etablierte elisabethanische Moral. Auch Shakespeares Sonnets8 zeigen ein Bild seiner Persona, die Gender-Festlegungen relativieren. Frauen- und Männerbilder bei Shakespeare weisen einen weiten Horizont auf.
Kapitel 2 „Love, Lust und Shame in William Shakespeares „Dark Lady“-Sonetten“ zeigt, dass Shakespeares Sonette als poetische Erkundungen von Erotik und Liebe faszinieren – in der Lebenswelt des elisabethanischen Zeitalters. Merkwürdig erscheint dabei, dass die Sitten und Normen der Zeit, selbst die christlichen, in Shakespeares Texten keine Rolle spielen. Vielmehr geht es in den Sonetten um das Erleben des eigenen Selbst und der Umwelt, weitergeführt in eine subjektive Vernetzung von Innenwelt und Außenwelt. Der Dichter entdeckt für die Geliebten und die Gemeinsamkeit mit ihnen eine Privatsprache, die Kommunikation und enigmatische Unaussprechlichkeit umgreift. Was in der Liebe unsagbar ist und auch nicht für andere Augen und Ohren bestimmt ist, wird bei Shakespeare so intensiv in Bildern und Metaphern poetisiert, dass eine alternative Weltsicht im Kontrast zu moralisch definierten Durchschnittsverständnissen aufscheint. Damit verlieren die Liebesökonomie und die -pragmatik ihren dominanten Stellenwert zugunsten einer proto-romantischen Leidenschaftlichkeit, in der die Liebes- und Schönheitsmodelle der Renaissance inklusive des Petrarkismus obsolet geworden sind. Es entsteht ein Ausdruck des Wechselverhältnisses von Lust und Qual mitsamt einer erstaunlichen Frische des lebendigen Gefühls und des Gedankens. Selten wird in der Literatur die Liebe als poetisches anthropologisches Potential so intensiv poetisiert wie in den Sonetten Shakespeares.
Details
- Seiten
- 148
- Erscheinungsjahr
- 2024
- ISBN (ePUB)
- 9783631704226
- ISBN (PDF)
- 9783653067064
- ISBN (Hardcover)
- 9783631672037
- DOI
- 10.3726/978-3-653-06706-4
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2024 (August)
- Schlagworte
- Shakespeare Kritik der politischen Macht menschliche Spannungen emotionale Konflikte Gender und Theater Offenheit des Humanen menschlichen Grausamkeiten poetry unlimited
- Erschienen
- Berlin, Bruxelles, Chennai, Lausanne, New York, Oxford, 2024. 148 S.
- Produktsicherheit
- Peter Lang Group AG