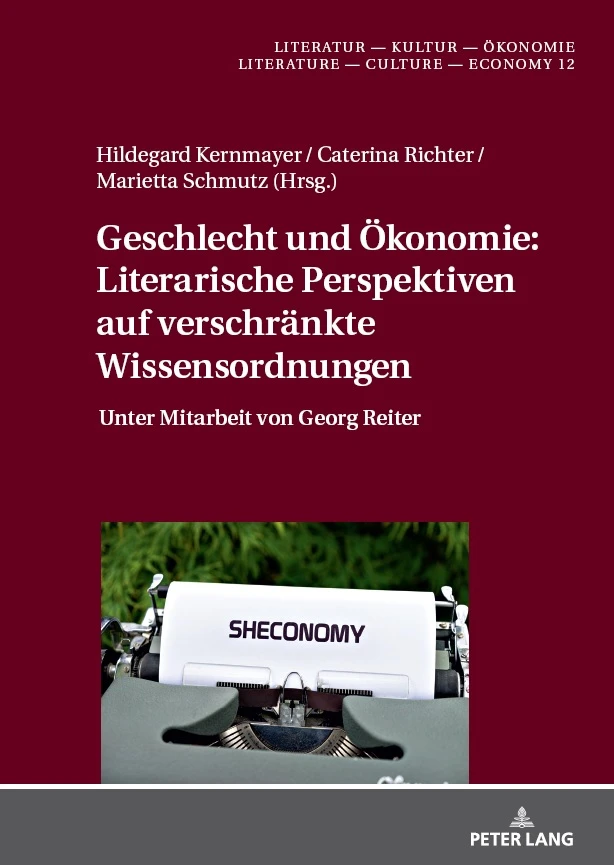Geschlecht und Ökonomie: Literarische Perspektiven auf verschränkte Wissensordnungen
Unter Mitarbeit von Georg Reiter
Summary
Excerpt
Table Of Contents
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Inhaltsverzeichnis
- Verschränkte Wissensordnungen. Literatur – Geschlecht – Ökonomie
- I. ‚Weibliche‘ Ökonomie schreiben: Cixous – Bachmann – Jelinek
- Hélène Cixousʼ libidinöse Ökonomien: Schreiben anders denken
- (Sprach-)Körper und Kapital: Zum Spannungsfeld von Ökonomie und Gender im Werk Elfriede Jelineks
- II. Geschlechterökonomie im ‚Neoliberalismus‘: Körper – Markt – Technologie
- Zur Produktivität der Maskerade. Ökonomisierte Kunstwelten in Marlene Streeruwitz’ Roman Nachkommen.
- Das ästhetische Spannungsfeld von Digitalität, Ökonomie und Gender bei Stefanie Sargnagel. Eine praxisorientierte Annäherung
- Zwischen Hoffnung und Enttäuschung. Reproduktionsmedizin und (Un-)Fruchtbarkeit im neoliberalen Kontext
- Von der Angst vor dem Fall zur Sehnsucht nach dem Sprung. Aspekte der Depression in weiblichen, prekären Lebenswelten in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur
- III. Der ökonomische Mikrokosmos der bürgerlichen Familie: Kapitalismus – Klasse – Geschlecht
- The Gelding of Free Will in Lenz’s Hofmeister
- Autor_innenverzeichnis
- Reihenübersicht
Hildegard Kernmayer / Georg Reiter / Caterina Richter / Marietta Schmutz
Verschränkte Wissensordnungen. Literatur – Geschlecht – Ökonomie
Abstract: The article explains the emergence of modern knowledge systems while tracing the connections with the capitalist merchandise management system. After an in-depth analysis of its effects on lifeworlds and gender relations, it will be shown that the literary-scientific examination of the subject complex of literature, gender, and economy is less advanced than its thematization within the literary texts. Therefore, this article would like to give an overview of the (theoretical) texts that dominate the discourse and show which aspects only come into view when these are taken into account.
Keywords: knowledge systems | literature | capitalism | gender roles
1. Ökonomische Wissensordnungen der Moderne
In seiner Archäologie des Wissens1 aus dem Jahr 1969 fasst Michel Foucault Wissen als die Gesamtheit aller Elemente, die eine diskursive Praxis ausmachen. „Wissen“ – so Foucault – konstituiere sich zuerst durch seine verschiedenen Gegenstände; es sei aber auch „der Raum, in dem das Subjekt die Stellung einnehmen [könne], um von Gegenständen zu sprechen, mit denen es in seinem Diskurs zu tun“2 habe; es sei darüber hinaus „das Feld von Koordination und Subordination der Aussagen, [in dem] die Begriffe erscheinen, bestimmt, angewandt und verändert“3 würden; schließlich definiere sich Wissen „durch die Möglichkeiten der Benutzung und der Aneignung“4, die der Diskurs offeriere. Foucault zufolge existiert mithin „kein Wissen ohne definierte diskursive Praxis; und jede diskursive Praxis kann durch das Wissen bestimmt werden, das sie formiert“5. Obwohl unterschiedliche Wissensordnungen unterschiedliche Formen der sprachlich-symbolischen Artikulation und Repräsentation entwickeln und privilegieren, stehen sie in komplexen Austauschbeziehungen zueinander. Folgt man Joseph Vogl und Burkhardt Wolf, so sind es vor allem „die Mechanismen ihres Zusammenhangs und ihrer Resonanz“, die über die „Wirksamkeit von Wissensordnungen entscheiden“.6
Die Verschränkung ökonomischer wie literarischer Wissensordnungen ist Gegenstand zahlreicher rezenter literatur- und kulturwissenschaftlicher Untersuchungen.7 Diese konstatieren in der Engführung der beiden Diskursfelder strukturelle und inhaltliche „Homologien zwischen literarischen und ökonomischen Repräsentations- und Zirkulationsweisen“8; sie untersuchen die Rolle literarischer Texte als Multiplikatoren jener Wissensordnung, die ‚das Ökonomische‘ zur grundlegenden Kategorie der modernen Episteme erhoben hat. Sie begreifen Literatur aber auch als jenen Ort, an dem die Dominanz ökonomischer Denkfiguren auch in vordergründig ökonomiefernen Diskursen, deren Unterwerfung unter die kapitalistischen Logiken der Produktion, Distribution und Konsumtion, entlarvt bzw. ästhetisch unterlaufen wird. Dass sowohl der Wissensordnung des Ökonomischen wie auch der des Literarischen immer auch die Kategorie des Geschlechts eingeschrieben ist, wurde von den einschlägigen wissenspoetologischen Untersuchungen im Schnittfeld von Literatur und Ökonomie weitgehend außer Acht gelassen.9 Auch die literatur- und kulturwissenschaftliche Geschlechterforschung, die Fragen des Geschlechts tendenziell jenseits seiner ökonomischen Bedingtheiten erörtert, zeigte sich bis vor kurzem an der wechselseitigen Durchdringung von ökonomischem Wissen und Geschlechterwissen uninteressiert. Dies erstaunt insofern, als bereits die feministische Geschichtswissenschaft10, die in den 1970er Jahren die Ausformung der binären bürgerlichen Geschlechterordnung untersuchte, diese als Resultat einer beginnenden funktionalen Ausdifferenzierung der gesellschaftlichen Teilbereiche auswies, in deren Folge öffentliche und private Sphäre voneinander geschieden wurden. Als Sphäre des sich herausbildenden modernen Staates ist die öffentliche Sphäre von Anbeginn an ‚männlich‘ konnotiert. Mit ihr verbinden sich Konzepte von Rationalisierung, Professionalisierung und Produktion. Die private Sphäre dagegen ist als Sphäre der bio-sozialen Reproduktion der Raum des ‚Weiblichen‘. Dieses wird im patriarchalischen Imaginären metaphorisch mit dem Verdrängten identifiziert, mit dem Leib, dem Begehren, der Phantasie, den Gefühlen, dem Unbewussten, kurz: mit jenem „Anderen der Vernunft“11, das das moderne Individuum im Zuge der neuzeitlichen Rationalisierungs- und Modernisierungsprozesse sukzessive von sich abspaltet. Die Entstehung der neuen (bürgerlichen) Geschlechterordnung dankt sich mithin der Entstehung der arbeitsteiligen ökonomischen Ordnung. In dieser entscheidet – so Franziska Schößler in ihrer 2017 erschienenen Studie Femina Oeconomica – die Geschlechtszugehörigkeit „über den Zugang zu Tätigkeitsbereichen, die ihrerseits die binäre Geschlechterordnung performativ reproduzieren und Ressourcen (wie Anerkennung und Geld) asymmetrisch verteilen“12. Dass dabei die „Sphäre wirtschaftlicher Produktivität [selbst] als geschlechtsneutral aufgefasst“ wird, dankt sich Schößler zufolge der Bestimmung der ‚männlichen‘ Position als „geschlechtsneutral, als Repräsentation des Menschen an sich“.13 Dabei wird die Wirtschaft wie die Familie – später auch die Religion, die Kunst und die Wissenschaft – vorerst der privaten Sphäre zugerechnet, insofern sie idealiter dem Zugriff des Staates entzogen ist.14 Gleichzeitig wird die moderne Ökonomie als ein Ordnungskonzept entworfen, in dem – wie Joseph Vogl ausführt – vormoderne Vorstellungen von einer „göttliche[n] Ökonomie“, die sich in der „natürliche[n], unwandelbare[n], wesentliche[n]“ Weltordnung spiegle, säkularisiert werden.15 Unterliegt in den christologischen Auffassungen die Verteilung der Güter noch der göttlichen Vernunft und Vorsehung, so erweist sich diese im „‚ökonomischen‘ Ordnungswissen“16 der rationalistisch-aufklärerischen Moderne – Vogl spricht von „Oikodizee“17 – als Effekt einer rationalen Ordnung, die nunmehr der ‚Natur‘ innewohne. Die vernünftigen Beziehungen der Dinge der ‚Natur‘, deren ‚rationale Ordnung‘ zu erkennen und im Bereich der Kultur, mithin der Ökonomie, zu wiederholen, wird zur zentralen Aufgabe einer aufgeklärten bürgerlichen Gesellschaft.
Als eine Leitfigur der neuen Ordnung steigt seit dem 18. Jahrhundert die Figur des homo oeconomicus auf.18 Dieser Idealtypus des wirtschaftlich agierenden Menschen trifft seine Entscheidungen rational-ökonomisch kalkulierend und ist gleichzeitig von einem eigennützigen Streben nach Gewinn getrieben. In der Synthetisierung und Harmonisierung19 von rationalem Kalkül und leidenschaftlichem Begehren20 gelangt der homo oeconomicus zum bürgerlichen Ideal des ‚juste milieu‘. Das Ringen um dieses Ideal findet sich in der Literatur des 18. Jahrhunderts vielfach verhandelt, sei es in Defoes Roman Robinson Crusoe, in dem die „Abenteurermentalität“ der Hauptfigur mit einer „durchaus religiös motivierten Nutzbarmachung von Zeit, Natur und Menschen“ verbunden wird,21 sei es in Goethes Bildungsroman Wilhelm Meisters Lehrjahre, in dem das (selbst-)disziplinatorische und asketische „Leistungsethos des homo oeconomicus“22 zur Kardinaltugend der bürgerlichen Lebensform avanciert. Jenseits „der lange vorherrschenden Deutungsmuster der ökonomischen Idyllik“23, die Felix Maschewski etwa noch in Gustav Freytags fragwürdigem Bildungsroman Soll und Haben (1855) ausmacht, erweist sich die Auseinandersetzung mit der modernen ökonomischen Ordnung seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts als zunehmend kritisch. Angesichts voranschreitender Industrialisierung und der damit einhergehenden sozioökonomischen Verwerfungen erscheint nach 1848 der homo oeconomicus vor allem in der Gestalt des „Kapitalisten“24, dessen Funktion in den unterschiedlichen Bereichen der modernen Zirkulationssphäre – Warenverkehr, Konsum, Bankwesen, Kreditwirtschaft, Börsengeschehen, Spekulation – insbesondere die Erzählliteratur verstärkt in den Blick nimmt.
Die im Literarisch-Künstlerischen formulierte Kritik an der modernen ökonomischen Ordnung entspinnt sich parallel zu ihrer Theoretisierung in der frühen Soziologie und der Politischen Ökonomie. Dabei wird sowohl in den literarischen als auch in den wissenschaftlichen Deutungszusammenhängen die Struktur des modernen Kapitalismus, dessen Verkettung mit Prozessen der rationalen Rechtfertigung, als genuin ‚moderne‘ Struktur ausgewiesen. Entsprechend verlaufen auch kapitalismuskritische und modernekritische Argumentationsmuster häufig parallel. So firmieren etwa in der marxistischen Kritik Abstraktheit, Unfassbarkeit, Universalität und Mobilität als jene Phänomene, die aus den modernen Produktions- und Warentauschprozessen resultieren; es sind die Eigenschaften des Geldes und sie charakterisieren somit die verdinglichten Sozialbeziehungen, die „nicht als unmittelbar gesellschaftliche Verhältnisse der Personen in ihren Arbeiten, sondern als sachliche Verhältnisse der Sachen“25 erscheinen. Nach Marx sind Ware und Geld Erscheinungsformen der dialektischen Einheit von Wert und Gebrauchswert und als ökonomische Phänomene gesellschaftlich bestimmt.26 Als ‚Gebrauchswert‘ verkörpert Ware vergegenständlichte, konkrete Arbeit; in der abstrakten Dimension des ‚Wertes‘ trägt sie aber auch die gesellschaftlichen Verhältnisse als Objekt in sich. Vordergründig manifestiert sich Ware jedoch nur als Gebrauchsgegenstand, also als Ausdruck ihres Gebrauchswertes. Aufgrund der Reduktion der Ware auf ihre Stofflichkeit und Dinglichkeit, des Wegfalls der abstrakten gesellschaftlichen Dimension in ihrer Entäußerung, erscheint das Geld in der gesellschaftlichen Wahrnehmung als einziger Ort des Wertes, „als Manifestation des ganz und gar Abstrakten anstatt als entäußerte Erscheinungsform der Wertseite der Ware selbst“27. Die Universalisierung der kapitalistischen Produktionsweise macht diese Wahrnehmungsform universell. Sie bestimmt die gesellschaftlichen Beziehungen, die sich in ihrer Verdinglichung als Antinomie zwischen Geld als alleinigem Ort des Abstrakten und konkreter stofflicher Natur präsentieren. Demgegenüber wird die Ware als Ort des Konkreten, als ein scheinbar homogenes, in sich identisches Phänomen konstruiert und fetischisiert.
Abstraktheit, Unfassbarkeit, Universalität und Mobilität, die die Politische Ökonomie als Eigenschaften des Geldes ausweist, erscheinen in populären modernekritischen Diskursen – seien sie kulturpessimistisch, kapitalismuskritisch oder antisemitisch – als Kennzeichen des Modernisierungsprozesses. Den als entfremdet und abstrakt empfundenen gesellschaftlichen Verhältnissen setzen diese Diskurse als konkretes Gegenprinzip28, mithin als Remedium gegen die ‚Pathologie‘ der Moderne den Entwurf des Fetischs entgegen. Als Bestandteil rückwärtsgewandter Kapitalismuskritik ist – folgt man Moishe Postone – die Proklamierung des Fetischs immer auch antisemitisch. Die Gleichsetzung des Judentums nicht nur – wie in vorindustrieller Judenfeindschaft – mit der Zirkulationssphäre, also mit dem Geld, sondern mit dem als abstrakt bewerteten Kapitalismus im Allgemeinen lässt Jüdinnen_Juden zu mehr als nur zu Repräsentant_innen des Kapitals werden. Die Tendenz zu Fetischisierung – auch des Abstrakten – macht sie vielmehr „zu Personifikationen der unfaßbaren, zerstörerischen, unendlich mächtigen, internationalen Herrschaft des Kapitals“29, zur Verkörperung des Abstrakten schlechthin. Die antisemitische Grundierung von modernekritischer Kapitalismuskritik zeigt sich in den zahlreichen antisemitischen Schriften, die seit dem Börsenkrach 1873 und bis in die Zeit des Nationalsozialismus erscheinen, von Otto Glagaus zuerst in der Gartenlaube veröffentlichten massenwirksamen antisemitischen Pamphleten, die er 1876 unter dem Titel Der Börsen- und Gründungs-Schwindel in Berlin in Buchform herausgibt, über die Abhandlung des Soziologen und Ökonomen Werner Sombart Die Juden und das Wirtschaftsleben aus dem Jahr 1911 bis hin zu den 1925 veröffentlichten Protokollen der Weisen von Zion. Das Welteroberungsprogramm der Juden. Doch auch die Literatur perpetuiert in der Thematisierung der Börse als Ort ‚jüdischer‘ Spekulation das Bild vom unproduktiven Kapitalismus als ‚jüdisch‘. Franziska Schößler zeigt in ihrer Studie Börsenfieber und Kaufrausch aus dem Jahr 2009, in der sie u. a. Theodor Fontanes 1882 erschienenen ‚Börsenroman‘ L’Adultera, Heinrich Manns antisemitische Gesellschaftssatire Schlaraffenland aus dem Jahr 1900 und Thomas Manns Buddenbrooks. Verfall einer Familie (1901) einer diskursanalytischen Lektüre unterzieht, dass die vergleichsweise neuen Produktions- und Konsumationsformen, wie sie sich in der Börse und im Kaufhaus manifestieren, im gesellschaftlichen Imaginären indes nicht nur ‚jüdisch‘, sondern auch ‚weiblich‘ semantisiert sind.30 Gerade in den Bildern des enthemmten Kaufrauschs oder der Finanzmärkte als hysterische verführerische Frau äußert sich das ‚Irrationale‘ des ungezügelten Konsums, aber auch der Spekulation. Diesen gleichermaßen als ‚weiblich‘ und ‚jüdisch‘ ausgewiesenen Figuren setzt das literarische Repräsentationssystem – so Schößler – die Konstruktion eines „männlich-rationale[n] Wirtschaftsakteur[s]“ entgegen, der den Verführungen des Konsums und der Spekulation „durch ebenso geplant-kontrollierte wie kompetente Operationen widersteht“.31
2. Ökonomische Wissensordnungen der späten Moderne – Individuum, Freiheit, Markt als neoliberale Denkfiguren
Mit der Universalisierung der kapitalistischen Produktions- und Konsumtionsweise avanciert auch deren Logik der Versachlichung und Rationalisierung zur dominierenden Logik moderner Existenz schlechthin, eine Entwicklung, die bereits die frühe Soziologie beobachtet und mit den Begriffen der ‚Versachlichung‘ bzw. ‚Verdinglichung‘ belegt. Georg Simmel zufolge ist es der Geist der „reine[n] Sachlichkeit in der Behandlung von Menschen und Dingen“32, der die moderne Geldwirtschaft erst ermöglicht. In seiner 1900 erschienenen Schrift Philosophie des Geldes konstatiert er entsprechend: „Das Geld stellt Handlungen und Verhältnisse des Menschen so außerhalb des Menschen als Subjektes, wie das Seelenleben, soweit es rein intellektuell ist, aus der persönlichen Subjektivität in die Sphäre der Sachlichkeit, die es nun abspiegelt, eintritt.“33 Zwei Jahrzehnte später bestimmt Georg Lukács die Warenform als „Urbild aller Gegenständlichkeitsformen und aller ihnen entsprechenden Formen der Subjektivität in der bürgerlichen Gesellschaft“34. Es liege im „Wesen der Warenstruktur“, dass jede „Beziehung zwischen Personen den Charakter einer Dinghaftigkeit“ annehme und so einer „strengen, scheinbar völlig abgeschlossenen und rationellen Eigengesetzlichkeit“ unterworfen werde.35
Ab dem Ende der 1970er Jahre und bis zur Finanz- und Wirtschaftskrise im Jahr 2008/2009 vollzieht sich innerhalb der globalen Ökonomie ein Paradigmenwechsel. Der Neoliberalismus, der seit den 1930er Jahren lediglich als intellektuell-politisches Projekt einer kleinen Gruppe von Ökonomen, Politologen, Sozialphilosophen, Politikern und Journalisten existierte, erhält realpolitische Bedeutung.36 Vorerst als wirtschaftsliberaler Gegenentwurf zu den ‚Kollektivismen‘ des Sowjetkommunismus und des Faschismus (sowie der ‚New Deal‘-Politik) konzipiert, positioniert sich der Neoliberalismus in der Folge aber auch gegen die in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg außerhalb der kommunistischen Machtsphäre vorherrschenden keynesianischen Ideen der Sozialstaatlichkeit. Die wirtschaftspolitischen Konzepte des Keynesianismus, denen zufolge ein intervenierender Staat mittels ‚Nachfragepolitik‘, die nicht Unternehmen, sondern die Kaufkraft von Konsument_innen befördert, für Vollbeschäftigung und wirtschaftlichen Aufschwung sorgen soll, weichen im Zuge der Liberalisierung der global dominierenden Volkswirtschaften – eine Reaktion auf die Krise des Keynesianismus angesichts von hoher Inflation und Arbeitslosigkeit sowie rückläufigem Wirtschaftswachstum in den 1970er Jahren – sukzessive dem neoliberalen Bekenntnis zu Vermarktlichung, Deregulierung, Privatisierung und damit auch Responsibilisierung.37
Die neoliberale Transformation der ökonomischen Ordnung in der späten Moderne manifestiert sich dabei nicht nur in wirtschafts- und sozialpolitischen Entscheidungen, sie zeitigt vielmehr Auswirkungen auf die Entstehung neuer Subjektkonzepte und Denkfiguren. Hat die moderne Ökonomie bereits im 18. Jahrhundert die Leitfigur des homo oeconomicus als ideales Wirtschaftssubjekt hervorgebracht, das seine (nicht nur) ökonomischen Entscheidungen rational kalkulierend trifft, so entsteht unter den Bedingungen der global wirkmächtigen Marktökonomie das Konzept eines Subjekts, das sein Selbstbild entlang internalisierter „Marktlogiken“ entwirft und auch sein Umfeld nach deren Parametern beurteilt. Diese Form der ‚Subjektivierung‘ wird in der Philosophie und Politischen Ökonomie nicht mehr vor dem Hintergrund des marxistischen Begriffs der Verdinglichung, sondern vor dem der ‚Gouvernementalität‘ verhandelt, mit dem Michel Foucault die strukturelle Verflochtenheit von institutioneller Herrschaft eines Staates und den Techniken der Selbstregierung von Individuen bezeichnet und den er 1978 in seiner Vorlesungsreihe Sicherheit, Territorium, Bevölkerung am Collège de France einführt.38
Im Mittelpunkt sowohl des neoliberalen Selbstentwurfs wie auch von Foucaults Auseinandersetzung mit diesem steht der Begriff der Freiheit. Positioniert sich der Neoliberalismus als eine „Denkrichtung des Liberalismus, die eine freiheitliche markwirtschaftliche Wirtschaftsordnung mit den entsprechenden Gestaltungsmerkmalen wie privates Eigentum an den Produktionsmitteln, freie Preisbildung, Wettbewerbs- und Gewerbefreiheit anstrebt“, deren Funktionsfähigkeit – zumindest in ihrer ordoliberalen Variante – jedoch „durch staatliche Überwachung der Monopole und Kartelle und durch andere marktkonforme Maßnahmen gesichert“ wird,39 so firmiert er bei Foucault als eine „Rationalität des Regierens“, die sich – folgt man Georg Simmerl – „im Wissen der klassischen Politischen Ökonomie, im von ihr errichteten ‚Wahrheitsregime‘ des Markts, begründet“.40 Als eine Technik des Regierens, die Subjektivität, also ein Sich-selbst-Regieren, und politische Herrschaft, also ein Regiert-Werden, integriert, versteht es der Neoliberalismus, „die Freiheit der Individuen als Kalkül einzusetzen“41. Das Individuum begreift sich – so auch Nikolas Roses Foucault-Lektüre – als autonom und selbstbestimmt.42 Sich gleichermaßen selbst regierend, hat es die gesellschaftlichen Normen und Wertvorstellungen jedoch längst internalisiert43 und gliedert sich ohne offenkundigen äußeren Zwang in das Gefüge der Machtbeziehungen ein. Zwang ist damit nicht mehr – wie auch Byung-Chul Han in seinem kontrovers diskutierten Essay Psychopolitik zeigt – ein Effekt einer externalisierten, sondern vielmehr einer internalisierten Machtstruktur. Im vermeintlich freien Handlungsraum unterwirft sich das Individuum „inneren Zwängen und Selbstzwängen in Form von Leistungs- und Optimierungszwang“.44
Anders als im bürgerlichen Liberalismus des 19. Jahrhunderts wird im neoliberalen Denksystem Freiheit mit wirtschaftlicher Freiheit gleichgesetzt. Zwang liegt diesem Verständnis zufolge „nur dann vor, wenn es kollektiven Akteuren gelingt, in die ökonomischen Macht- und Verteilungsverhältnisse einzugreifen“45. In diesem Sinne bezeichnet etwa Friedrich August von Hayek die „Entthronung der Politik“46 als ein Kernanliegen des Neoliberalismus, das sich als weitgehender Rückzug des öffentlichen Sektors aus dem Markt konkretisieren soll. Mit der Verengung des Freiheitsbegriffs entfernt sich der Neoliberalismus „von den emanzipatorischen Wurzeln des bürgerlichen Liberalismus“47. Wirtschaftsfreiheit ist, wie Ralf Ptak zeigt, auch innerhalb illiberaler politischer Systeme möglich.48 Insofern sich Freiheit im Neoliberalismus auf die „Nichtdiskriminierung der Marktteilnahme“49 zu beschränken scheint, bemessen sich auch ihr Vorhandensein und ihre Qualität nach den Möglichkeiten der Marktteilnahme. Da der Markt nicht nur als Ort der Freiheit, sondern auch als Ort der Leistungsgerechtigkeit gilt, versteht sich das Subjekt in seiner Entscheidung für eine an marktlogischen Normen ausgerichtete Lebensweise, die ihm stetige Selbstoptimierung auferlegt, als frei agierendes. Immer neue und scheinbar bessere Ziele zu verfolgen, wird damit zur Grundlage der Subjektivierung – nach Foucault jener „Formungsprozess, bei dem gesellschaftliche Zurichtung und Selbstmodellierung in eins gehen“50 und der sich als ständig weiterzuentwickelndes ‚Projekt‘ erweist.51 Im Prozess der Subjektivierung entwirft sich das Selbst entsprechend als „unternehmerisches Selbst“52, als allzeit in das eigene „Humankapital“53 investierende_r Kapitalist_in, deren_dessen Handeln sich am größtmöglichen Nutzen für sich selbst und nicht an einem kollektiven Ideal orientiert54 und der_die sich selbst hinsichtlich ihrer_seiner Markttauglichkeit bewertet. Der Vermarktlichung unterliegen in der späten Moderne jedoch nicht nur Subjekte, sie wird vielmehr zum dominanten Strukturprinzip von zuvor nicht-marktlich oder nur teilweise marktlich koordinierten gesellschaftlichen Feldern55, wie etwa dem Gesundheitswesen, der Bildung56, der Kunst57 oder auch zwischenmenschlichen Beziehungen58.
Mit der Verlagerung der ‚Agency‘, also der individuellen Handlungsperspektiven, in den Kontext des Marktes werden auch Mechanismen der Responsibilisierung wirksam, die auf die aktive Selbststeuerung der Subjekte, mithin ihre Eigenverantwortung abheben. Eigenverantwortung ist in diesem System das Ergebnis rationaler Überlegungen und integraler Bestandteil von Kosten-Nutzen-Rechnungen; ihre Relevanz jedoch wird Individuen mittels emotionalisierter Botschaften59 suggeriert. Die Antinomie zwischen ökonomischem Kalkül einerseits und Emotionalität andererseits vermögen sowohl die moderne als auch die postmoderne Wissensordnung aufzulösen. Während die bürgerliche Figur des homo oeconomicus einem Ideal der Ganzheit folgend Kalkül und Leidenschaft60 noch synthetisiert, versteht es die neoliberale Marktökonomie, Gefühle produktiv für ihre Zwecke einzusetzen, indem sie diese selbst zu ‚Waren‘ macht.61 Im Band Wa(h)re Gefühle. Authentizität im Konsumkapitalismus zeichnet die Soziologin Eva Illouz den Konnex von spätmodernen Gesellschaftsstrukturen und dem Erleben der Einzelnen innerhalb eines vom Kapitalismus geprägten ‚Erlebnismarkts‘ nach. Unter den Bedingungen eines ‚emotionalen Kapitalismus‘, der Illouz zufolge durch die Verflechtung von individuellen emotionalen und ökonomischen Diskursen geprägt ist, können und sollen Lebens‚projekte‘ sowohl ökonomisch-rational als auch emotional sein. Die Emotionalisierung des Ökonomischen und die Ökonomisierung von Emotionen setzen eine Umwertung des Begriffs der Emotion voraus: Wurden Emotionen im Zuge der Ausdifferenzierungsprozesse moderner Gesellschaften abgewertet, weil sie der Rationalität und damit dem vernünftig handelnden Individuum entgegengesetzt zu sein schienen, so wird in der späten Moderne – folgt man Andreas Reckwitz – der ‚professionelle‘ Umgang mit Gefühlen (sowohl mit den eigenen als auch mit denen anderer Personen) als Zeichen ‚emotionaler Intelligenz‘ besonders in Projektkollektiven als erstrebenswert angesehen.62 Als das ‚Andere‘ der rationalen (ökonomischen) Ordnung, dem das Potential zugeschrieben wurde, diese zu unterwandern, erfahren Emotionen nunmehr ihre Indienstnahme für das neoliberale Projekt. Mindfulness- und Achtsamkeitstrends63 oder etwa die Positive Psychologie, die die von ihr erkannten vier Schlüsselressourcen „der Hoffnung, Selbstwirksamkeit, Resilienz und des Optimismus wissenschaftlich und wirtschaftlich betrachtet“64, erweisen sich als Instrumente zur Kanalisierung und Vermarktung des dem Markt vermeintlich diametral Entgegengesetzten.
3. Geschlecht und neoliberale Ökonomie
Die neoliberale ökonomische Ordnung, die „Freiheit, Selbstverantwortung, Autonomie und Risikobewusstsein“65 als zentrale ‚Tugenden‘ von Wirtschaftssubjekten voraussetzt, begreift sich als geschlechtsneutral. Nichtsdestotrotz sind ‚männlich‘ bzw. ‚weiblich‘ konnotierte Wirtschaftssubjekte von einer gleichrangigen Marktteilnahme auch in der neoliberalen Wirtschaftsordnung weit entfernt. Die Gründe dafür sind vielfältig. Sie finden sich, folgt man der feministischen Ökonomik, zunächst in der „androzentrische[n] Ausrichtung von Wirtschaftstheorien und -analysen“66. So wirke beispielsweise in der neoklassischen Theorie das Verhaltensmodell der bürgerlichen Geschlechterordnung bis heute fort. In dieser stehe einem nach dem Modell des homo oeconomicus geformten und ‚männlich‘ gedachten Wirtschaftssubjekt, das in der Produktion von Gütern und Kapital rational im Sinne einer Kosten-Nutzen-Abwägung verfährt, ein als abhängig, emotional und altruistisch bestimmtes ‚weibliches‘ Subjekt gegenüber, dem die Reproduktion bzw. die Erhaltung von Haus und Familie überantwortet wird.67 Diese geschlechtsstereotype Denkfigur schlägt sich in der ungleichen Verteilung von Finanz- und Realkapital ebenso nieder wie in der ungleichen Verteilung und Bezahlung von Arbeit – Verteilungsungleichheiten, die mit dem Begriff des ‚Gender Gaps‘ gefasst werden, dessen prominentester der Gender Pay Gap ist. Dieser wiederum resultiert, wie die Ökonomin Margareta Kreimer herausgearbeitet hat, aus Ungleichheiten etwa in der Beschäftigung, der Aufstiegsmobilität, im Beschäftigungsausmaß oder dem Ausmaß von Betreuungsarbeit und findet seine Fortsetzung im ungleichen Zugang zu den Systemen sozialer Sicherung.68
Ein Faktor, der die Einkommensunterschiede zwischen männlichen und weiblichen Arbeitnehmer_innen befördert, ist das Beschäftigungsausmaß. Für Österreich etwa gilt, dass Ende 2020 Männer mehr als doppelt so häufig vollzeitbeschäftigt waren wie Frauen.69 Seit Mitte der 1980er Jahre konstatiert die sozio-ökonomische Forschung die Feminisierung der Arbeit70, also die Zunahme der Erwerbstätigkeit von Frauen. Ein diachroner Blick auf die Erwerbstätigkeit seit 1994 bestätigt jedoch die Annahme, dass Frauen heute insgesamt zwar mehr Erwerbsstunden denn je leisten71, jedoch nicht als Vollbeschäftigte. Die Teilzeitquote bei Frauen ist in den letzten 26 Jahren um fast 25 % auf insgesamt 48,2 % gestiegen; die der Männer von nur 3 % auf 10 %.72 Mit dem Begriff der Feminisierung der Arbeit wird aber auch die Fragmentierung auch männlicher Erwerbsbiographien bezeichnet, d. h. eine allgemeine Tendenz hin zu Teilzeitbeschäftigung, geringfügigen und atypischen Beschäftigungsverhältnissen.73 Arbeitgeber_innen bietet sich durch diese ‚flexiblen‘ Beschäftigungsverhältnisse die Möglichkeit, „die Belegschaften schnell an gewandelte Markterfordernisse anzupassen oder Produktionsspitzen abzufedern“74. Die Anpassung des Arbeitsmarkts an die Bedingungen der Globalisierung führte etwa in den meisten Regionen Deutschlands zu einem Rückgang der Arbeitslosigkeit, einer Erhöhung der Beschäftigungsquote und zu wirtschaftlichem Wachstum. Die EU-Spitze beim Bruttoinlandsprodukt75 verdankt sich also einer – verstärkt weiblichen76 – Prekarisierung der Arbeitsverhältnisse.
Auch in der feministischen Geschlechterforschung wird der Annahme, der Neoliberalismus als Ideologie betreffe das Individuum als Ganzes, weitgehend zugestimmt.77 Wird der Nationalstaat in seiner wirtschaftspolitischen Steuerungsfunktion zugunsten des freien Wettbewerbs zurückgestuft, so werden das Konkurrenzprinzip und die vermeintlich gerechte Ausgleichswirkung der Märkte nicht nur zum gesellschaftlich, sondern auch zum individuell akzeptierten Ordnungsprinzip.78 Allen voran, so Gabriele Michalitsch, werde die „[n]eoliberale Domestizierung des Subjekts“79 im Hinblick auf das Verhältnis der Geschlechter wirksam. Nach dem Motto jede_r kann es schaffen verspricht die neoliberale Erzählung – bei ausreichend starkem Willen zum Erfolg – gleiche Chancen für alle und bekräftigt ihr Versprechen mittels einzelner Aufstiegserzählungen. Dabei werden in der medialen Öffentlichkeit emanzipatorisch-identitätspolitische Anliegen sozialer Minderheiten aufgegriffen und als Zeichen sozialen Fortschritts in marktkonformen Bildern von Diversität präsentiert. Mit diesen Bildern gehen jedoch keine wirksamen Handlungen hinsichtlich sozialökonomischer Chancengleichheit einher. Auch wenn Bilder von sexueller und geschlechtlicher Vielfalt bereits im ‚Mainstream‘ (beispielsweise in Radio, Werbung oder Film) angekommen und akzeptiert sind, beobachtet Antke Engel, dass zu oft verabsäumt werde, auf strukturelle Unterdrückungsmechanismen oder Gewaltverhältnisse wie Sexismus, Körpernormativität oder ökonomische Ausbeutung hinzuweisen80. Den Grund sieht auch Engel in der zunehmenden Vereinzelung des wirtschaftlichen Subjekts: „Gemäß einem neoliberalen Individualisierungsparadigma ist es die Aufgabe jede_ Einzelnen, das Beste aus den eigenen Lebensbedingungen zu machen, aber nicht gesellschaftliche Aufgabe, gute Lebensbedingungen für alle zu schaffen.“81
‚Geschlecht‘ galt in der noch strikt differenzfeministisch argumentierenden feministischen Theorie seit den 1970er Jahren als Schlüsselkategorie zur Erklärung von sozialökonomischen Konflikten und Diskriminierung. Die ‚Machbarkeit‘ bzw. die Performativität von Geschlecht wurde erstmals im großen Stil von Judith Butler in Das Unbehagen der Geschlechter (1990) postuliert, die sich gegen die Praxis eines essenziellen Rückgriffs auf einen biologisch-geschlechtlichen ‚Kern‘ ausspricht, da dieser bereits diskursiviert sei. Spätestens seit Ende der 1980er Jahre wurden Formen der Unterdrückung und Benachteiligung auch anhand mehrerer intersektionaler Strukturkategorien82 wie Ethnizität, Klasse, Nationalität, Sexualität, Alter etc. erklärt. Diese ursprünglich politischen Ansätze des Feminismus werden im Neoliberalismus durch differenzierte Macht- und Marktverschiebungen konterkariert. Medial wirksam ist heute eine individualisierte Form des Feminismus, der auf die Stärkung der Autonomie und Ermächtigung der einzelnen Frau abzielt und etwa die Sichtbarkeit von Frauen sowie ihre Partizipation am Arbeitsmarkt, vor allem auch in Führungspositionen propagiert. Das auf den ersten Blick emanzipatorische Anliegen orientiert sich jedoch am souveränen ‚männlichen‘ Wirtschaftssubjekt als Ziel- und Ausgangspunkt der ‚weiblichen‘ Ermächtigung. Dieses Subjekt kann sich aber nur über den Ausschluss eines_r anderen realisieren.83 (Geschlechtsspezifische) Benachteiligung und Diskriminierung erfahren also zunehmend sozioökonomisch schlechter gestellte Frauen, aber auch soziale oder ethnische Minderheiten, die im hegemonial-medialen Diskurs nicht hinlänglich repräsentiert werden.84 Darüber hinaus kann beobachtet werden, dass im globalen Norden Emanzipation immer enger an Konsum(-entscheidungen) gebunden wird, während Feminismus weitgehend von inhaltlichen Positionen entkoppelt zu werden scheint: Diversifizierung und eine oberflächliche Feier der Vielfalt diene vor allem der Zielgruppenerweiterung von Unternehmen wie Facebook, die Personendaten im großen Stil erfassen und verkaufen, so die Standard-Redakteurin Beate Hausbichler.85 In ihrem 2021 erschienenen Buch Der verkaufte Feminismus. Wie aus einer politischen Bewegung ein profitables Label wurde geht es auch um die „Verzahnung von Massenkultur und Feminismus“, im Zuge deren ‚Karrierefrauen‘ gefeiert werden und zu ‚Self-Care‘ aufgerufen wird. An der Vermarktung des Feminismus, allen voran auf online Social Media-Plattformen, könne beobachtet werden, „dass sich der neoliberale Kapitalismus den Feminismus einverleibt“86 hat. Dennoch darf nicht vergessen werden, dass sich mit der Popularisierung feministischer Inhalte über digitale Medien auch deren Sichtbarkeit und Wirksamkeit erhöht, die sich etwa an der steigenden Akzeptanz von geschlechtergerechter Sprache oder auch der verstärkten strafrechtlichen Verfolgung von Delikten sexualisierter Gewalt vor allem seit Beginn der #metoo-Debatte ablesen lässt.
4. Digitale Ökonomie
Die digitale Ökonomie (auch ‚digitaler (Hyper-)Kapitalismus‘87 oder ‚Plattformkapitalismus‘88) versteht sich als eine Strömung der Ökonomie, die sich seit Beginn der Digitalisierung genuin dem Wirtschaftsleben und hier vor allem auch jenem Teil, dessen Geschäfte im Internet abgewickelt werden, verschrieben hat. Sie steht damit dem Ideal einer offenen und gleichrangigen Interaktion, also dem Ideal der ‚Gemeinschaftlichkeit‘89, die aus den geteilten und frei zur Verfügung gestellten Inhalten resultiert und der in den Anfangszeiten des Internets das Potential zugeschrieben wurde, den Beginn eines ,digitalen Postkapitalismus‘ einzuläuten,90 diametral gegenüber. Ziel der digitalen Ökonomie ist es, das Kapital einzelner Unternehmen und Plattformen zu vermehren. Vor allem die Ökonomisierung von Emotionen avancierte dabei zum zentralen Geschäftsmodell. Entsprechend wird in die Weiterentwicklung sozialer Netzwerkplattformen viel Geld und Energie investiert. Kleinste Veränderungen – bereits eine Farbänderung könnte Auswirkungen auf jene Personen haben, die die Website besuchen91 – werden unter Berücksichtigung etwa sozialer und neurologischer Parameter oder auch bekannter Handlungsmuster vorgenommen. Ein konkretes Beispiel dafür ist die Dopaminausschüttung bei positiver Bestärkung, wie sie durch die Bestätigungsfunktionalitäten wie den „Gefällt mir“-Button (Facebook92) oder das Vergeben von Herzen (TikTok oder Instagram) ausgelöst wird. Nutzer_innen werden dazu verleitet, eine Seite wieder und wieder zu besuchen und Inhalte zu verbreiten, die wiederum mehr Herzen/Likes erhalten. Die Dopaminausstöße sind in der Regel kurz und werden auch durch das Entdecken immer neuer Inhalte angeregt, weshalb manche dieser Plattformen verhindern, dass jemals ein Ende der Inhalte (wie beispielsweise bei facebooks Newsfeed) erreicht wird.93 Durch wiederholtes Aufrufen, das Verbreiten von Inhalten und die Tracking-Funktionalitäten94 werden personenbezogene Daten mehr oder weniger freiwillig preisgegeben, damit Inhalte angezeigt werden, die den eigenen Einstellungen und Vorlieben entsprechen. Die geschickte Verflechtung dieser Inhalte mit Werbeinhalten soll den Erwerb von bestimmten Produkten befördern. Doch nicht nur das Konsumverhalten, sondern auch im weitesten Sinne politische Meinungsbildung lässt sich durch das Sammeln von Daten und das Präsentieren von personalisierten Inhalten steuern. Ihren vorläufigen Höhepunkt erreichen digitale Werbestrategien in der Figur des Influencers_der Influencerin. Mittels Selbstnarration werden Persönlichkeiten des öffentlichen Interesses geschaffen, deren Einnahmequelle sich daraus speist, ein besonders großes Publikum zu erreichen, diesem möglichst authentisch Produkte zu zeigen und Bedarf zu schaffen für Gegenstände, von denen das Publikum nicht wusste, dass es sie braucht.95 Influencer_innen erweitern die traditionellen ‚Werbekörper‘ um Personen, die durch ihr besonderes Naheverhältnis zum Publikum dieses leicht beeinflussen können. Die Auswirkungen zeigen sich vor allem bei Jugendlichen, die soziale Netzwerkplattformen deutlich häufiger verwenden. So haben etwa medizinische Studien Zusammenhänge zwischen der Dauer und Intensität der Nutzung von Netzwerkplattformen und dem Anstieg von psychischen Krankheiten nachgewiesen.96 Auch die Veränderung von Körperbildern97 wird auf die spezifische Form der Inszenierung von Körpern in den sozialen Medien zurückgeführt.
Diesbezüglich lassen sich im Digitalen zwei gegenläufige Trends beobachten: auf der einen Seite eine Verstärkung und Zementierung bestehender Bilder von Männlichkeit bzw. Weiblichkeit, auf der anderen Seite eine Pluralisierung der Darstellung gelebter Geschlechtsidentitäten. Die Ästhetik vieler Influencer_innen ist maßgeblich an gängigen Schönheitsidealen ausgerichtet. Gerade Influencerinnen führen ihren Zuseherinnen vor, wie sie sich dem ‚male gaze‘ unterwerfen können bzw. sollen, wie Nymoen/Schmitt beobachten: „Die Influencerinnen gelangen zur Autonomie, indem sie diese ihren Followerinnen verweigern. Die Schminke, […] die Netzstars ihren Fans nahebringen, festig[t] Machtasymmetrien zwischen den Geschlechtern, wirk[t] konservativ, wenn nicht gar reaktionär.“98 Gleichzeitig propagieren ‚männlich‘ gelesene Influencer häufig eine ‚traditionelle‘ Männlichkeit, die sie in martialischem Auftreten und in muskulösen Körpern in Szene setzen und die – so die Botschaft – auf Frauen besonders anziehend wirke.
Umgekehrt lassen sich vielfältige Arten der Aufhebung klassischer Zuschreibungen von Geschlechterrollen finden: von der Metrosexualität eines David Beckham über die Abbildung des einen Rock tragenden Harry Styles auf dem Cover der Vogue bis hin zur Selbstdarstellung der ‚trans_-community‘ auf Plattformen wie Tumblr oder TikTok. Stehen Influencer_innen in der Kritik, Stereotype zu verbreiten, werden in Reaktion auf diese Kritik Postings, Storys oder Videos veröffentlicht, in denen Personen ‚promotet‘ bzw. gelobt werden, die den gängigen Schönheitsidealen nicht entsprechen. Diese Praktiken der ‚body positivity‘ lassen Körpertypen sichtbar werden, die in den dominierenden Zur-Schau-Stellungen von Körperlichkeit gemeinhin unsichtbar sind, und sind insofern subversive Akte, die zur Normalisierung unterschiedlicher Körperbilder beitragen. Dennoch werden diese Körper als ‚anders und trotzdem schön‘ markiert, was zu einer Verfestigung von Alterität und damit verbundenen Stereotypen führen kann. Akzeptanz und Verfestigung geschehen in einer doppelt kapitalistisch geprägten Umgebung: erstens in Form des Generierens von Inhalten für soziale Netzwerkplattformen und zweitens in einer Marktförmigkeit, die von den Unternehmen erkannt wird. Sie reagieren ihrerseits auf derartige Aktionen/Entwicklungen, nehmen Testimonials mit unterschiedlichen Körpermaßen oder Hautfarben in ihre Kampagnen auf, repräsentieren unterschiedliche Lebensweisen und schaffen damit Wahrnehmung im öffentlichen Raum, die kritischen Stimmen zufolge zur nachhaltigen Aufhebung sozialer Ausgrenzung oder substanzieller Benachteiligung jedoch nur einen geringen Beitrag leisten kann.
5. Literaturwissenschaft und Ökonomie
Der Themenkomplex Ökonomie hat in der gegenwärtigen Literaturwissenschaft Konjunktur. Wurde 2004 noch moniert, dass das Forschungsfeld ‚Wirtschaft und Literatur‘ „zu den wenig erforschten Gebieten“99 derselben gehöre und „einschlägige[] stoff- und motivgeschichtliche[] Lexika noch nicht einmal Stichworte wie ‚Wirtschaft‘, ‚Kaufmann‘ oder ‚Unternehmer‘ verzeichnen“100 würden, kann von einer fehlenden wissenschaftlichen Auseinandersetzung mittlerweile keine Rede mehr sein. Unbestreitbar lag das Forschungsfeld in den 1990er Jahren im Vergleich zum anglo-amerikanischen Raum, in dem sich bereits wissenschaftliches Interesse an Fragen am Schnittpunkt von Literatur und Ökonomie unter dem Schlagwort New Economic Criticism formierte,101 noch weitgehend brach. Zwar gab es im deutschsprachigen Raum „Vorreiter“ wie Jochen Hörisch, der sich „in zahlreichen Publikationen dem Zusammenhang von Sprache, Literatur und Geld“ widmete, oder Joseph Vogl, der die „kulturellen und anthropologischen Grundlagen der Figur des homo oeconomicus anhand einer Lektüre einschlägiger literarischer Texte des 18. und frühen 19. Jahrhunderts untersuchte“102. Eine weitreichende Beschäftigung mit dem Thema setzte allerdings erst Mitte der Nullerjahre ein, die bisher nicht nur eine Vielzahl an Aufsätzen und Sammelbänden, sondern auch zahlreiche Monographien hervorgebracht hat, die unterschiedliche Schlaglichter auf den Themenkomplex werfen. Beleuchtet werden unter anderem aus Arbeit resultierende psychische Probleme (wie Erschöpfung, Burnout und Depression)103, Armut104, (Wirtschafts-)Krisen105, der Zusammenhang zwischen Fiktionen und Finanzökonomie106 oder – vereinzelt – die Verflechtungen von Ökonomie und Geschlecht107.
Besonders auffallend ist eine Häufung an Monographien, die ab dem Ende der 2000er Jahre in rascher Abfolge erschienen und sich spezifisch und vorwiegend mit den Arbeitswelten in der Literatur der unmittelbaren Gegenwart (also der 1990er und 2000er Jahre) auseinandersetzen. Als Erster wendet sich diesen 2008 Christian Kremer zu, wobei er in einer Verbindung von Bourdieus Gesellschaftstheorie mit Judith Butlers Theorie der Performativität soziologische und philosophische bzw. gendertheoretische Konzepte aufgreift und sich dem Thema der Arbeit in der Literatur kulturwissenschaftlich annähert.108 Während Kremers Korpus mit nur drei Texten relativ schmal gehalten ist, widmet sich Susanne Heimburger 2010 in der „erste[n] Übersichtsarbeit“ zur gegenwärtigen „Literatur der Arbeitswelt“109 bereits vierzig Texten. Ausgangspunkt ihrer Analysen ist ein „neue[r] Arbeitsbegriff“110, der sich im Zuge der Wandlung der Industrie- zur Informationsgesellschaft herausgebildet hat. Heimburger zeigt u. a., wie die Literatur den neuen Typus des „Arbeitskraftunternehmers“ verhandelt – demnach werde, im Gegensatz zum fordistischen Arbeitsmodell, der Mensch nicht nur in Teilen, sondern zur Gänze gefordert.111 Im Mittelpunkt von Anke S. Biendarras 2012 erschienener Studie steht der Begriff der ‚Globalisierung‘. Sie untersucht Narrative der neoliberalen Arbeitswelten, globaler Reisebewegungen und der ‚Nachwehen‘112 der Anschläge vom 11. September 2001, die sie alle als implizite Kommentare zu den gegenwärtigen Debatten um Prozesse der Globalisierung auffasst, deren tiefgehende Auswirkung auf die ‚kulturelle Topographie‘ sie zeigt. Alexander Preisinger untersucht in seiner Studie aus dem Jahr 2015, in der er strukturalistische Ansätze mit der Interdiskurstheorie zu einer narratologischen Diskursanalyse zusammenführt, wie die Kapitalismuskritik in den 2000er Jahren in literarischen und nicht literarischen Texten sprachlich verhandelt wird.113 Einen literatursoziologischen Zugang wählt 2016 Annemarie Matthies. Sie rückt die Frage nach dem Zusammenhang von Literatur und Wissen ins Zentrum ihrer Untersuchung und erschließt, „was die fiktionale Literatur zwischen 1990 und 2009 über die Arbeitswelt weiß und was sie an Beschreibungen und inhaltlichen Befunden liefert, das auf Grund ihres exklusiven Charakters als besonderes Wissen gelten kann“.114 Juditha Balint wiederum unterzieht 2017 neben literarischen Texten auch Interviews mit Managern aus dem deutschsprachigen Raum einer kulturwissenschaftlichen Lektüre. Basierend auf dem Theorem der Entgrenzung der Arbeit beschreibt sie im Wesentlichen die „Deregulierung der traditionellen Grenze zwischen den Sphären der Arbeit und des Privaten“115. In ihren Ausführungen zeigt sie deutlich, dass diese Entgrenzung sich nicht auf die genuin ökonomische Sphäre beschränkt, sondern auch eine metaphorische und epistemische ist.116 Balint zufolge zeigt sich in verschiedenen Erzählgattungen, dass „die Semantiken der Arbeitswelt“ in die „poetische und die Alltagssprache Einzug“ halten. Arbeit werde dadurch zum „verstehensrelevante[n] Wissensrahmen, durch den die narrative Kohärenz und das Verständnis von Texten bzw. Aussagen über andere Lebensbereiche überhaupt erst gewährleistet“ werde.117
Im Jahr 2019 erschien schließlich im De Gruyter-Verlag das gemeinsam von Joseph Vogl und Burkhardt Wolf herausgegebene beinahe 800 Seiten starke Handbuch Literatur & Ökonomie, das neben Lemmata zu einschlägigen Leitkonzepten der Ökonomie auch exemplarische Analysen umfasst und theoretische Hintergründe erörtert. Evident ist also, dass soziale Verhältnisse eindeutig in den Fokus der Literatur- bzw. Kulturwissenschaften gerückt sind – wenngleich das Interesse vielleicht auch nicht derart groß ist, um dezidiert von einem social oder gar economic turn118 sprechen zu können.
Dem neuen wissenschaftlichen Interesse ging eine nicht zu übersehende „Rückkehr der Arbeit in die Literatur“119 – so der (Teil-)Titel einer Veranstaltung des Leibniz-Zentrums für Literatur- und Kulturforschung im Rahmen seiner Literaturtage – ab Mitte der 1990er Jahre voraus, in der sie im vorhergehenden Jahrzehnt vergleichsweise spärlich vertreten war. Anke Biendarra führt in ihrer Monografie drei plausible Gründe für diesen Sachverhalt an. Erstens habe sich die Vorstellung von Selbstverwirklichung und sinnstiftender sozialer Teilhabe gewandelt: Waren beide zunächst noch mit der Arbeitswelt verbunden, verlagerten sie sich in andere Bereiche wie z. B. neue soziale und ökologische Bewegungen.120 Zweitens sei durch den Wandel der Gesellschaft zur „Erlebnisgesellschaft“, die das „Projekt des schönen Lebens“121 als wichtigstes Ziel verfolge, Selbstverwirklichung mit bestimmten Lebensstilen und dem Erleben von Spaß verknüpft worden, welchem die Arbeitswelt diametral gegenüberzustehen scheint.122 Drittens schließlich habe der augenscheinliche Triumph des Kapitalismus über den Sozialismus vorerst zu einem Rückgang der Kapitalismuskritik geführt.123 Die „Rückkehr der Arbeit in die Literatur“ ab Mitte der 1990er Jahre nahm von den Bühnen ihren Ausgang. Beschäftigten sich zunächst verstärkt Dramatiker_innen mit den Themen Ökonomie, Arbeit, Kampf um Arbeit und Arbeitslosigkeit, folgten wenige Jahre später Prosaautoren und Prosaautorinnen.124 Die Fülle an einschlägigen erzählenden und dramatischen Werken ist nunmehr kaum noch überschaubar. Ein von Christian Kremer bereits 2008 getroffener Befund hat auch heute noch Gültigkeit: Die Protagonist_innen der Werke sind nahezu ausschließlich nicht mehr körperlich Arbeitende wie Bauern oder Arbeiter, einfache Angestellte oder bürgerliche Unternehmer, sondern rekrutieren sich „aus der neuen Elite des Wirtschaftslebens“125, es handelt es sich zumeist um „Kreative, Manager, Junior- und Senior-Consultants, Banker und höhere Angestellte des modernen Dienstleistungssektors“126 oder, wie man mit Erhard Schütz ergänzen muss, um ihre erwerbslosen Pendants127. Vielfach sind die Figuren zwar Iuditha Balints Beobachtungen zufolge in der Arbeitswelt der New Economy zu verorten128, generell gilt jedoch Annemarie Matthies’ Befund, wonach „[a]bgesehen von der Arbeit in der industriellen Produktion […] nahezu jede Sphäre der kapitalistischen Arbeitswelt literarisch“129 dargestellt wird.
Gemeinsam ist den seit der Jahrtausendwende erschienenen Werken, wie die Forschung mehrfach bemerkt hat, dass sie „durchweg[s] kritische Perspektiven auf die Arbeit“130 inszenieren. Häufiges Sujet der seit 1996 erschienenen literarischen Arbeiten, die „von der Ökonomie als gesellschaftlicher Sphäre oder Dispositiv handeln“, ist die Arbeitswelt der New Economy. Die in den Texten konkretisierte Kritik an den Werten der New Economy zielt letztlich „auf eine Kritik des Neoliberalismus“131. Hinsichtlich der die New Economy thematisierenden Literatur muss jedoch ergänzt werden, dass diese das „Primat der Ökonomie“ nicht nur weitgehend unangetastet lässt, sondern es vielfach „narrativ beglaubig[t]“132. Die in den Texten formulierte Kritik gilt den „euphorischen Versprechungen der New Economy“, die „über die Thematik oder die Prinzipien der Formgebung“133 dekonstruiert werden.
Das wohl meist untersuchte und gewissermaßen bereits als kanonisiert anzusehende Werk zur Arbeitswelt der New Economy ist Kathrin Rögglas Roman wir schlafen nicht (2004). Ein zentrales Thema des auf zahlreichen von der Autorin mit Angestellten der Consultingbranche geführten Interviews basierenden Textes ist die Sprachkritik: Die „Phrasenhaftigkeit“ des Gesagten wird nach Ulrike Vedder „qua betonter Artifizialität“ ausgestellt, was sich „vor allem in der Verwendung der indirekten Rede zeigt“134. Die indirekte Rede bewirkt „eine Relativierung bzw. Irrealisierung des Besprochenen“, was die „geschilderten Arbeits- und Lebensverhältnisse“ miteinschließt, mehr noch aber erzeugt sie „Effekte der Entwirklichung, Entkörperlichung, Geisterhaftigkeit“135. Die Figuren äußern jedoch keine (direkte) Kritik an den (Arbeits-)Verhältnissen, vielmehr ist es die „sprachavancierte Romantechnik, die erkennbar kritisch agiert“136. Röggla lässt, wie Annemarie Matthies feststellt, „ihr Personal anhand zentraler Aussagen des Diskurses um die New Economy ein Negativbild entwerfen, in dem sich die als positiv deklarierten neuen Arbeitsverhältnisse als zweckdienliche ökonomische Maßnahmen entpuppen“137.
Details
- Pages
- 236
- Publication Year
- 2024
- ISBN (PDF)
- 9783631917152
- ISBN (ePUB)
- 9783631917169
- ISBN (Hardcover)
- 9783631820278
- DOI
- 10.3726/b21713
- Language
- German
- Publication date
- 2024 (August)
- Keywords
- ökonomische Narrative Ökonomisierung Kapitalismus prekäre Arbeit vergeschlechtlichte Arbeit Gender Studies Erzählte Arbeit
- Published
- Berlin, Bruxelles, Chennai, Lausanne, New York, Oxford, 2024., 236 S.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG