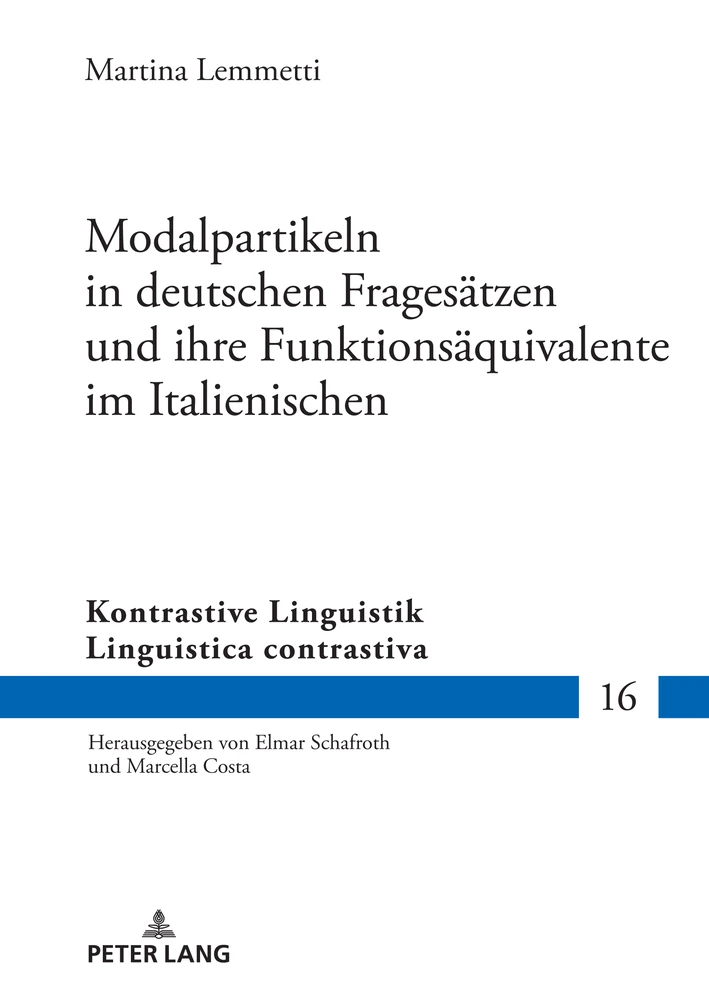Modalpartikeln in deutschen Fragesätzen und ihre Funktionsäquivalente im Italienischen
Summary
Excerpt
Table Of Contents
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Forschungsgegenstand
- Die Partikeln des Deutschen
- Die Modalpartikeln des Deutschen: Stand der Forschung
- Die Modalpartikeln des Deutschen: Definition
- Modalpartikeln in Fragesätzen
- Modalpartikeln und ihre Funktionsäquivalente im Italienischen
- Korpusbeschreibung und Vorgehensweise
- Korpus
- Überprüfung des MP-Status
- Analyse der Modalpartikeln
- Stellung der Modalpartikeln relativ zur Informationsstruktur
- Modell der MP-Bedeutung nach Blühdorn (2019)
- Modalpartikeln der ‚Antwortfindung‘
- Modalpartikeln der ‚Inkohärenz‘
- Identifikation der Funktionsäquivalente im Italienischen
- Analyse des Korpus
- Modalpartikeln der ‚Antwortfindung‘
- Die Modalpartikel wohl
- Wohl in nicht-satzförmigen W-Fragen
- Wohl in Entscheidungsfragesätzen mit V2-Stellung
- Die Modalpartikel schon
- Schon in W-Fragesätzen
- Die Modalpartikel denn
- Denn in W-Fragesätzen
- Funktionsäquivalente für SK von denn
- Erhöhung der syntaktischen Komplexität
- Verbalumschreibungen
- Nominalumschreibungen
- Mehrgliedrige Funktionsausdrücke
- Erhöhung des informationellen Gewichts
- Funktionsäquivalente für PK von denn
- Denn in nicht-satzförmigen W-Fragen
- Denn in Entscheidungsfragesätzen mit V1-Stellung
- Die Modalpartikel bloß
- Bloß in W-Fragesätzen
- Modalpartikeln der ‚Inkohärenz‘
- Die Modalpartikel eigentlich
- Eigentlich in W-Fragesätzen
- Eigentlich in Entscheidungsfragesätzen mit V1-Stellung
- Die Modalpartikel überhaupt
- Überhaupt in W-Fragesätzen
- Überhaupt in Entscheidungsfragesätzen mit V1-Stellung
- Die Modalpartikel etwa
- Etwa in Entscheidungsfragesätzen mit V1-Stellung
- Die Modalpartikel doch
- Doch in Entscheidungsfragesätzen mit V2-Stellung
- Untersuchungsergebnisse und Fazit
- Quantitative Verhältnisse im deutschen Belegkorpus
- Wiedergabe der MP-Bedeutungen im italienischen Korpus
- Sprachmittel des Italienischen als Funktionsäquivalente für deutsche Modalpartikeln
- Wiedergabe von denn, eigentlich und etwa
- Übersetzungen ohne Funktionsäquivalente für Modalpartikeln
- 6 Literaturverzeichnis
- 7 Zusammenfassung / Sintesi / Summary
1 Einleitung
Keywords: Modal particles in German question clausestheir functional equivalents in Italian.Abstract: This book examines eight German modal particles (MPs) that occur in question clauses and compares them with their functional equivalents in Italian. The main questions are: 1) does Italian have particles that can be used in similar functions as those of German MPs? 2) which other (lexical or grammatical) means are available in Italian as equivalents of German MPs? 3) which of these means can be used to translate the MPs under consideration?
Gegenstand dieser Arbeit sind deutsche Modalpartikeln (MPn) in Fragesätzen und ihre Funktionsäquivalente im Italienischen. Die MPn sind eine Besonderheit der deutschen Sprache, die in mündlicher Rede und auch in schriftlichen Texten zu finden ist. Traditionell wurden sie in der sprachpflegerischen Literatur abgewertet, z. B. als „Läuse im Pelz der deutschen Sprache“ (Reiners 1943: 340). Seit Ende der 1960er-Jahre sind die MPn Untersuchungsgegenstand linguistischer Studien geworden. Die sogenannte ‚Partikelforschung‘ hat sie aus semantischer, pragmatischer, syntaktischer, interaktionaler und sprachvergleichender Perspektive untersucht.
Aus kontrastiver und übersetzungswissenschaftlicher Sicht gelten die MPn des Deutschen als eine Herausforderung: In vielen anderen Sprachen finden sich für sie keine lexikalischen Äquivalente. Dieses Problem zeigt sich deutlich im Vergleich mit den romanischen Sprachen, die nur wenige MP-ähnliche Ausdrücke besitzen. In einer Reihe von Studien ist die Frage untersucht worden, welche Lexeme des Italienischen, Spanischen und Französischen semantische und pragmatische Funktionen übernehmen können, die denjenigen der deutschen MPn ähnlich sind. Auf der anderen Seite wurde gefragt, ob diese Sprachen über andere Mittel für die betreffenden Funktionen verfügen. Vor allem in der Didaktik für Deutsch als Zweit- und Fremdsprache und in der Übersetzungswissenschaft wurde viel Aufmerksamkeit auf die MPn gerichtet. In der vorliegenden Arbeit wird eine Teilmenge der deutschen MPn unter einer deutsch-italienischen Perspektive untersucht.
Es ist oft beobachtet worden, dass die deutschen MPn eine gewisse Satzartaffinität aufweisen. Viele MPn kommen nur oder vorzugsweise in bestimmten Satzarten vor. Eine solche Distribution kann für Satzarten als Funktionstypen wie auch für Satzarten als Formtypen beobachtet werden (vgl. Thurmair 1989: 42; Kwon 2005: 182 ff.).
Die vorliegende Arbeit ist fragesatztypischen MPn gewidmet. Im Vergleich zu anderen, z. B. aussagesatztypischen MPn (vgl. Diewald/Fischer 1998; Gutzmann/Turgay 2016; Blühdorn 2019) sind diese noch weniger untersucht worden, insbesondere unter kontrastiver Perspektive. In dem Korpus, das der Arbeit zugrundeliegt, kommen acht MPn in unterschiedlichen Fragesatztypen vor: bloß, denn, doch, eigentlich, etwa, schon, überhaupt und wohl.
Als kontrastive Untersuchung zielt die Arbeit darauf ab, italienische Funktionsäquivalente für die untersuchten MPn in Fragesätzen zu bestimmen. Als Funktionsäquivalente werden Sprachmittel verstanden, die in einem vergleichbaren Kontext eine ähnliche kommunikative Wirkung auslösen können.
Um Funktionsäquivalente zu identifizieren, stützt sich die Arbeit auf ein Textkorpus, das aus vier deutschen Kriminalromanen/Thrillern und deren veröffentlichten Übersetzungen ins Italienische besteht. Mit Nord (1993: 8 ff.) wird angenommen, dass Übersetzungen die Absicht verfolgen, in der Sprechergemeinschaft der Zielsprache ähnliche Funktionen zu übernehmen wie die Ausgangstexte in der Sprechergemeinschaft der Ausgangssprache. Es wird deshalb erwartet, in den italienischen Übersetzungen Sprachmittel zu finden, denen die Übersetzer(innen) ähnliche Wirkungen zugetraut haben wie den MPn in den deutschen Texten. Es soll hier hervorgehoben werden, dass professionelle Übersetzer meist nicht „partikelbewusst“ operieren. Ihre Aufgabe sehen sie nicht darin, einzelne Wörter zu übersetzen, sondern einen kommunikativ-pragmatisch äquivalenten Text in der Zielsprache zu formulieren. Demgegenüber ist die Aufgabe, ähnliche Ausdrucksstrukturen zu finden, beim Übersetzen eher sekundär. Der Vergleich von Übersetzungen mit ihren Ausgangstexten lässt es daher erwarten, dass zielsprachliche Funktionsäquivalente für die deutschen MPn gefunden werden, und zwar auch solche, die über die Wortebene hinausgehen (vgl. Beerbom 1992: 116).
Das Interesse für die Frage nach der Übersetzbarkeit deutscher MPn entstand aus meiner persönlichen Erfahrung mit der Übersetzung fiktionaler Literatur. Erzähltexte enthalten oft Dialogpassagen, in denen sich Sprachmittel finden, die für die mündliche Rede typisch sind, darunter MPn. Intuitiv eignen sich im Italienischen oft Konjunktionen oder Adverbien in der Funktion von Diskursmarkern, um ähnliche kommunikative Wirkungen zu erzielen. Auch bestimmte modalisierend gebrauchte Verbformen und Verbalperiphrasen sind hier zu nennen. Teilweise bestätigen vorhandene Detailstudien solche Intuitionen (z. B. Helling 1983a; Held 1983; Buzzo Margari 2004), aber umfassendere monographische Darstellungen der deutschen MPn und ihrer italienischen Äquivalente sind nur selten in Angriff genommen worden (Helling 1983b; Masi 1996; Cognola/Moroni 2022). Hierbei ist die Auswahl der untersuchten MPn stets nach empirischer Häufigkeit erfolgt, nicht nach systematischen Kriterien. Die vorliegende Arbeit verfährt anders, indem sie den Funktionszusammenhang des Fragesatzes zum Ausgangspunkt nimmt und nach den spezifischen Aufgaben fragt, die MPn in dieser Satzart übernehmen können.
Die Beschreibung der MP-Bedeutungen erfolgt nach dem Modell von Blühdorn (2019). In diesem Modell werden zwei Komponenten der MP-Bedeutung unterschieden. Die sogenannte ‚semantische Komponente‘ (SK) setzt eine Informationseinheit (den geäußerten Satz bzw. Sprachausdruck) in Beziehung zu einem Wissenshintergrund, z. B. dem Wissen der sprechenden Person oder dem gemeinsamen Wissen der Interaktionspartner. Die sogenannte ‚pragmatische Komponente‘ (PK) setzt einen Sprechakt (die mit dem Sprachausdruck ausgeführte Handlung) in Beziehung zum aktuellen Handlungskontext. Nach diesem Modell wird die Bedeutung jeder MP in ihrem gegebenen Kontext als Kombination von SK und PK beschrieben. Blühdorn (2019) hat es unter anderem für die fragesatztypischen MPn wohl und eigentlich ausgearbeitet. Im Folgenden wird es auf alle untersuchten MPn angewandt. Damit ist die Vergleichbarkeit dieser MPn bezüglich ihrer kommunikativen Funktionen gewährleistet. Die Zerlegung ihrer Bedeutungen in SK und PK erleichtert die Suche nach Funktionsäquivalenten in den italienischen Übersetzungen.
Die vorliegende Untersuchung möchte mit ihrer korpusbasierten Herangehensweise ein breiteres und genaueres Bild von der Vielfalt der Sprachmittel des Italienischen gewinnen, die dazu dienen können, kommunikative Wirkungen hervorzubringen, die im Deutschen mit MPn hervorgebracht werden. Insbesondere richtet sich die Aufmerksamkeit auf die folgenden Fragen:
- 1. Besitzt das Italienische einzelne partikelähnliche Lexeme, die als Funktionsäquivalente deutscher MPn in Fragesätzen auftreten können?
- 2. Welche anderen Sprachmittel des Italienischen (lexikalischer oder komplexerer Art) eignen sich generell als Funktionsäquivalente für deutsche MPn?
- 3. Welche spezifischen Mittel besitzt das Italienische für die Übersetzung der einzelnen untersuchten MPn in Fragesätzen?
Als Vorbild für die kontrastive Untersuchung dient die Studie von Beerbom (1992), die eine ähnliche Fragestellung für das Sprachenpaar Deutsch– Spanisch behandelt. Beerbom wählt aufgrund ihrer hohen Frequenz die MPn ja, doch, eben/halt und schon aus, die ihrer Auffassung nach innerhalb der Funktionsklasse eine semantische Teilgruppe bilden. Beerbom identifiziert Funktionsäquivalente für diese MPn in spanischen Übersetzungen deutschsprachiger Romane. Sie kommt zu dem Schluss, dass das Spanische über keine mit den deutschen MPn vergleichbare Klasse verfügt. Die Autorin stellt ein Inventar von Funktionsäquivalenten zusammen, das lexikalische Ausdrücke, finite Verbformen und Verbalperiphrasen, syntaktische Strukturen, Adverbien und Diskursmarker umfasst (Beerbom 1992: 457–458). Dabei handelt es sich zum Teil um spezifische Kodierungsmittel des Spanischen für Modalität (z. B. Adverbien und Verbformen), zum Teil aber auch um unterschiedliche sprachliche Strategien, die in konkreten Kontexten ähnliche Funktionen wie die deutschen MPn erfüllen können, ohne allgemein als Modalitätsmittel anerkannt zu sein. Die Ähnlichkeiten zwischen dem Spanischen und dem Italienischen lassen erhoffen, dass der in der vorliegenden Arbeit angestellte Vergleich zu ähnlichen Ergebnissen führen könnte.
Details
- Pages
- 170
- Publication Year
- 2024
- ISBN (PDF)
- 9783631917244
- ISBN (ePUB)
- 9783631917251
- ISBN (Hardcover)
- 9783631917237
- DOI
- 10.3726/b21724
- Language
- German
- Publication date
- 2024 (October)
- Keywords
- kontrastive Linguistik Deutsch/Italienisch italienische Funktionsäquivalente fragesatztypische Modalpartikel deutsche Sprache Modalpartikeln in Fragesätzen
- Published
- Berlin, Bruxelles, Chennai, Lausanne, New York, Oxford, 2024. 170 S., 19 Tab.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG