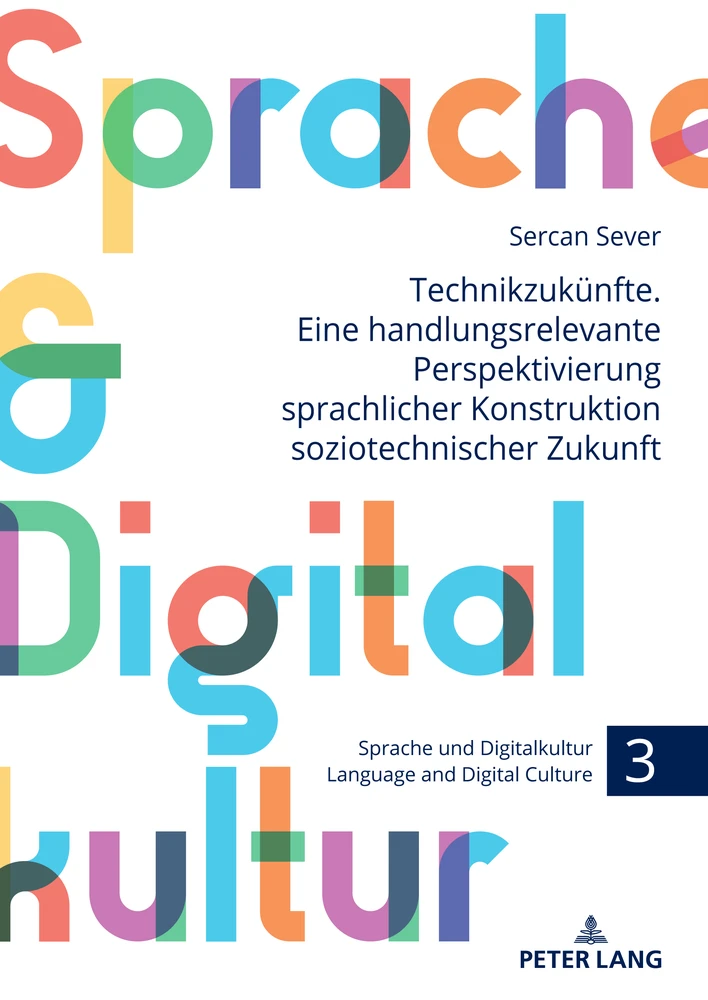Technikzukünfte. Eine handlungsrelevante Perspektivierung sprachlicher Konstruktion soziotechnischer Zukunft
Summary
Excerpt
Table Of Contents
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Inhaltsübersicht
- 1. Wenn Zukunft, Technik und Sprache aufeinandertreffen. Bestimmung des Gegenstands
- 2. Vom Zeichen zum Sinn. Beschreibung des Vorgehens
- 3. Zukunfts- und Technikrede. Analyse des Phänomens
- 4. Technikzukünfte. Interpretation des Blicks
- 5. Technikzukünfte-Heuristik im Gespräch. Inkorporation der Perspektivierung
- 6. Technikzukünfte – eine handlungsrelevante Perspektivierung sprachlicher Konstruktion soziotechnischer Zukunft. Reflexion der Erkenntnisse
- Abbildungsverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
- Literaturverzeichnis
1. Wenn Zukunft, Technik und Sprache aufeinandertreffen. Bestimmung des Gegenstands
1.1 Relevanz des Zusammenfalls von Zukunfts- und Technikrede
Mit Verweis auf eine zunehmende Digitalisierung kann man sein gegenwärtiges Handeln begründen. Man kann sich auf der individuellen Ebene Kompetenzen fürs Programmieren aneignen. Man kann sich auf organisationaler Ebene für die Digitalisierung von Abläufen starkmachen, auf politischer Ebene rechtliche und Förderwege freimachen für schnellere und einfachere Digitalisierungsprojekte und auf wirtschaftlicher Ebene sich um eine Digitalisierung von handelbaren Gütern und Dienstleistungen bemühen. Kurz: Mit dem (Zukunfts-)Wissen um Digitalisierung kann man im Heute entsprechend handeln, um später mitzuhalten, zu ermöglichen, zu partizipieren und wettbewerbsfähig zu bleiben. In Begründungsmustern dieser Art fallen das Reden über Zukunft und das Reden über Technik eindrücklich zusammen: Die Technisierung (Digitalisierung der Ebenen) wird durch ein Zukunftsbild (zunehmend) begründet, und das Zukunftsbild ist zugleich technisiert, in diesem Fall digital. Es sind Redeweisen wie diese, die verwendet werden, die Vorstellungen von Technik-Zukunfts-Beziehungen bemühen. Sie treffen keine Aussage über die Zukunft per se, die offen und ungewiss ist, und keine über Technik per se, die als Soziotechnik komplex ist. Sie verbleiben in der Immanenz der Gegenwart und der Immanenz der Sprache (Grunwald 2009a: 27) und funktionieren als vorgängige, mentale Entscheidungen, die anliegende Entscheidungen bzw. Handlungen begründen helfen. „Zunehmende Digitalisierung“ ist nur ein Beispiel für den sogenannten Zusammenfall von Zukunfts- und Technikrede und damit ein Teil des zu untersuchenden Phänomens. Andere Fälle vom Zusammenfall der Zukunfts- und Technikrede sind beispielsweise Redeweisen von zunehmender Automatisierung, Algorithmisierung oder zunehmendem Roboter- und KI-Einsatz.
Sowohl „Zusammenfall“ als auch „Rede“ sind erklärungsbedürftig. „Die Rede über/von Zukunft und Technik“, „das Reden über/von Zukunft und Technik“ oder „der Zusammenfall von Zukunfts- und Technikrede als soziotechnische Zukunftsrede“ stellen allesamt Beschreibungsweisen für das zu untersuchende Phänomen dar. Diese Bezeichnung als Rede(n) folgt dem Sprachverständnis de Saussures (1931/2001), wonach „langage“ den Oberbegriff allen menschlichen Redens bezeichnet. Langage lässt sich in „langue“ (Sprachsystem) und „parole“ (Sprechakt) zu konkreteren Beschreibungszwecken unterteilen. Rede (langage) schließt beides – langue und parole – ein: die Sprache der Zukunft und Technik (langue) sowie das Sprechen über Zukunft und Technik (parole). In diesem Sinne wird hier „(-)Rede(n)“ verwendet als adäquater Oberbegriff für ein interessierendes Sprachphänomen menschlicher Rede. Auf dieser generellen, possessiv unbestimmten Ebene interessiert das Phänomen, wobei je nach Konkretionsgrad sowohl auf langue als auch auf parole der Rede eingegangen wird. Mit „Zusammenfall“ ist die Inklusion von Technik im Reden über Zukunft und die Inklusion von Zukunft im Reden über Technik gemeint, wenn – wie zu zeigen sein soll – Technikentwicklung thematisiert wird. Der Zusammenfall von Zukunfts- und Technikrede lässt sich als allgemeine Thematisierungsweise von Technikentwicklung bestimmen. Dabei wird ein integriertes Verständnis von Technikentwicklung angelegt: Technikerfindung, -innovation, -produktion, -distribution und -verwendung werden allesamt als spezifische Aspekte und Phasen der Technikentwicklung verstanden.
Dass überall die Rede von Zukunft ist, daran haben wir uns schon lange gewöhnt. Dass von der Zukunft als einer technisierten die Rede ist, auch. Zukunfts- und Technikrede fallen in Thematisierungen der Technikentwicklung zusammen. Selbst mythologisch fallen seit jeher sinnbildlich das Vorauswissen und die Technik in ein und derselben Figur, dem Prometheus, zusammen (Gransche 2015: 14). So überrascht auf den ersten Blick weder, dass die Vertechnisierung der Zukunft selbstverständlich ist, noch die Hinzuziehung von Zukunft, wenn Technikentwicklung entworfen, besprochen, argumentiert, diskutiert oder geplant wird. Auf den zweiten Blick darf man sich über diesen Zusammenfall verblüfft zeigen und man darf fragen, wie es sich damit verhält. Man kann danach fragen, warum und auf welche Art und Weise Zukunft Technik und Technik Zukunft in der Technikentwicklung einschließt, was ist, wenn Zukunft, Technik und Sprache aufeinandertreffen.
Aber warum etwas nachvollziehen, über etwas nachdenken, das doch schon irgendwie funktioniert? Die Rede über Zukunft und Technik kann doch einfach als beliebter Topos oder unterhaltsames Medium der Selbstverständigung in Umlauf sein, auch ohne ihr Verhältnis zu bestimmen und ihren Wirkungszusammenhang zu kennen? Man kann sich das Nachdenken über diesen sprachlichen Zusammenfall sparen. Nur dann wird man auch sagen müssen, dass die Besonderheiten und die Funktion des Redens über Zukunft und Technik oder die Thematisierung von Technikentwicklung nicht relevant sind. Die Relevanz ist allerdings schon quantitativ schwer strittig zu machen: Technikentwicklung ist kein Nischenthema, das nur in Technikwissenschaften oder in Technikentwicklungszusammenhängen im allerengsten und kleinteiligsten Sinne zur Debatte steht, sondern eines, das in Wirtschaft, Wissenschaft, Politik, Alltag und Gesellschaft ständig, im Allgemeinen wie im Konkreten, thematisiert wird, sei es in Form von Profit-, Förder-, Rechts-, Macht-, Nutzungs- oder Legitimationsfragen. In qualitativer Hinsicht erweist sich die Thematisierung von Technikentwicklung als überaus handlungsrelevant: Der Zusammenfall von Zukunfts- und Technikrede ist kein isoliertes Sprachspiel, sondern dient prämissenhaft zu begründeten Entscheidungen für (De-)Investment, Projektförderung oder -ablehnung, Gesetzgebung, Machtverteilung, -eingrenzung oder -zentralisierung, Befürwortung oder Zurückweisung und Demokratisierung der/einer Technikentwicklung.
In individueller Hinsicht mag die Ignoranz vom sprachlichen Zusammenfall möglich, wenn auch nicht von Vorteil sein, aber für Forschungs- und Anwendungsfelder der Technikentwicklung ist Ignoranz fatal. Man verwirkt damit ein kritisches Potenzial: Entscheidungen orientieren sich nicht unmittelbar an Zukunft und Technik, sondern an ihren handlungsrelevant wirkenden Versprachlichungen. Entscheidungen der Technikentwicklung sind nur durch die Rede über Zukunft und Technik begründbar, nicht in anderer Weise „unmittelbarer“ an der Sache der Zukunft und Technik selbst. Die Reflexion auf diese Rede zeigt, dass substantiell keine abgesicherte, rationale Begründung für diese oder jene Entscheidung in der Technikentwicklung angesichts zukunftsbedingter Ungewissheit und technikinduzierter Komplexität vorgelegt werden kann. Ganz gleich, wie selbstsicher und überzeugt das begründende Sprachspiel unter Bezug von Zukunft und Technik vorgetragen wird, es bleibt „nur“ ein orientierendes Sprachspiel als Rede über Zukunft und Technik. Wird diese Orientierungsfunktion der Rede nicht reflektiert, unterliegt man den Wirkmechanismen des Redens über Zukunft und Technik, womit gewünschte Handlungsergebnisse den nur sprachlich begründbaren Entscheidungen überlassen werden. Anders gesagt: Ignoriert man den nicht zufälligen Zusammenfall von Zukunfts- und Technikrede, braucht es viel Glück, damit die erwünschte Technikentwicklung – ob als Technikherstellung oder -nutzung – gelingt.
Man kann dagegenhalten: Jede intendierte Handlung braucht doch immer etwas Glück, denn die kalendarische Zukunft, das tatsächliche, in der Zukunft liegende Handlungsergebnis, kann man ja jetzt noch gar nicht wissen. Das stimmt. Diese Erkenntnis allein kann nicht der Mehrwert der Untersuchung sein, das wäre trivial. Daher soll die vorliegende Analyse und Reflexion von Zukunfts- und Technikrede in Thematisierungen der Technikentwicklung zeigen, dass Glück als etwas Unbestimmbares im Handlungsverlauf in der Technikentwicklung sowohl existiert als auch einen durchaus festgelegten Platz hat. Vieles hat mit Glück zu tun, nur: Nicht alles obliegt dem Glück, nicht alles kann dem Glück in Rechnung gestellt werden. Damit wird nicht der Illusion eines absoluten Zukunftswissens das Wort geredet, denn genau so wenig kann Glück erfolgreich herausgekürzt, Zukunft auch bei größtmöglicher Analyse und Reflexion nicht gewusst werden, vielmehr die Verhältnisse bestimmt.
Im verstehenwollenden Fragen und Reflektieren wird in dieser Arbeit eine handlungsrelevante Perspektive auf die sprachliche Konstruktion soziotechnischer Zukunft entwickelt, die in Forschungs- und Anwendungsfeldern der Technikentwicklung gebraucht werden kann. Damit soll Sprache, Technik und Zukunft eine bedeutungsvolle Funktion, eine Sinnrelation zugewiesen werden (Abb. 1). Auf diese Weise verfliegen die Selbstverständlichkeit und Selbstwirksamkeit des nicht zufälligen Zusammenfalls von Zukunfts- und Technikrede und es treten Unterschiede hervor, die durch eine handlungsrelevante Perspektivierung mit Bedeutung versehen werden können. Eine solche Perspektive ist nötig, da sie erst verständlich macht, dass es sich beim kommunikativen Zusammenfall – Kommunikation ist gerade „ein Handeln unter Unsicherheit“ (Antos 2021: 153) – von Zukunfts- und Technikrede um einen entscheidungsdienlichen, handlungsfunktionalen Umgang mit dem festgestellten Orientierungsproblem handelt – um nichts weniger (kein nur rhetorischer Topos) und um nichts mehr (keine Lösung des Orientierungsproblems). Sie macht auf ein gravierendes Problem aufmerksam: Ohne diese Perspektive bleibt zu fürchten, dass simplifizierende und technikoptimistische wie -pessimistische Sichtweisen, zwei Seiten einer „wenig reflexiv spiegelnden Medaille“ (Fraunholz et al. 2012a: 21 f.), sonst wirksam bleiben und eine adäquate Bewältigung von Komplexität und Unsicherheit verhindern. Die Perspektive wird gebraucht im Forschungsfeld und sie ist nützlich im Anwendungsfeld der Technikentwicklung.

Abb. 1:Sinntrias aus Zukunft, Technik und Sprache
1.2 Interesse an einer Perspektive auf soziotechnische Zukunftsreden
Bisher wurden bei der Untersuchung des im Grunde nicht unbekannten Phänomens viele Ressourcen und Zeit darauf verwendet, herauszufinden, was Zukunft und Technik je empirisch ist und bedeutet. Zukünfte wurden entlang der Möglichkeiten und Limitationen von Zukunftsbildern, Science-Fiction oder Prognosen erforscht, Technik entlang von Herstellungs- und Distributionsprozessen. Auch das Ineinanderfallen beider Gegenstände wird unlängst beforscht, wenn u.a. Prototyping als „vorauseilende[] Technologisierung der Zukunft“ (Dickel 2019) oder soziotechnische Zukünfte als „technologiebezogene[] Zukunftsvorstellungen und ihre Ausprägungen z.B. in Technikvisionen, Entwicklungsleitbildern und Zukunftsszenarien subsummiert“ (Lösch 2017: 61) in den Blick kommen. Das sind im Hinblick auf die Entwicklung einer handlungsrelevanten Perspektive entlang der sprachlichen Oberfläche von Zukunfts- und Technikrede wichtige Vorarbeiten und damit selbst Textmaterial, das Teil der Analyse und Interpretation ist. Allerdings machen sie weder eine Perspektive auf soziotechnisches Zukunftsreden, damit den Wirkungszusammenhang im Zusammenfall von Zukunfts- und Technikrede, zum Erkenntnisinteresse, noch fokussieren sie die Rede als Phänomen, das dezidiert sprach- und sprechanalytisch im Rahmen einer hermeneutischen Methodologie erarbeitet wird. Damit fällt über die bereits existierenden Forschungs- und Anwendungszugänge zu Zukunft und Technik auf, dass Sprache zwar bis dato eine Rolle in der Analyse von Zukunft und Technik spielt, allerdings nicht im Sinne einer Phänomen-Blick-Konstruktion perspektiviert und interpretiert wird. Das heißt: Die rein sprachliche Oberfläche wird nicht als der hinreichende Ort befunden, an dem sich verstehen lassen kann, inwiefern Zukunfts- und Technikrede für technikentwicklungsbezogene Handlungen funktionieren. Obwohl Technik und Zukunft wesentlich über Sprache zu erfassen sind, tut sich hinsichtlich der „Handlungsfunktion der Sprache“ (Antos 2021: 143) eine nicht unerhebliche „linguistische Lücke“ (Gümüşay 2020: 46) in der Beforschung des Phänomens auf.
Radikaler und simpler formuliert: Zukunft und Technik selbst, an und für sich, interessieren überhaupt nicht, aus dem einfachen Grund, weil sie empirisch nicht zugreifbar sind. Die Zukunft ist schlicht nicht vorhanden. Technik ist zwar substantiell vorhanden, aber schlicht nicht in ihrer feingliedrigen Verästelung und soziotechnischen Totalität (Ropohl 2009: 92) erfassbar. Damit sind Zukunft und Technik auch nicht unmittelbar verstehbar, denn wie kann etwas verstanden werden, das nicht existiert (Zukunft); und wie kann etwas verstanden werden, das existiert, aber undurchschaubar ist (Technik)? Forschungspraktisch gewendet: Wie sinnvoll kann überhaupt etwas analysiert und verstanden werden, das sich nicht beobachten lässt? Die nicht-existente oder undurchschaute Materialität kann jedenfalls nicht der Ort sein, an dem sich die Analyse und Interpretation erschöpfen kann.
„Technikdeutung“ gilt als „Weltdeutung“ (Greder 2018: 107). Und „[s]owohl im Technischen als auch im Humanen beschreibt sich die Gesellschaft durch Projektion ihrer Zukunft“ (Luhmann 1992: 133). Aufgrund dieser Relevanzzuschreibung steht außer Frage, dass die wissenschaftliche Beobachtung des vagen Phänomens aus Verstehens- und Erklärungsgründen trotz Erforschungsschwierigkeiten geboten ist. Es gilt, die gegenwärtige Handlungsrelevanz des Zukünftigen zu verstehen, noch bevor Zukunft eintrifft und empirisch erfahrbar wird. Genauso gilt, dass Technik in ihrer soziotechnischen Komplexität in den Blick zu kommen hat. Ein Verstehen und Erklären, das auf diesen Grundlagen aufbaut, wäre erst gegenstandsangemessen und damit brauchbar. Der Zusammenfall aus Zukunft, trotz ihrer Offenheit und Nicht- Verfügbarkeit, und Technik, trotz ihrer soziotechnischen Komplexität, will analysiert und interpretiert werden – ohne scheinbare Vergewisserung der Zukunft, ohne scheinbare Reduktion der Technik.
Es wird deutlich, dass im Drang nach unmittelbarer, „reiner“ Beobachtung sich die soeben beschriebene Schwierigkeit einer substantiellen Analyse ergibt. Doch besteht aus Forschungsperspektive das große Glück darin, dass sich Zukunft und Technik in Sprache gießen lassen und gegossen werden müssen, wenn sie handlungsrelevant werden. Das heißt: Überall da, wo Zukunft und Technik in Sprache bzw. Kommunikation in Erscheinung treten, versprachlicht sind, sind sie als Sprechhandlung handlungsrelevant. Durch Bestimmung und Erarbeitung an ihren sprachlichen Gestalten lassen sich Zukunft und Technik adäquater und kontrollierter beobachten als an einem Ort außerhalb von Sprache und handlungsrelevant deuten: „Der sprachanalytische Ansatz geht von der erkenntnistheoretischen Prämisse aus, ‚daß wir keinen epistemischen Zugang zu den Phänomenen haben, der unabhängig von Sätzen ist‘“ (Bieri zitiert nach Jäger 2018: 307). Das vage Phänomen kann sprachlich erforschbar versprachlicht werden: Statt Zukunft lässt sich so die versprachlichte Zukunft als Rede über Zukunft, statt Technik die versprachlichte Technik als Rede über Technik und statt soziotechnischer Zukunft die versprachlichte soziotechnische Zukunft als Rede über soziotechnische Zukunft beobachten. Auf Grundlage dieser Beobachtung lässt sich unterscheiden, inwiefern Zukunftsrede Technikrede und Technikrede Zukunftsrede in der Technikentwicklung einschließt, und es lassen sich Rückschlüsse ziehen, warum und zu welchem Handlungszweck Zukunft Technik und Technik Zukunft in der Technikentwicklung einschließt.
In der Thematisierung von Technikentwicklung schließt Zukunftsrede Technikrede ein und Technikrede Zukunftsrede. Dieser Zusammenfall wird als soziotechnische Zukunftsrede gefasst. Damit rückt das befragte und „in hohem Maße erklärungsbedürftig[e] [Phänomen]“ (Fraunholz et al. 2012a: 16) des Zusammenfalls von Zukunfts- und Technikrede als technische Pointierung von Zukunftsvorstellungen und als Verzeitlichung von Technik in der Thematisierung von Technikentwicklung in den Fokus. Den Wirkungszusammenhang im Zusammenfall von Zukunfts- und Technikrede zu verstehen, stellt dabei ein Desiderat dar. Während das Phänomen der Zukunftskonstruktion und Technikkonstruktion durchaus Beachtung in Forschung und Anwendung findet, ihr Zusammenspiel als soziotechnische Zukunftsvorstellungen unlängst Gegenstand von Untersuchungen und Reflexionen geworden ist, mangelt es an einem hermeneutischen Blick auf das Sprach-Phänomen, der dessen handlungsrelevanten Wirkungszusammenhang interpretativ beleuchtet und als perspektivierte Phänomen-und-Blick-Konstruktion der Fachdebatte anbietet. Das bedeutet nichts anderes, als dass eine auf Verstehen und Erklären ausgerichtete, allgemeine Perspektive auf das Phänomen fehlt, ein Metawissen, das das Phänomen verständlich macht und sich im Forschungs- und Anwendungsfeld der Technikentwicklung klärend gebrauchen lässt. Der selbstverständlich gewordene Zusammenfall von Zukunfts- und Technikrede muss erst gesehen werden (Phänomenkonstruktion), um ihn als Reaktion auf das Orientierungsproblem zu begreifen (Blickkonstruktion).
Damit geht das Vorhaben über die Untersuchung eines Falls oder Beispiels hinaus. Es interessiert eine generelle Perspektive, die handlungsrelevante Wirkmechanismen vom Reden über Zukunft und Technik text- bzw. fallübergreifend deutet. Eine fallübergreifende Deutung ist möglich, wenn nicht die je pragmatischen Kontextbedingungen der Rede ins Auge gefasst werden, sondern sie sich entlang sprach- und sprechanalytischer Eigenschaften vollzieht. Nur so und unter Gebrauch anschlussfähiger Begriffe lässt sich eine generelle Perspektive entwickeln und im anvisierten Forschungs- und Anwendungsfeld der Technikentwicklung auch im Konkreten anbieten und nutzen. Daher interessiert nicht die Thematisierung von Technikentwicklung in einem literarischen oder fachlichen Text, bei einem/einer Autor:in, einem Projekt, einer Debatte, einer Kommunikationssituation o.ä. Das Phänomen ist überall zugleich von Interesse und wird deshalb anhand von Texten beobachtet, in denen latent, implizit oder (über)deutlich Technikentwicklung thematisiert wird und zum Ausdruck kommt. Das heißt, dass in der Untersuchung ein zu beforschender Diskurs aus Texten bestehend Beachtung findet, der sich rein und immer wieder neu „anhand einer die Aussagen verbindenden Thematik“ (Fegter et al. 2015: 16) bestimmen lässt. Dabei müssen gerade so viele Texte herangezogen und hergestellt werden, bis durch analytisch gewonnene Konstruktionen eine generelle Perspektive interpretiert werden kann und sich gebrauchen lässt.
Das „Kernproblem der Gegenstandskonstitution“ ist so als „eine Artikulationsaufgabe“ zu verstehen (Hirschauer 2008: 183). Diese Konstruktion des Phänomens als soziotechnische Zukunftsrede und das Feststellen der linguistischen Lücke bzw. des Desiderats ruft förmlich „ein Paradigma linguistischer Textarbeit“ (Jacob 2017: 87 f.) auf den Plan. Durch er- und aufschließbare Texte, in denen latent, implizit oder (über)deutlich Technikentwicklung thematisiert wird, lässt sich der unauffällige Zusammenfall von Zukunfts- und Technikrede hinterfragen und als soziotechnische Zukunftsrede beobachten. Textarbeits- und Reflexionsmethoden bestimmen das Verhältnis von Zukunfts- und Technikrede und bringen Verständnisse in der Thematisierung von Technikentwicklung zum Vorschein, sodass auf mentale Prämissen in der Technikentwicklung interpretativ geschlossen werden kann. Die sprachliche Oberfläche ist der Ort für die Analyse und Interpretation des Phänomens und gilt daher als ernst zu nehmende und adäquate Dimension des soziotechnisch Zukünftigen überhaupt. Mittels ihrer wird eine generelle Perspektive entwickelt, die das Phänomen zum Orientierungsproblem in Bezug setzt und handlungsrelevant verständlich macht, und als Metawissen angeboten.
1.3 Hermeneutische Bearbeitung der forschungsleitenden Fragestellung
Es interessiert damit ein Phänomen, das mittelbar mit Zukunft und Technik zusammenhängt, und an verschiedenen Orten der Thematisierung von Technikentwicklung auftaucht, von dem aber angenommen wird, dass es nicht zufällig sprachlich stets ähnlich figuriert ist. Auf Grundlage dieser Feststellung und Annahme lässt sich die folgende forschungsleitende Frage stellen:
Inwiefern und zu welchem Zweck fallen das Reden über Zukunft und das Reden über Technik in Thematisierungen der Technikentwicklung zusammen?
Die Untersuchung zur Konstruktion einer adäquaten Perspektive auf soziotechnisches Zukunftsreden als eine lohnenswerte Arbeit anzugehen, erfordert dreierlei Dinge: 1. Perspektivbewusstsein zur Herstellung eines reflektierten, plausiblen Zusammenhangs im Bezugsrahmen der Sprache, 2. abduktive Heuristikbildung zur Konstruktion einer Sinnfigur als Ergänzung konventioneller Schlussweisen und 3. die Bearbeitung der Fragestellung im Rahmen einer zweckmäßig konstellierten, hermeneutischen Methodologie.
1. Zuallererst ist ein „Perspektivbewusstsein“ von Nöten, das Weltzugänge im Unterschied zu Universalisierungsreflexen in Perspektiven und Deutungen denkt, die keinen ultimativen Geltungsanspruch haben können (Gümüşay 2020: 140 f., Herv. i.O.). Eine versprachlichte Perspektive betont die Mittelbarkeit unserer Beziehung zu Dingen und „repräsentiert eine Weise des Weltverständnisses, eine Art der Unterscheidung von Dingen und ihrer In-Beziehung-Setzung zueinander“ (Belsey 2013: 19). In dieser Arbeit wird daher vor allem Versprachlichtes sprachlich zu observieren sein. Das heißt, dass Sprache als Bezugsrahmen gilt, wenn das in den Blick zu nehmende Phänomen der Zukunfts- und Technikrede, das an, über und mit Texten beobachtet wird, in denen es latent, implizit oder (über)deutlich thematisiert und damit sprachlich zum Ausdruck (vor)kommt, konstituiert und die Perspektive darauf konstruiert wird. Der versprachlichende Blick ordnet das sprachliche Phänomen und macht eine sprachlich konstituierte Perspektive möglich: „Die Ordnung ist zugleich das, was sich in den Dingen als ihr inneres Gesetz, als ihr geheimes Netz ausgibt, nach dem sie sich in gewisser Weise alle betrachten, und das, was nur durch den Raster eines Blicks, einer Aufmerksamkeit, einer Sprache existiert“ (Foucault 2015a: 22). Eine wissenschaftliche Perspektivherstellung steht nicht über anderen. Allerdings ist sie dadurch gekennzeichnet, dass sie das Spannungsfeld aus Wissens(re)produktion, -kommunikation und -darstellung reflektiert auszubalancieren und mit Ertrag für ihre Rezipient:innen zu meistern sucht. Soll in dieser Untersuchung Metawissen entstehen, kommuniziert und dargestellt werden können, hat dieses in besonderem Maße als nachvollziehbares Ergebnis aus den abgewogenen Forschungsschritten zu resultieren und kenntlich zu werden. Diese Schritte zum Wissen sind einerseits subjektiv aufeinander abgestimmt, andererseits damit erst objektivierbares Wissen. So entsteht zum einen Erkenntnis auf der produktiven Seite des Forschers oder der Forscherin. Zum anderen können bei der kommunikativen Wissens(re)produktion und um Nachvollziehbarkeit bemühten Darstellung von Metawissen Erkenntnisse auf der Rezeptionsseite provoziert werden, obwohl sie sich nicht direkt über den Forschungstext vermitteln lassen.
Das Forschungsvorgehen besteht darin, einen textgestützten Sinn mittels Lektüre zu ermitteln, der im interpretativen Zugang zu Texten entfaltet und bestimmt wird. Dabei stellt sich die Frage, was die Konstruktion, Relation und Evaluation, die das Phänomen ausmacht, in handlungsrelevanter Hinsicht bedeutet:
„Linguistisch gesprochen stellen Referieren (Bezugnehmen auf Gegenstände und Sachverhalte), Prädizieren (Eigenschaften zuschreiben und etwas aussagen über die Gegenstände und Sachverhalte, auf die Bezug genommen wird), Quantifizieren und das Herstellen von Relationen (Aussageverknüpfung) die elementaren sprachlichen Handlungen des Sprechens dar“ (Felder 2018: 393 f.).
Im Zusammenbringen der Analysen wird Bedeutung erkannt, Sinn ermittelt. Sinn meint dann den gemachten „intelligiblen Zusammenhang von x und y“ (Stoellger 2021: 147, Herv. i.O.), von Mittel und Zweck, von Zukunfts- und Technikrede und Handlung, von Phänomenkonstruktion und Blickkonstruktion, von vorgängigen Entscheidungen/mentalen Prämissen und Entscheidungen, von Thematisierung und Technikentwicklung, von, wie zu sehen sein wird, soziotechnischen Zukunftsreden und handlungsleitender Orientierung. Soziotechnische Zukunftsreden werden dabei als Aussagen über Technikentwicklung in zweifacher Hinsicht verstanden: als Aussagen, die vorgängige Entscheidungen spiegeln und mit konkreten Entscheidungen der Technikentwicklung zusammenhängen, und als Aussagen, deren Implikationen epistemisch ausgeleuchtet und als Metawissen angeboten zur Orientierung in anliegenden Entscheidungen verhelfen.
2. Für die Bearbeitung bedeutet die Herstellung solcher Zusammenhänge in einer zu entwickelnden Perspektive als Phänomen-und-Blick-Konstruktion, dass das Bemühen eines bestens tradierten Methodenclusters nicht ausreicht, um das Phänomen verständlich zu machen. Die zu bearbeitenden Fragen werden daher mit konventionellen Mitteln der Induktion und Deduktion angegangen und mit experimentelleren Mitteln der Abduktion. Die Komplexität des Gegenstands Technikentwicklung als soziotechnische Erfindung, Innovation, Produktion, Distribution und Verwendung drängt das geradezu auf: „Gesellschaftliche Entwicklungen, die durch das Medium Internet in Gang kommen oder beschleunigt werden, sind mit tradierten Methoden kaum ursächlich zu durchschauen“ (Gümüşay 2020: 120). Es braucht „neue Tools zur Strukturierung, Deutung, Kritik, Rationalisierung und Bewertung [der] Zukunftskommunikationen“ (Grunwald 2012: 137): „We cannot tackle problems with the same kind of thinking we used when we created them“ (Schmidt 2022: 5). Diese Feststellung ist ernst zu nehmen und der Bearbeitungsmodus entsprechend zu wählen.
Wenn ein Zusammenhang zwischen soziotechnischer Zukunftsrede und Handlung in der Technikentwicklung in einer Perspektive herzustellen ist, dann dürfen konventionelle nicht gegen kreative Methoden ausgespielt werden: „The ideal is a healthy mix of incremental and disruptive research“ (Kozlov 2023: 225). Die jeweiligen Schlussweisen müssten sich holistisch ergänzen und nicht im Widerstreit zueinander stehen: „Erkennendes Verstehen als Erweiterung des Bekannten (induktiv, entdeckend)“ und „[w]iedererkennendes Verstehen als […] Einordnung, Normalisierung, Entstörung (deduktiv, subsummierend)“ sind mit einem unkonventionellen des „[e]rfindende[n] Verstehens[s] (abduktiv) als Erweiterung des Horizonts und Sinn für Neues“ in Verbindung zu bringen (Stoellger 2021: 151 f., Herv. i.O.). Thematisierungen von Technikentwicklung werden auf diese Weise zum einen erkannt und als Reden über soziotechnische Zukunft entdeckt (Induktion). Zum anderen werden mit den Formen des Redens über soziotechnische Zukunft Thematisierungen von Technikentwicklung eingeordnet (Deduktion). Mit der Interpretation wird schließlich eine Erfindung geleistet, die einerseits auf dem Fundament der Analyse steht, andererseits durch Sinnfindung erst herangetragen wird, die eine neue, brauchbare, handlungsrelevante Perspektive auf die Thematisierung von Technikentwicklung anbietet (Abduktion).
Details
- Pages
- 476
- Publication Year
- 2024
- ISBN (PDF)
- 9783631917732
- ISBN (ePUB)
- 9783631917749
- ISBN (Hardcover)
- 9783631917725
- DOI
- 10.3726/b21747
- Language
- German
- Publication date
- 2024 (November)
- Keywords
- Zukunft Technik Sprache Technikentwicklung Technikzukünfte Zukunftsreflexion Gegenwartskomplexität Zukunftsunsicherheit Handlungsbewältigung Heuristikbildung Orientierungsproblem Orientierungswissen
- Published
- Berlin, Bruxelles, Chennai, Lausanne, New York, Oxford. 2024. 476 S., 14 S/W Abb., 7 Tab.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG