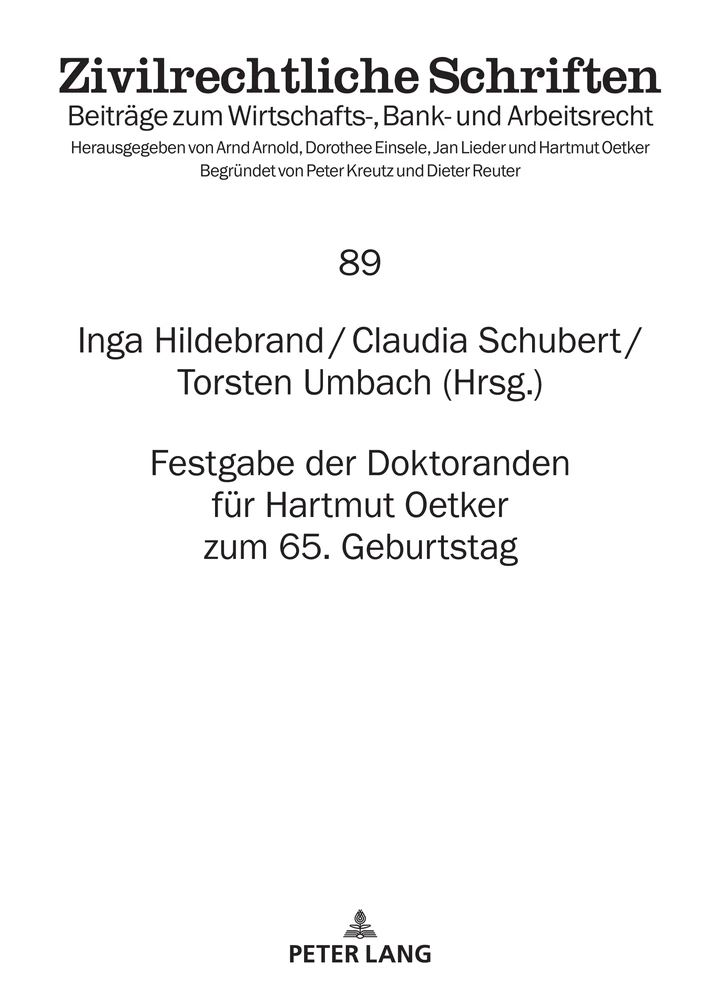Festgabe der Doktoranden für Hartmut Oetker zum 65. Geburtstag
Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Vorwort
- Inhaltsverzeichnis
- Autorenverzeichnis
- Die strafrechtliche Verantwortlichkeit des faktischen Geschäftsführers einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung anhand ausgewählter Straftatbestände des Wirtschaftsstrafrechts
- Umfang der Anhörung des Betriebsrates bei sexueller Belästigung
- Praxisfragen bei Zustimmungsbeschlüssen der Hauptversammlung zu Transaktionen nach § 179a AktG
- Das Strafverfahren wird digital – ein Überblick
- Grenzen des gesetzlichen Unfallversicherungsschutzes im Homeoffice
- Anwendung des Nachweisgesetzes auf GmbH-Geschäftsführer?
- Die Nationalität des Luftfahrtunternehmens und die Luftfahrtstiftung
- Der infektionsschutzrechtliche Erstattungsanspruch des Arbeitgebers - Arbeitsrechtliche Probleme vor dem Verwaltungsgericht
- Der leitende Angestellte im besonderen Verhandlungsgremium der Société Européenne
- Das Hypotaxverfahren bei Auslandsentsendungen – eine arbeitsrechtliche Analyse aus Sicht des Arbeitgebers
- Förderung der Tarifautonomie und Arbeitnehmerschutz durch zwingendes Recht – ein Zielkonflikt in der RESC?
- Qualifizierte Nachrangklauseln in Nachrangdarlehensverträgen und Verbotsirrtum über die Erlaubnispflichtigkeit als Einlagengeschäft
- Die Einbeziehung arbeitnehmerähnlicher Personen in den Geltungsbereich der Personalvertretungsgesetze
Autorenverzeichnis
Sandra Bock
Staatsanwältin als Gruppenleiterin bei der Staatsanwaltschaft Gera, Dr. jur.
Matthias Dumke
Fachanwalt für Arbeitsrecht, Rechtsanwalt in Bremen, Dr. jur.
Charlotte Evers
Rechtsanwältin in Düsseldorf, Dr. jur.
Birgit Friese
Oberstaatsanwältin bei der Generalstaatsanwaltschaft Dresden, Dr. jur.
Kirstin Gottschalk
Richterin am Sozialgericht Meiningen, Dr. jur.
Inga Hildebrand
Richterin am Amtsgericht Hamburg-St. Georg, Dr. jur.
Jakob Hoffmann-Grambow
Rechtsanwalt in Hamburg, Dr. jur.
Ute Jung
Vorsitzende Richterin am Verwaltungsgericht Gera, Dr. jur.
Nathalie Oberthür
Fachanwältin für Arbeitsrecht, Rechtsanwältin in Köln, Dr. jur.
Petra Schleschka
Fachanwältin für Arbeitsrecht, Syndikusrechtsanwältin bei Nordmetall, Verband der Metall- und Elektroindustrie e.V. in Hamburg, Dr. jur.
Claudia Schubert
Professorin für Bürgerliches Recht, Arbeitsrecht, Gesellschaftsrecht, Rechtsvergleichung an der Universität Hamburg, Dr. jur.
Torsten Umbach
Richter am Oberlandesgericht Dresden, Dr. jur.
René Weißflog
Fachanwalt für Arbeitsrecht, Rechtsanwalt und Notar in Berlin, Dr. jur.
Sandra Bock
Die strafrechtliche Verantwortlichkeit des faktischen Geschäftsführers einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung anhand ausgewählter Straftatbestände des Wirtschaftsstrafrechts
I.Einleitung
Die wirtschaftsstrafrechtliche Praxis sieht sich wiederholt mit dem Phänomen konfrontiert, dass bei einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung der im Handelsregister eingetragene Geschäftsführer nicht mit der Person übereinstimmt, die tatsächlich die maßgeblichen unternehmensleitenden Entscheidungen trifft. In diesen Fällen stellt sich die Frage, ob auf die tatsächlich handelnde Person, den so genannten faktischen Geschäftsführer, die Straftatbestände angewendet werden können, die für den im Handelsregister eingetragenen Geschäftsführer einschlägig wären.
II.Voraussetzungen für das Vorliegen faktischer Geschäftsführung
1.Erscheinungsformen in der Praxis
Ein nicht selten anzutreffender Grund dafür, dass die tatsächlichen Führungspersonen im Handelsregister nicht als Geschäftsführer in Erscheinung treten, ergibt sich aus dem Umstand, dass die Person, welche die Leitung der Gesellschaft eigentlich übernehmen möchte, aufgrund einer Verurteilung wegen einer der in § 6 Abs. 2 Nr. 3 GmbHG genannten Straftaten nicht Geschäftsführer sein kann. Häufig handelt es sich dabei um Unternehmen, die sich bereits in einer Krise befunden haben und nun mit einer neu gegründeten Gesellschaft als Unternehmensträger weitergeführt werden sollen. Der faktische Geschäftsführer hält unter Umständen die Gesellschaftsanteile vollständig oder zum überwiegenden Teil. Nicht selten übernimmt er die Funktion eines Prokuristen oder eines anderen leitenden Angestellten im Unternehmen, um die Geschäfte tatsächlich führen zu können.
In der Praxis ebenso häufig ist die Konstellation, dass die im Handelsregister eingetragenen Geschäftsführer einer notleidend gewordenen Gesellschaft, gegen meist wenig qualifizierte und unerfahrene Strohleute ausgetauscht werden, um die eigentliche Geschäftsführung vor einer drohenden, insbesondere strafrechtlichen Haftung zu bewahren. Seine Handlungsfähigkeit stellt der faktische Geschäftsführer oftmals über eine Generalvollmacht sicher. Die Gesellschaftsanteile werden zu symbolischen Kaufpreisen - nicht selten an die neuen Geschäftsführer - veräußert. In diesen Fällen ist in der Regel überhaupt nicht beabsichtigt, die Gesellschaft ordnungsgemäß abzuwickeln und ein Insolvenzverfahren in Gang zu setzen.1
Davon zu unterscheiden sind die von § 14 Abs. 3 StGB erfassten Fälle, in denen eine fehlerhafte Bestellung des Geschäftsführers vorliegt. Wenn der Bestellungsakt rechtlich nicht wirksam ist, wird der Geschäftsführer gleichsam auch als faktischer Geschäftsführer tätig. Allerdings war durch die Gesellschafter ursprünglich - anders als in den zuvor geschilderten Sachverhaltskonstellationen - ein Gleichlauf zwischen materiell-rechtlicher Bestellung und Eintragung im Handelsregister beabsichtigt. Auf diese Fälle zielt die Rechtsfigur des faktischen Geschäftsführers nicht primär ab.2
2.Die tatbestandlichen Voraussetzungen der faktischen Geschäftsführung
Die Rechtsprechung hat schon früh auf das Phänomen reagiert und verschiedene Straftatbestände auch auf den faktischen Geschäftsführer angewendet.3 Voraussetzungen für die Gleichstellung des faktischen mit dem formell bestellten Geschäftsführer sind ein Tätigwerden im Einverständnis mit den Gesellschaftern oder der Mehrheit der Gesellschafter und die tatsächliche Ausübung der Funktion eines Geschäftsführers.4
Dabei qualifiziert der BGH das Einverständnis der Gesellschafter mit dem Auftreten des faktischen Geschäftsführers bzw. das Gewährenlassen als Bestellungsakt.5 Dass dem Bestellungsakt wegen der Nichteinhaltung der gesellschaftsrechtlichen Mindestanforderungen unter Umständen die zivilrechtliche Wirksamkeit fehle, stünde dem Umstand, dass die Bestellung durch die Gesellschafter tatsächlich stattgefunden habe, nicht entgegen. Die fehlende Eintragung im Handelsregister habe keinen Einfluss auf die Wirksamkeit der Bestellung, sie habe lediglich rechtsbekundende Wirkung.6 Die Rechtsprechung geht demnach von einer konkludenten Bestellung des faktischen Geschäftsführers zum Geschäftsführer im gesellschaftsrechtlichen Sinne aus.7
Nach den Vorgaben der Rechtsprechung müssen sowohl betriebsintern als auch nach außen alle Dispositionen weitgehend von dem faktischen Geschäftsführer ausgehen und er müsse im übrigen auf sämtliche Geschäftsvorgänge bestimmenden Einfluss nehmen.8 Die Entscheidung, ob faktische Geschäftsführung vorliegt, sei eine Rechtsfrage, die auf der Grundlage konkreter Tatsachenfeststellungen zu treffen sei.9 Es sei erforderlich, dass die Urteilsfeststellungen ein Bild von den Verhältnissen ergeben, das Rückschlüsse auf die konkrete Tätigkeit und ihren Umfang zulässt.10 Die obergerichtliche Rechtsprechung hat diesbezüglich acht klassische Kernbereiche der Geschäftsführung identifiziert, von denen die tatsächlich handelnde Person einen wesentlichen Teil wahrnehmen müsse. Namentlich handelt es sich dabei um die Bestimmung der Unternehmenspolitik, die Organisation des Unternehmens, die Einstellung von Mitarbeitern, die Bestimmung der Gehaltshöhe, die Gestaltung der Geschäftsbeziehungen zu Vertragspartnern, Verhandlungen mit Kreditgebern, Entscheidungen in Steuerangelegenheiten und die Steuerung der Buchhaltung.11 Eine formale Betrachtung, wonach faktische Geschäftsführung dann anzunehmen sei, wenn mindestens sechs dieser acht Kriterien erfüllt seien,12 ist allerdings abzulehnen, da sie der Vielgestaltigkeit des Wirtschaftslebens und den Besonderheiten des Einzelfalls nicht gerecht wird.13
Dass neben dem faktischen Geschäftsführer ein formeller Geschäftsführer existiert, lässt die Gleichstellung nicht entfallen, so lange der faktische Geschäftsführer gegenüber dem formellen Geschäftsführer die überragende Stellung einnimmt oder zumindest das deutliche Übergewicht hat.14
III.Anwendbarkeit des § 15a Abs. 4 InsO auf den faktischen Geschäftsführer
Durch das Gesetz zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Bekämpfung von Missbräuchen (MoMiG) v. 23.10.2008 wurden die bis dahin in verschiedenen gesellschaftsrechtlichen Gesetzen enthaltenen Regelungen zur Insolvenzantragspflicht in § 15a der Insolvenzordnung zusammengefasst und durch einen einheitlichen Straftatbestand in Abs. 4 ergänzt. Bei dem Vorwurf der Insolvenzverschleppung handelt es sich um ein Sonderdelikt. Nur der zur Stellung eines Insolvenzantrags verpflichtete Personenkreis kann auch Täter einer Insolvenzverschleppung sein.15 § 15a Abs. 4 InsO verweist diesbezüglich auf die in Abs. 1 bis 3 der Vorschrift geregelten Tatbestände der Insolvenzantragspflicht.
1.Meinungsstand
Der BGH wendet den Tatbestand der Insolvenzverschleppung in ständiger Rechtsprechung unmittelbar auf den faktischen Geschäftsführer an.16 Der Wortlaut des § 15a Abs. 1 S. 1 InsO, welcher unter anderem die „Mitglieder des Vertretungsorgans“ nennt, schließe den faktischen Geschäftsführer nicht aus.17 Die höchstrichterliche Rechtsprechung stellt maßgeblich auf den Zweck des Straftatbestandes ab, der darin bestehe, die Allgemeinheit vor einer kriminellen Handhabung der Geschäftsführung einer GmbH zu schützen.18 Derjenige, der die faktische Geschäftsführung inne habe und die Führung der Geschäfte bestimme, müsse auch die Pflichten erfüllen, die den Geschäftsführer treffen und bei deren Verletzung die strafrechtlichen Folgen tragen, die das Gesetz an eine solche Pflichtverletzung durch den Geschäftsführer knüpfe.19 Dem treten Stimmen in der Literatur mit dem Einwand entgegen, die Anwendung des § 15a Abs. 4 InsO auf den faktischen Geschäftsführer verstoße gegen das Analogieverbot und das Bestimmtheitsgebot.20
2.Auslegung des § 15a Abs. 4 i.V.m. Abs. 1 S. 1 InsO
Da die Rechtsprechung den faktischen Geschäftsführer als einen konkludent bestellten Geschäftsführer qualifiziert, handelt es sich rechtsmethodisch bei der Gleichstellung des faktischen Geschäftsführers mit dem formell bestellten Geschäftsführer nicht um eine Analogie,21 sondern um eine weite Auslegung des Merkmals „Mitglieder des Vertretungsorgans“.
Dem BGH ist darin zuzustimmen, dass § 15a Abs. 1 S. 1 InsO unter „Mitglieder des Vertretungsorgans“ zusammenfassend die Verantwortlichen verschiedener juristischer Personen umschreibt.22 Die Formulierung enthält keine Einschränkungen, die auf das Erfordernis einer förmlichen Bestellung des Vertretungsorgans abzielen und lässt so genügend Spielraum, darunter auch faktische Vertretungsorgane, insbesondere den faktischen GmbH-Geschäftsführer zu fassen.
Eine weite Auslegung des Personenkreises der Mitglieder des Vertretungsorgans fügt sich auch in die Verwendung des Begriffs „Geschäftsführer“ im GmbHG ein. Das Tatbestandsmerkmal wird im GmbHG nicht ausschließlich für förmlich wirksam bestellte Geschäftsführer verwendet. In § 6 Abs. 3 GmbHG wird geregelt, welche Personen nicht Geschäftsführer sein können. Folgerichtig spricht die Haftungsnorm in § 6 Abs. 5 GmbHG von „einer Person, die nicht Geschäftsführer sein kann,“ und nicht von „Geschäftsführer“. Dies wird in den Strafnormen des § 82 Abs. 1 GmbH jedoch nicht mehr durchgehalten. Bei der Gründungstäuschung (§ 82 Abs. 1 Nr. 1 GmbHG) ist die GmbH in der Regel noch nicht im Handelsregister eingetragen und besteht als solche noch nicht, so dass derjenige, der „als Geschäftsführer“ für die einzutragende GmbH tätig wird, noch kein rechtswirksam bestellter Geschäftsführer sein kann.23 Auch falsche Angaben im Sinne von § 82 Abs. 1 Nr. 5 GmbHG kann eine „Person, die nicht Geschäftsführer sein kann“ streng genommen nicht „als Geschäftsführer“ machen. Aber gerade auch diesen Sachverhalt stellt § 82 Abs. 1 Nr. 5 GmbHG unter Strafe. Das GmbHG und insbesondere die in § 82 GmbHG geregelten Straftatbestände erfassen unter dem Merkmal „Geschäftsführer“ somit auch faktische Geschäftsführer.
§ 14 Abs. 3 StGB, der nur einen Teil der denkbaren Fälle faktischer Geschäftsführung erfasst, steht systematisch der Anwendung des § 15a Abs. 4 InsO auf faktische Geschäftsführer nicht entgegen.24 § 14 StGB regelt die Anwendbarkeit von Tatbeständen, die besondere persönliche Merkmale enthalten, welche die Strafbarkeit begründen, auf Vertreter der Personen, bei denen diese Merkmale vorliegen. § 15a Abs. 4 InsO ist jedoch unmittelbar auf die Mitglieder des Vertretungsorgans anzuwenden. Bei der Mitgliedschaft im Vertretungsorgan handelt es sich allenfalls um ein besonderes persönliches Merkmal des Geschäftsführers, nicht jedoch der vertretenen juristischen Person. § 14 StGB ist auf diese Fallkonstellation nicht zugeschnitten25 und sollte nach dem Willen des Gesetzgebers die Strafvorschriften für Organe juristischer Personen unberührt lassen.26
Sinn und Zweck der Insolvenzantragspflicht und der Strafbewehrung einer Verletzung dieser Pflicht ist der Schutz der Gläubiger einer juristischen Person vor einer Verringerung des zur Befriedigung der Verbindlichkeiten zur Verfügung stehenden Gesellschaftsvermögens sowie der Schutz neuer Gläubiger vor einem Vertragsschluss mit einer notleidend gewordenen Gesellschaft und einem damit verbundenen Ausfall der gegen sie begründeten Forderung.27 Dieser Schutzzweck gebietet gerade auch die Einbeziehung faktischer Geschäftsführer, da sich durch deren Tätigwerden die Gefahren realisieren, welchen durch die Insolvenzantragspflicht begegnet werden soll.28 Auch können nur so Strafbarkeitslücken vermieden werden, die entstehen, wenn - z.B. mangels vorsätzlichen Handelns des eingetragenen Geschäftsführers - die Anwendung der Vorschriften zur Teilnahme auf den faktischen Geschäftsführer ausscheidet.29
Der Einwand gegen die Gleichstellung, der faktische Geschäftsführer könne einen wirksamen Insolvenzantrag überhaupt nicht stellen,30 trägt nicht. Zum einen wird unter bestimmten Voraussetzungen ein Insolvenzantrag des faktischen Geschäftsführers für zulässig gehalten.31 Zum anderen kann der faktische Geschäftsführer seine Stellung nutzen, um auf eine rechtzeitige Insolvenzantragstellung durch den eingetragenen Geschäftsführer hinzuwirken,32 so dass der strafrechtliche Unrechtsvorwurf bei dem faktischen Geschäftsführer zu Recht auch an ein derartiges Unterlassen anknüpft.
Schließlich ist auch der Regierungsbegründung zu dem Entwurf des MoMiG zu entnehmen, dass durch die Neuregelung des § 15a InsO die Verantwortlichkeit des faktischen Geschäftsführers nicht eingeschränkt werden sollte.33
IV.Anwendbarkeit der in § 283 StGB enthaltenen Bankrotttatbestände auf den faktischen Geschäftsführer
Die in § 283 StGB enthaltenen Straftatbestände setzen jeweils voraus, dass der Täter sich als Schuldner in einer Krise befindet, d.h. dass er überschuldet oder zahlungsunfähig ist oder ihm die Zahlungsunfähigkeit droht. Sämtliche Bankrotttatbestände sind somit ebenfalls Sonderdelikte.34 Die Bankrotttatbestände unterscheiden nicht zwischen natürlichen und juristischen Personen. Die strafrechtliche Verantwortlichkeit des Vertreters einer juristischen Person wird durch § 14 StGB geregelt, welcher vorsieht, dass ein Tatbestand, nach dem besondere persönliche Merkmale die Strafbarkeit begründen, auch auf den Vertreter anzuwenden ist, bei dem die besonderen persönlichen Merkmale - wie hier die Schuldnereigenschaft - nicht vorliegen.
1.Meinungsstand
Der BGH rechnet dem faktischen Geschäftsführer das besondere persönliche Merkmal der Schuldnereigenschaft gemäß § 14 Abs. 1 Nr. 1 StGB zu.35
Ein Teil der Literatur bezieht sowohl die Fälle in den Tatbestand des § 14 Abs. 3 StGB ein, in denen ein vorliegender ausdrücklicher rechtsgeschäftlicher Bestellungsakt unwirksam ist, als auch die Fälle der faktischen Geschäftsführung im engeren Sinne, in denen es an einem ausdrücklichen rechtsgeschäftlichen Bestellungsakt fehlt.36 Andere Stimmen wiederum leiten aus dem in § 14 Abs. 3 StGB enthaltenen Merkmal der „Rechtshandlung“ das Erfordernis eines ausdrücklichen rechtsgeschäftlichen Bestellungsaktes ab und schreiben der Norm eine Sperrwirkung zu, nach der auch die Tatbestände des § 14 Abs. 1 StGB auf Fälle beschränkt seien, in denen ein ausdrücklicher rechtsgeschäftlicher Bestellungsakt vorliegt.37 Teilweise wird die Zurechnung sodann über § 14 Abs. 2 Nr. 1 StGB vorgenommen.38
Details
- Seiten
- 230
- Erscheinungsjahr
- 2024
- ISBN (PDF)
- 9783631919804
- ISBN (ePUB)
- 9783631919811
- ISBN (Hardcover)
- 9783631919736
- DOI
- 10.3726/b21888
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2024 (Mai)
- Schlagworte
- Strafverfahren wird digital Unfallversicherungsschutz Nachweisgesetz Hypotaxverfahren bei Auslandsentsendungen Tarifautonomie und Arbeitnehmerschutz § 179a AktG Anhörung des Betriebsrates bei sexueller Belästigung strafrechtliche Verantwortlichkeit des faktischen Geschäftsführers
- Erschienen
- Berlin, Bruxelles, Chennai, Lausanne, New York, Oxford, 2024. 230 S.
- Produktsicherheit
- Peter Lang Group AG