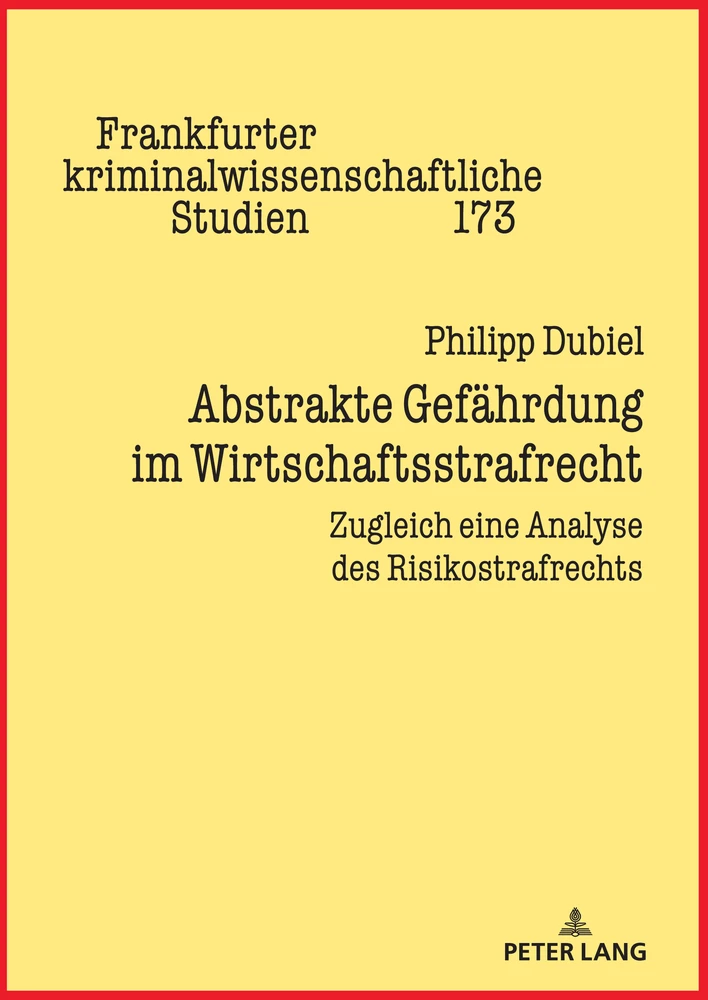Abstrakte Gefährdung im Wirtschaftsstrafrecht
Zugleich eine Analyse des Risikostrafrechts
Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Vorwort
- Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitende Bemerkungen zur Untersuchung
- I. Problemaufriss, Gang und Aufbau der Untersuchung
- II. Begriffliche Eingrenzung des Wirtschaftsstrafrechts
- B. Abstrakte Gefährdung im Wirtschaftsstrafrecht
- I. Bezugspunkte zur Bestimmung von Deliktsstrukturen
- 1. Das Verhältnis von Deliktsstruktur und Rechtsgut
- a) Herkömmliche Ansätze
- b) Akzentverschiebung hin zur Tathandlung
- 2. Zusammenfallen mehrerer Zwecke in einer Strafbestimmung
- 3. Deliktstypologie im Bereich kollektiver Rechtsgüter
- II. Typisierung der Gefahrdelikte
- 1. Abstrakte Gefährdungsdelikte im Wirtschaftsstrafrecht
- 2. Die Kontroverse um Begriff und Inhalt der abstrakten Gefährdung
- a) Ideengeschichtlicher Abriss zur abstrakten Gefährdung
- aa) Abstrakte Gefährdung als rechtsgutsspezifischer Erfolg
- bb) Verhaltensorientierte Auffassungen
- cc) Resümee
- b) Abstrakte Gefährlichkeitsdelikte nach Zieschang
- 3. Die weitere Einteilung nach Zieschang
- a) Defizite der herkömmlichen Deliktsstrukturtrias
- b) Das konkrete Gefährdungsdelikt
- c) Das konkrete Gefährlichkeitsdelikt
- d) Das potenzielle Gefährdungsdelikt
- 4. Tatbestandlich verankerte Erheblichkeitsvorbehalte
- III. Abgrenzung der Gefahrdelikte von angrenzenden Deliktsformen
- 1. Abgrenzung zu den Verletzungsdelikten
- 2. Abgrenzung zu den Vorbereitungsdelikten
- IV. Zwischenergebnis
- C. Einzelne Gefahrdelikte des Wirtschaftsstrafrechts
- I. Betrugsderivate
- 1. Falschangabedelikte
- a) Die „klassischen“ erfolgskupierten Betrugsderivate
- aa) Subventionsbetrug
- (a) Rechtsgut
- (b) Tatbestandsstruktur
- (c) Deliktsstruktur
- bb) Kapitalanlagebetrug
- (a) Rechtsgut
- (b) Tatbestandsstruktur
- (c) Deliktsstruktur
- cc) Kreditbetrug
- (a) Rechtsgut
- (b) Tatbestandsstruktur
- (c) Deliktsstruktur
- b) Falsche Angaben gegenüber einem Registergericht
- aa) Rechtsgut
- bb) Tatbestandsstruktur
- cc) Deliktsstruktur
- c) Falsche Angaben gegenüber einem Prüfer
- aa) Rechtsgut
- bb) Tatbestandsstruktur
- cc) Deliktsstruktur
- 2. Unrichtige Darstellung
- a) Rechtsgut
- b) Tatbestandsstruktur
- c) Deliktsstruktur
- 3. Versicherungsmissbrauch
- a) Rechtsgut
- b) Tatbestandsstruktur
- c) Deliktsstruktur
- II. Wettbewerbsdelikte
- 1. Rechtsgut der Wettbewerbsdelikte
- 2. Wettbewerbsbeschränkende Absprachen bei Ausschreibungen
- a) Tatbestandsstruktur
- b) Deliktsstruktur
- 3. Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr
- a) Tatbestandsstruktur
- b) Deliktsstruktur
- III. Insolvenzdelikte
- 1. Verletzung der Anzeigepflicht
- a) Rechtsgut
- b) Tatbestandsstruktur
- c) Deliktsstruktur
- 2. Verletzung der Buchführungspflicht
- a) Rechtsgut
- b) Tatbestandsstruktur
- aa) § 283 I Nr. 5, Var. 2 und 3, 6, 7a StGB
- bb) § 283 I Nr. 5, Var. 1, 7b StGB
- c) Deliktsstruktur
- aa) § 283 I Nr. 7a StGB
- bb) § 283 I Nr. 7b StGB
- 3. Schmälerung der Insolvenzmasse
- a) Rechtsgut
- b) Tatbestandsstruktur
- aa) § 283 I Nr. 1, Var. 1 und 3, 2, 3, 8 Alt. 1 StGB
- bb) § 283 I Nr. 1 Var. 2, 4, 8 Alt. 2 StGB
- c) Deliktsstruktur
- aa) § 283 I Nr. 1 Var. 1 StGB
- bb) § 283 I Nr. 1 Var. 2 StGB
- IV. Weitere Delikte des Wirtschaftsstrafrechts
- 1. Verletzung der Berichtspflicht
- a) Rechtsgut
- b) Tatbestandsstruktur
- c) Deliktsstruktur
- 2. Verletzung der Geheimhaltungspflicht
- a) Rechtsgut
- b) Tatbestandsstruktur
- c) Deliktsstruktur
- aa) § 333 I HGB
- bb) § 333 II 2 HGB
- 3. Verletzung der Pflichten bei Abschlussprüfungen
- a) Rechtsgut
- b) Tatbestandsstruktur
- aa) Tatbestände des § 334 IIa HGB
- bb) Zusätzliche strafbegründende Tatbestandsvoraussetzungen
- c) Deliktsstruktur
- 4. Verletzung der (Einberufungs- und) Verlustanzeigepflicht
- a) Rechtsgut
- b) Tatbestandsstruktur
- c) Deliktsstruktur
- 5. Ordnungswidriges Betreiben von Geschäften
- a) Rechtsgut
- b) Tatbestandsstruktur
- c) Deliktsstruktur
- V. Zusammenfassende Würdigung und Ausblick
- 1. Leitlinien zur Bestimmung gefahrdeliktischer Strukturen
- 2. Vorüberlegungen zur Einordnung von Gefahrdelikten
- D. Risikowirtschaftsstrafrecht
- I. Gefahrdelikte als Risikostrafrecht
- 1. Strafrechtliche Expansion
- a) Die Ausweitungstendenz
- b) Entzerrung der terminologischen Gemengelage
- c) Einführung des strafrechtlichen Vorverlagerungsbegriffs
- d) Genese der strafrechtlichen Vorverlagerung
- aa) Die Aussagen Moellers
- bb) Übertragbarkeit auf das Wirtschaftsstrafrecht
- 2. Charakterisierung als Risikostrafrecht
- a) Gefahrdelikte als Vorverlagerung
- b) Begriff des Risikostrafrechts
- c) Anwendbarkeit auf das Wirtschaftsstrafrecht
- II. Gesellschaftliche Ursachen der strafrechtlichen Expansion
- 1. Soziologische Befunde zur Risikogesellschaft
- a) Großrisiken
- b) Orientierungsunsicherheit
- c) Staatliche Intervention
- 2. Soziologische Befunde zur Sicherheitsgesellschaft
- a) Gesellschaftliche Transformationsprozesse
- b) Das Paradigma der Sicherheit
- III. Risikostrafrecht und Wirtschaftsstrafrecht
- 1. Bestandsaufnahmen zum Risikostrafrecht
- a) Jakobs’ Feindstrafrecht
- b) Die Analyse der sog. Frankfurter Richtung
- c) Integration in eine umfassende Sicherheitsarchitektur
- aa) Großunternehmung „Soziale Kontrolle“ bei Singelnstein/Stolle
- bb) Umfassende Sicherheitsarchitektur nach Sieber
- cc) Kriminalpräventives Strafrecht nach Bäcker
- d) Risikosteuerung durch Strafrecht nach Brunhöber
- e) Prädiktionsstrafrecht nach Burchard
- f) Mosaiksteine eines Risikostrafrechts
- 2. Spezifizierung anhand des Wirtschaftsstrafrechts
- a) Materiellrechtliche Entwicklungen und ihre Auswirkungen auf das Strafverfahren
- aa) Materielle Beweiserleichterungen
- (a) Entmaterialisierung von Rechtsgütern
- (b) Verzicht auf einen rechtsgutsspezifischen Erfolg
- (c) Herabsetzen subjektiver Tatbestandsvoraussetzungen
- (d) Unbestimmte Tatbestandsmerkmale
- bb) Aufgreifnormen
- b) Sicherheitsarchitektur zur Bewältigung von Wirtschaftskriminalität
- aa) Criminal Compliance
- (a) Die Rationale hinter Criminal Compliance
- (b) Criminal Compliance als privatisierte strategische Überwachung
- (c) Criminal Compliance und Risikosteuerung
- bb) Whistleblowing
- cc) Wirtschaftsstrafrecht als sola ratio?
- c) Selektive Strafverfolgung
- aa) Exemplarisch: Verständigung nach § 257c StPO
- bb) Risikosteuerung durch Selektion und Informalisierung
- d) Auflösung tradierter Zurechnungsregeln
- aa) Haftungstrias aus §§ 130, 30, 9 OWiG
- bb) Neue Form der mittelbaren Täterschaft
- IV. Risikowirtschaftsstrafrecht
- E. Plädoyer wider eine Aussonderung des Risikowirtschaftsstrafrechts
- I. Ausgewählte Spannungsfelder des Risikowirtschaftsstrafrechts
- 1. Materiellrechtliche Spannungsfelder
- a) Uferlosigkeit des Rechtsgüterschutzdenkens
- b) Entgrenzungstendenz von Gefährlichkeitsdelikten
- aa) Grenzgänge der Vorverlagerung
- bb) Einbeziehung von Bagatellen
- cc) Inkriminierung der Leichtfertigkeit
- dd) Grenzen struktureller Zurechnung am Beispiel von Strafrecht und KI
- ee) Friktionen mit dem Bestimmtheitsgrundsatz
- (a) Gestaltungsmacht für Verfolgungsbehörden
- (b) Wechselwirkung zu Aufgreifnormen
- 2. Strafprozessuale Spannungsfelder
- a) Internal Investigations
- b) Verständigung nach § 257c StPO
- 3. Das symbolische Strafrecht
- a) Das Symbolische am symbolischen Strafrecht
- b) Alles Strafrecht ist symbolisch
- c) Spezifizierung der Kritik
- aa) Überflüssige Mehrfachabsicherungen
- bb) Überpräzise Strafbestimmungen
- II. Die Trennungsthese und ihre Spielarten
- 1. Einführung eines Strafrechts sui generis
- a) Bürger- und Feindstrafrecht (Jakobs)
- b) Kern- und Interventionsrecht (Hassemer)
- c) Kritik
- aa) Grundzüge der Kritik an Jakobs’ Feindstrafrecht
- bb) Einwände gegen die Konzeption Hassemers
- cc) Übergreifende Einwände gegen die Einführung eines Strafrechts sui generis
- 2. Divisionalisierungsthese (Rotsch)
- a) Kern- und Wirtschaftsstrafrecht
- b) Kritik
- aa) Divisionalisierung anhand phänomenologischer Kategorien
- bb) Verkehrung von Zurechnungsregeln im Wirtschaftsstrafrecht
- cc) Weitere Einwände gegen die Divisionalisierungsthese
- 3. Verbringung in das Ordnungswidrigkeitenrecht (Zieschang)
- a) Straf- und Ordnungswidrigkeitenrecht
- b) Einwände gegen eine Verbringung ins Ordnungswidrigkeitenrecht
- aa) Ordnungswidrigkeitenrecht als Sammelbecken heterogener Phänomene
- bb) Abstrakte Gefährlichkeitsdelikte als Ordnungswidrigkeitenrecht
- 4. Übergreifende Einwände gegen die Trennungsthese
- a) Verfassungsrechtliche Rückkopplung des Ultima-ratio-Gedankens?
- aa) Ultima-ratio-Gedanke als Fundament von Trennungsthesen
- bb) Ultima-ratio-Gedanke in der verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung
- cc) Ultima-ratio-Gedanke und Verhältnismäßigkeitsprinzip
- dd) Relativität des Kriminalstrafrechts
- ee) Zusammenfassende Würdigung
- b) Das Spezifikum der Kriminalstrafe?
- aa) Kriminalstrafe als sozialethischer Tadel (Strafrechtswissenschaft)
- bb) Kriminalstrafe als Stigma (Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte)
- cc) Kriminalstrafe in der Grundrechtsdogmatik
- (a) Sozialethischer Tadel als Normrehabilitierungsprogramm (Appel)
- (b) Allgemeiner staatlicher Vorwurf normwidrigen Verhaltens (Lagodny)
- (c) Qualitativ singulärer Eingriff in das Allgemeine Persönlichkeitsrecht?
- dd) Zusammenfassende Würdigung
- c) Defizitäre Operabilität
- 5. Keine Aussonderung des Risikowirtschaftsstrafrechts
- F. Schlussbetrachtung
- Abkürzungsverzeichnis
- Entscheidungsverzeichnis
- Literaturverzeichnis
A. Einleitende Bemerkungen zur Untersuchung
I. Problemaufriss, Gang und Aufbau der Untersuchung
Unter den Geltungsbedingungen gegenwärtiger Risiko- bzw. Sicherheitsgesellschaften1 hat sich das Strafrecht, so konstatiert die deutsche Strafrechtswissenschaft,2 gewandelt. Im Kontrast zu der Einigkeit hinsichtlich des „Ob“ steht der Diskurs über das „Wie“ des Funktionswandels. Ein Konsens lässt sich weitestgehend noch für eine Ausdehnungstendenz des Strafrechts, d. h. sein Vordringen in gesellschaftliche Bereiche, die in vergangenen Zeiten der strafrechtlichen Regulierung entzogen waren, erzielen. Ebenfalls erhält die Analyse, wonach diese Ausdehnungstendenz im Wege von Vorfeldkriminalisierungen und Vorverlagerungstechniken vollzogen wird, Zustimmung von weiten Teilen der Strafrechtswissenschaft.3 In den Worten Hassemers hat das sog. abstrakte Gefährdungsdelikt als Fluchtpunkt des analytischen und kritischen Zugangs der Strafrechtswissenschaft4 das Erfolgsdelikt als „Normalform deliktischen Handelns“5 abgelöst. Neben dem Umwelt- und Betäubungsmittelstrafrecht6 und in neuerer Zeit auch dem Terrorismusstrafrecht7 gilt schließlich das Wirtschaftsstrafrecht als Beispiel für den strafrechtlichen Funktionswandel.8 Den Tatbeständen des Wirtschaftsstrafrechts wird weitestgehend attestiert, sog. abstrakte Gefährdungsdelikte zu sein.9 Darüber hinaus bietet die strafrechtswissenschaftliche Rezeption des Funktionswandels ein breites Spektrum an Analysezugängen und Befunden an, die, je nach Zugang, unterschiedliche Aspekte des strafrechtlichen Funktionswandels unterstreichen.10
Vor diesem Hintergrund sucht die Untersuchung den Funktionswandel des Strafrechts anhand des Wirtschaftsstrafrechts strafrechtsdogmatisch und funktional zu ergründen. Hierfür wird der These nachgegangen, beim geltenden Wirtschaftsstrafrecht handele es sich um ein Risikowirtschaftsstrafrecht. Der strafrechtsdogmatische Teil der Untersuchung nimmt seinen Ausgang bei dem Befund, das geltende Wirtschaftsstrafrecht sei in weiten Teilen von den sog. abstrakten Gefährdungsdelikten durchzogen (B. II. 1). Daher rückt die Untersuchung in diesem Teil die sog. abstrakte Gefährdung ins Zentrum der Betrachtung. Zu klären sein wird der Inhalt der abstrakten Gefährdung. Daran anschließend sind die sog. abstrakten Gefährdungsdelikte ausdifferenzierend zu typologisieren (B. II. 2). Damit zusammenhängend interessiert auch die Verortung der sog. abstrakten Gefährdungsdelikte, d. h. ihre Unterscheidung von angrenzenden Deliktsstrukturen. Aus der Zusammenschau der Befunde zu den sog. abstrakten Gefährdungsdelikten wird mit Zieschang und Hirsch die Kategorie der Gefahrdelikte als Gegenvorschlag zu den sog. abstrakten Gefährdungsdelikten eingeführt (B. II. 3 ff.). Die aufgefundenen Deliktsstrukturen werden einerseits „nach oben hin“ von den Verletzungsdelikten, wichtiger noch aber „nach unten hin“ von den Vorbereitungsdelikten abzugrenzen sein (B. III). Nachdem die strafrechtsdogmatischen Grundlagen der Gefahrdelikte ergründet wurden, lenkt die Untersuchung ihren Blick auf einzelne Delikte des geltenden Risikowirtschaftsstrafrechts. Hier verfolgt sie eine systematisierende Aufarbeitung der Gefahrdelikte wirtschaftsstrafrechtlicher Natur. Neben den einschlägigen Delikten des Kernstrafrechts werden Straftatbestände im finanzrechtlichen, kapitalmarktrechtlichen und gesellschaftsrechtlichen Kontext ins Zentrum der Betrachtung gestellt. Ziel ist es, die Bedeutung der Gefahrdelikte für das Wirtschaftsstrafrecht herauszuarbeiten und hervorzuheben. Neben dem Kernstrafrecht soll auf diesem Wege auch dem vielfach nur peripher11 wahrgenommenen Nebenstrafrecht Visibilität verschafft werden. Es gilt, Leitlinien für die Bestimmung gefahrdeliktischer Strukturen zu entwickeln sowie die Grundlage zu schaffen, auf Basis derer das Wirtschaftsstrafrecht als Risikowirtschaftsstrafrecht klassifiziert werden soll (C).
Anknüpfend und in Rückkopplung an die strafrechtsdogmatische Durchleuchtung der risikowirtschaftsstrafrechtlichen Tatbestände (C. I ff.) sowie im Lichte der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen der strafrechtlichen Expansion mittels Vorverlagerungstechniken (D. II) unternimmt der weitere Gang der Untersuchung den Versuch, den Funktionswandel des Wirtschafts- hin zu einem Risikowirtschaftsstrafrecht stärker zu konturieren. Dazu werden funktionale Aspekte ins Zentrum gerückt. Es wird zu prüfen sein, inwiefern der strafrechtliche Funktionswandel als Wandel hin zu einem Risikostrafrecht bezeichnet werden kann (D. I. 2). Unter Rückgriff auf den Bestand der Analysen, die die Strafrechtswissenschaft zum strafrechtlichen Funktionswandel anbietet,12 soll die Funktionserweiterung des Strafrechts beleuchtet werden. Es sollen mithin die Bausteine des strafrechtlichen Funktionswandels erschlossen werden (D. III. 1). Im Anschluss wendet die Untersuchung ihren Blick auf die Frage, inwiefern die vorgefundenen Bausteine des Funktionswandels auf das Wirtschaftsstrafrecht angewendet werden können (D. III. 2). Auf Grundlage der konturierten Funktionserweiterung des Strafrechts wird die Tauglichkeit dieser Analyse für die Beschreibung des Zustands des geltenden Wirtschaftsstrafrechts auf den Prüfstand gestellt. Auf diesem Wege sollen die Mosaiksteine des Risikowirtschaftsstrafrechts gebildet werden (D. IV). Vorangestellt gilt es, die Gefahrdelikte in das System der Vorverlagerung sowie in die strafrechtliche Ausdehnungstendenz einzugliedern (D. I. 1 ff.).
Abschließend beschäftigt sich die Untersuchung mit den vor dem Hintergrund der strafrechtlichen Funktionserweiterung formulierten, sog. Trennungsthesen. Unter dem Schlagwort der Trennungsthese zusammengefasst, fordern Stimmen in der Literatur die Aussonderung des Risiko(-wirtschafts-)strafrechts bzw., je nach Spielart, von Teilen davon. Anstelle von Harmonisierungsversuchen schlagen Autoren wie Jakobs oder Hassemer, aber auch Zieschang und Rotsch daher vor, das Risiko(-wirtschafts-)strafrecht in eine gesonderte, z. T. neu zu schaffende Rechtsmaterie zu verbringen. Es wird der Frage nachzugehen sein, inwieweit der Problemlösungsansatz sog. Trennungsthesen der Wahrung eines an Rechtsstaatlichkeit und Liberalität ausgerichteten Strafrechts zuträglich ist. In dieser Hinsicht mündet die Untersuchung daher in ein Plädoyer wider eine Aussonderung des Risikowirtschaftsstrafrechts (E. II). Um das Bedürfnis nach der Bildung sog. Trennungsthesen zu begreifen, bedarf es eines Blickes auf zentrale Spannungsfelder, die die Funktionserweiterung des Strafrechts mit sich bringt. Vorangestellt wirft die Untersuchung daher, wiederum in Rückkopplung an die untersuchten Straftatbestände, Schlaglichter auf zentrale Spannungsfelder, die der Funktionswandel mit hergebrachten strafrechtsdogmatischen Grundsätzen produziert. Zwar liegt der Fokus der Untersuchung auf Fragen des materiellen Strafrechts. Daher sind die den Gefährlichkeitsdelikten immanenten Entgrenzungstendenzen einerseits (E. I. 1. b) ff.) sowie die kriminalpolitisch getriebene Kritik ineffizienter Strafgesetzgebung andererseits (E. I. 3) herauszuarbeiten. Dennoch kommt eine Kritik des Risikowirtschaftsstrafrechts aufgrund der Wechselwirkungen zwischen materiellem und prozessualem Strafrecht13 nicht ohne Bezüge zu Letzterem aus. Vereinzelt rücken daher auch strafprozessuale Spannungsfelder, die mit dem Risikowirtschaftsstrafrecht einhergehen, in den Vordergrund (E. I. 2).
Zusammengefasst versteht sich die vorliegende Untersuchung als eine Analyse der sog. abstrakten Gefährdungsdelikte bzw. der Gefahrdelikte im Wirtschaftsstrafrecht. Hierbei soll zum einen ein Beitrag zur Systematik und Bedeutung der Gefahrdelikte im Allgemeinen sowie der Gefahrdelikte des Risikowirtschaftsstrafrechts im Speziellen geleistet werden. Zum anderen versteht sich die Untersuchung als Versuch, zum Verständnis von Begriff und Inhalt des strafrechtlichen Funktionswandels, hier verstanden als Wandel hin zu einem Risiko(-wirtschafts-)strafrecht, beizutragen. Hinsichtlich des strafrechtsdogmatischen Teils der Arbeit beschränkt sich die Untersuchung auf das Kriminalstrafrecht. Aus der Natur des Risikowirtschaftsstrafrechts heraus folgt, wie noch zu zeigen sein wird,14 dass die Analyse und Bewertung des Risikowirtschaftsstrafrechts angrenzende Rechtsgebiete wie etwa das Ordnungswidrigkeiten-, Aufsichts- oder sonstige Verwaltungsrecht nicht vollständig ausblenden kann. Querbezüge werden insoweit hergestellt, als es notwendig erscheint, um das Risikowirtschaftsstrafrecht zu konturieren.
II. Begriffliche Eingrenzung des Wirtschaftsstrafrechts
Einleitend seien noch einige Hinweise zur Eingrenzung des Untersuchungsgegenstandes gegeben. Die Geschichte des Begriffs „Wirtschaftsstrafrecht“ in Deutschland prägt sein Definitionsmangel. Schon sein Regelungsgegenstand, die „Wirtschaft“, wartet mit einer Vielfalt von Erscheinungsmöglichkeiten auf.15 Entsprechend vielfältig gestalten sich auch die möglichen Bezugspunkte bei der Bewertung, inwieweit die Begehung einer Straftat wirtschaftskriminell konnotiert ist. Neben genuin marktwirtschaftlich eingefärbten Straftatbeständen, die gegen die Marktwirtschaft bzw. ihre Institutionen verübt werden,16 können wirtschaftsneutrale Deliktsbegehungen durch Gelegenheit im Kontext marktwirtschaftlicher Zusammenhänge stattfinden,17 so etwa Urkundsdelikte. Zudem ist zu denken an Strafnormen, die ausschließlich nichtökonomische Schutzzwecke verfolgen, allerdings aufgrund ihrer Beschaffenheit prinzipiell oder zumindest mit einer statistischen Häufigkeit in der Marktwirtschaft bzw. aus ihr heraus verwirklicht werden.18 Exemplarisch sei hierbei auf die Strafbestimmungen des sog. Verbraucherschutzstrafrechts19 bzw. auf die Umweltdelikte der §§ 324 ff. StGB20 verwiesen. Bisherige gesetzgeberische Definitionsansätze für diese Querschnittsmaterie21 scheiterten entweder oder entbehren aufgrund ihres unbestimmten Gehalts eines materiell-definitorischen Inhalts.22 Die skizzierte Weitläufigkeit und Eklektik möglicher Deliktstypen und -erscheinungen machen es schwierig, eine umfassende Definition zu bilden.23 Hinzu kommt die Akzessorietät des Wirtschaftsstrafrechts, d. h. der unmittelbare Bezug vieler wirtschaftsstrafrechtlicher Verbotsnormen zu zivil- bzw. öffentlich-rechtlichen Normen. Die akzessorischen Verbotsnormen werden innerhalb der Hauptmaterie platziert, was wiederum das Gefüge des Wirtschaftsstrafrechts fragmentiert.24 Es überrascht daher nicht, wenn Mansdörfer25 angesichts der Klaviatur möglicher Blickwinkel und Begriffsmodellierungen des Wirtschaftsstrafrechts konstatiert, das Feld möglicher Wirtschaftsdelikte erstrecke sich auf das Gros des Kernstrafrechts sowie auf eine unüberschaubare Fülle an nebenstrafrechtlichen Normen.26
Im Schrifttum haben sich derweil mit dem strafprozessualen, dem kriminologischen sowie dem strafrechtsdogmatischen Ansatz drei prominente Deutungsansätze zur methodischen Bestimmung des Untersuchungsgegenstandes „Wirtschaftsstrafecht“ herauskristallisiert.27 Kriminologische Begriffsmodellierungen betrachten delinquentes Verhalten entweder aus einer Täter-, einer Opfer- oder einer tatbezogenen Perspektive.28 Auf Grundlage kriminologischer Erkenntnisse zum Sozialprofil des Täters, zu den wirtschaftsschädigenden Auswirkungen seiner Tat oder zum Unternehmen als Brutkasten wirtschaftskriminellen Verhaltens beschreibt der kriminologische Begriff das Wirtschaftsstrafrecht vornehmlich eher als soziale Tatsache denn als normatives Konstrukt.29 Strafprozessuale Deutungsansätze nähern sich demgegenüber via Zuständigkeitenkatalog des § 74c GVG der Begriffsbestimmung des Wirtschaftsstrafrechts.30 Strafrechtsdogmatische Begriffsmodellierungen beschreiben das Phänomen Wirtschaftsstrafrecht ausgehend vom geschützten Rechtsgut und konzentrieren sich regelmäßig31 auf ein Wirtschaftsstrafrecht zum Schutz überindividueller Rechtsgüter.32 Insgesamt bemängelt die strafrechtswissenschaftliche Literatur bei jeder einzelnen Begriffsmodellierung mangelnde Randschärfe.33 Kernbereiche wirtschaftskriminellen Verhaltens subsumieren unter Zuhilfenahme jeder der präsentierten Begriffsmodellierungen unter den Topos Wirtschaftsstrafrecht. Gleichzeitig hängt die Einstufung als Wirtschaftsdelikt bei einer Reihe weiterer Straftatbestände entscheidend vom Auge des Betrachters und seinem jeweiligen Bewertungsmaßstab ab.34 Eine Lösung dieses Dilemmas versprechen indessen moderne Kombinationsansätze35 wie auch neuere Entwürfe Wagners36 und Mansdörfers37, die eine Einstufung von dem einzelnen Straftatbestand weg hin zu einer sachverhaltsbezogenen Betrachtung der jeweiligen Tatbegehung vornehmen.38 Mit Rotsch fällt unter eine Wirtschaftsstraftat jede Straftat, die aus der Wirtschaft heraus und gegen die Wirtschaft verübt wird.39
Aus der Zusammenschau des Gesagten lässt sich eine Tendenz ableiten, wonach Wirtschaftsstrafrecht wohl nicht delikts-, sondern sachverhaltsbezogen bestimmt wird. Im Umkehrschluss bedeutet dies zugleich, dass ein und dieselbe Verbotsvorschrift zugleich Wirtschaftsstrafrecht darstellen kann oder auch nicht.40 Diese ‒ am eindringlichsten von Brettel/Schneider41 hervorgehobene – Randunschärfe stellt eine Befassung mit dem Wirtschaftsstrafrecht gleich zu Beginn vor die Aufgabe, eine eigenständige Grenzziehung vorzunehmen. Aus dieser Einsicht folgt für die Zwecke der Arbeit, dass sie sich auf die Untersuchung eindeutig wirtschaftsstrafrechtlicher Tatbestände konzentriert. Die Randunschärfen des Wirtschaftsstrafrechts werden bewusst ausgeblendet, da es für die Zwecke der Arbeit genügt, mit Exemplifizierungen den normativen Gehalt des Wirtschaftsstrafrechts als von Gefahrdelikten durchzogen zu beschreiben. Eine Beschränkung auf eine Auswahl genuin wirtschaftsstrafrechtlicher Strafbestimmungen reicht hierfür aus. Der weitere Gang der Untersuchung widmet sich somit dem Kernbereich, dessen Bezug zu marktwirtschaftlichen Zusammenhängen feststeht und nicht von einem spezifischen Blickwinkel oder einer Gelegenheit abhängt, sondern sich dezidiert gegen marktwirtschaftliche Funktionszusammenhänge oder ökonomische Interessen anderer in ihrer Eigenschaft als Marktteilnehmer richtet. Die Bewertung der Strafbarkeit derartiger Tatbegehungen muss nicht situativ bedingt, sondern kraft Natur der Sache auf die Spielregeln der Marktwirtschaft zurückgreifen.42 Hierunter fallen neben den einschlägigen Normen des StGB ‒ namentlich der §§ 264 ff. StGB, der §§ 298 ff. StGB sowie der §§ 283 ff. StGB ‒ auch zahlreiche Strafbestimmungen des Nebenstrafrechts, etwa die strafrechtlichen Normen des Gesellschaftsrechts in §§ 399 ff. AktG, §§ 82 ff. GmbHG, §§ 313 ff. UmwG, §§ 147 ff. GenG, §§ 16 ff. PublG, die Strafnormen des HGB in §§ 331 ff. HGB sowie ausgewählte Straftatbestände aus dem finanzrechtlichen Kontext.43
1 Zur Risiko- bzw. Sicherheitsgesellschaft s. u. D. II ff.
2 Überblick bei Brunhöber, in: Sicherheitsgesellschaft, S. 194; Frehsee, in: Rechtsstaat, S. 275 ff.; Wohlers, Deliktstypen, S. 21 ff.; Zabel, Ordnung, S. 1 ff. m. w. N.; für die sog. Frankfurter Richtung v. a. Albrecht, in: Einheitliches Recht?, S. 261 ff.; Albrecht, KritV 1993 (76), 163; Albrecht, in: Unmöglicher Zustand, S. 429 ff.; Albrecht, KritV 1988, 189; Hassemer, Produktverantwortung; Hassemer, ZRP 1992 (25), 378; Hassemer, Strafen; Naucke, KritV 1993, 135; Naucke, KritV 1999, 336; Prittwitz, Strafrecht und Risiko; Prittwitz, StV 1991, 435; grundlegend auch Jakobs, ZStW 97 (1985), 751; Jakobs, ZStW 107 (1995), 843; Jakobs, HRRS 2004, 88; Jakobs, in: Jahrtausendwende, S. 47 ff.; Jakobs, ZStW 117 (2005), 839; Jakobs, HRRS 2006, 289; s. a. Sieber, in: GS Vogel, S. 349 ff.; Singelnstein, in: Gefahr, S. 95 ff.; Singelnstein, in: Präventionsstaat, S. 41 ff.; Singelnstein/Stolle, Sicherheitsgesellschaft; zum parallel laufenden Diskurs im spanischsprachigen Raum s. Silva Sánchez, Expansion; Garcia Martín, GA 2010, 323.
3 Eingehend hierzu s. u. D. I ff.
4 Hassemer, Selbstverständnis, S. 226 f.; dazu Reus, Recht, S. 73 f.; s. a. Frehsee, in: Rechtsstaat, S. 277 ff.
5 Hassemer, ZRP 1992 (25), 378 (379); Hassemer, Produktverantwortung, S. 3.
6 Statt vieler Wohlers, Deliktstypen, S. 110 ff.
7 So z. B. Albrecht, ZStW 117 (2005), 852; Aliabasi, Staatsgefährende Gewalttat; Bützler, Staatsschutz; Gierhake, ZIS 2008, 397; Mayk, Tatbestandsprobleme; Rackow, in: FS Maiwald, S. 9 ff.; Radtke/Steinsiek, JR 2010, 107; Sieber, NStZ 2009, 353; Sinn, in: Neujustierung, S. 147 ff.; Steinsiek, Terrorabwehr; Zöller, Terrorismusstrafrecht; Zweigle, Gesetzgeber im Konflikt.
8 Prittwitz, Strafrecht und Risiko, S. 175; Wohlers, Deliktstypen, S. 146 ff.; s. a. Başar, Modernes Strafrecht, S. 180 ff.; Brunhöber, in: Sicherheitsgesellschaft, S. 197; Herzog, Gesellschaftliche Unsicherheit, S. 109 ff.; Hilgendorf, Produzentenhaftung, S. 58 ff.; vertiefend s. u. B. II. 1 sowie D. ff.
9 S. u. B. II. 1.
10 S. u. D. III ff.
11 Hirsch, in: FS Tiedemann, S. 146.
12 Zu den Spannungsverhältnissen zwischen den Analysezugängen s. u. D. III. 2. b) cc).
13 Dazu s. u. D. III. 2.a) bb), D. III. 2. b) aa), D. III. 2. c) sowie E. I. 1. b) ee).
14 S. u. D. III. 1. c), D. III. 2. b) sowie E. II. 3.
15 Heinrich, in: AWHH-StrafR BT, § 19 Rn. 11; Schlüchter, Zweites Gesetz, S. 4.
16 Bottke, JuS 2002, 320 (321); Spindler, Regel- und Institutionenschutz, S. 34.
17 Mansdörfer, Theorie, Rn. 20.
18 Bottke, JuS 2002, 320 (321).
19 Vergho, Verbraucherschutzstrafrecht, S. 31 ff.
20 Dannecker/Bülte, in: WJS-WiStR, Rn. 1.10a.
21 Hilgendorf, Produzentenhaftung, S. 58.
22 Müller-Gugenberger, in: MGH-WiStR, Rn. 1.86.
23 Karami, Unrechtsbewusstsein, S. 85 ff.
24 Kudlich/Oğlakcıoğlu, WiStR, § 1 Rn. 1.
25 Mansdörfer, Theorie, Rn. 20.
26 Überblick über die einzelnen Definitionsansätze bei Mansdörfer, Theorie, Rn. 4 ff.
27 Wagner, Akzessorietät, Rn. 247.
28 Dannecker/Bülte, in: WJS-WiStR, Rn. 1.6 ff.; Kraatz, WiStR, Rn. 3; Kudlich/Oğlakcıoğlu, WiStR, § 1 Rn. 4; Rotsch, in: Momsen/Grützner-WiStR, § 2 Rn. 2 ff.; Wittig, WiStR, § 2 Rn. 6 ff.
29 Wittig, WiStR, § 2 Rn. 6; zu den täterbezogenen Begriffsbestimmungen grundlegend s. Sutherland, White collar crime; außerdem im deutschsprachigen Raum Schneider, in: Göppinger-Kriminologie, § 25 Rn. 9; zur Kritik an täterbezogenen Begriffsbestimmungen s. Rotsch, in: Momsen/Grützner-WiStR, § 2 Rn. 2; Tiedemann/Engelhart, Wirtschaftsstrafrecht, Rn. 79; Kudlich/Oğlakcıoğlu, WiStR, § 1 Rn. 4; Wittig, WiStR, § 2 Rn. 11; die Idee einer sog. „kriminellen Verbandsattitüde“ vertretend Schünemann, in: FS Tiedemann, S. 439; krit. dazu Kölbel, in: FS Schünemann, S. 778 ff.
30 Darstellung und Kritik der strafprozessualen Begriffsbestimmung unter anderem bei Achenbach, in: FS Schwind, S. 178; Brettel/Schneider, WiStR, § 1 Rn. 5 ff.; Dannecker/Bülte, in: WJS-WiStR, Rn. 1.8b; Heinz, in: Wirtschaftskriminalität und Wirtschaftsstrafrecht, S. 18 ff.; Rotsch, in: Momsen/Grützner-WiStR, § 2 Rn. 6.
31 Achenbach, KritV 2009, 296 (299); Baumann, JZ 1983, 935 (937); Kindhäuser, in: Bausteine, S. 134; Krüger, Entmaterialisierungstendenz, S. 142; Lampe, in: FS Tiedemann, S. 79 f.
32 Bottke, wistra 1991, 1 (7); Dannecker/Bülte, in: WJS-WiStR, Rn. 1.10 ff.; Geerds, Wirtschaftsstrafrecht und Vermögensschutz, S. 29, 64; Heinrich, in: AWHH-StrafR BT, § 19 Rn. 3, 12; Hilgendorf, Produzentenhaftung, S. 58 f.; Otto, ZStW 96 (1984), 339 (342); Rengier, StrafR BT I, § 17 Rn. 2 ff.; Schlüchter, Zweites Gesetz, S. 6 f.; Schneider, JZ 1972, 461 (463); Tiedemann/Engelhart, Wirtschaftsstrafrecht, Rn. 81; krit. dazu Hassemer, JuS 1990, 850; Heinz, in: Wirtschaftskriminalität und Wirtschaftsstrafrecht, S. 20; Spindler, Regel- und Institutionenschutz, S. 37; Rönnau, ZStW 119 (2007), 887 (897 ff.); Tiedemann, JuS 1989, 689 (691).
33 Statt vieler: Brettel/Schneider, WiStR, § 1 Rn. 20, die treffend von Kernprägnanz bei gleichzeitiger mangelnder Randschärfe sprechen.
34 Siehe die unterschiedlichen Einordnungen unter anderem bei ARR-WiStR, WJS-WiStR, MGH-WiStR, und GJW-WiStR.
35 Achenbach, in: FS Schwind, S. 189; Rotsch, in: Momsen/Grützner-WiStR, § 2 Rn. 8; Alwart, JZ 2006, 546 (546 ff.); Kudlich/Oğlakcıoğlu, WiStR, § 1 Rn. 12; krit. Rönnau, ZStW 119 (2007), 887 (688).
36 Wagner, Akzessorietät, Rn. 261 ff.
37 Mansdörfer, Theorie, Rn. 23 ff.
38 Rotsch, in: Momsen/Grützner-WiStR, § 2 Rn. 7 ff.; Kraatz, WiStR, Rn. 6.
39 Rotsch, in: FS Samson, S. 146.
40 Eingehend dazu s. u. E. II. 2. b).
41 Brettel/Schneider, WiStR, § 1 Rn. 20.
42 Wagner, Akzessorietät, Rn. 272.
43 Zur weiteren Präzisierung s. u. C.
B. Abstrakte Gefährdung im Wirtschaftsstrafrecht
Nachdem der Untersuchungsgegenstand einer ersten Präzisierung zugeführt wurde, kann nun das weitere Prüfungsprogramm der Untersuchung durchlaufen werden. Gegenstand des zweiten Kapitels ist die Erarbeitung der dogmatischen Grundlagen im Bereich der abstrakten Gefährdung. Diese scheinen seit dem Vortrag Jakobs’44 auf der Strafrechtslehrertagung 1985 im strafrechtswissenschaftlichen Diskurs allgegenwärtig. Das 1975 von Schünemann45 noch als „Stiefkind der Strafrechtsdogmatik“ bezeichnete Forschungsfeld war seither Gegenstand einer Fülle strafrechtswissenschaftlicher Abhandlungen. Zahlreiche Untersuchungen trieben die Dogmatik der sog. abstrakten Gefährdungsdelikte mit Blick auf Umwelt-46 und Brandstiftungsdelikte47 sowie auch im Terrorismusstrafrecht48, allerdings auch auf einer grundlegenden Basis,49 im Verlauf der letzten fünfzig Jahre voran. Das 1967 von Lackner50 konstatierte und von Herzog51 1991 erneut aufgegriffene beharrliche Schweigen des Schrifttums zum dogmatischen Gehalt dieser Gesetzgebungstechnik hat sich also gewandelt, man möchte sagen ins Gegenteil verkehrt.
Um die Deliktstypen zu beschreiben, kennt die Strafrechtswissenschaft nach der Leitidee der Deliktsstrukturtrias52 neben den Verletzungsdelikten die konkreten und abstrakten Gefährdungsdelikte. Ihnen ist gemein, dass sie auf den Eintritt einer manifesten Schädigung verzichten. Darüber hinaus unterscheiden sich konkrete von abstrakten Gefährdungsdelikten fundamental. Während abstrakte Gefährdungsdelikte aufgrund des hinter ihnen stehenden Motivbündels53 darauf ausgerichtet sind, die Zufallskomponente auszuschalten,54 tragen konkrete Gefährdungsdelikte das den Verletzungsdelikten anhaftende Zufallsmoment aufgrund des Erfordernisses eines Gefährdungserfolgs in sich.55 Daher kommen auch praktische Beweisschwierigkeiten, wie sie mit Verletzungsdelikten einhergehen, im Bereich der konkreten Gefährdungsdelikte vor. Es überrascht daher nicht, dass das konkrete Gefährdungsdelikt nicht das Mittel der Wahl eines an Präventionszwecken56 ausgerichteten Gesetzgebers ist.57 Grundlage der einschlägigen Analysen zum Risikostrafrecht58 bildet die erstmals von Jakobs59 in eine greifbare Beschreibung gefasste Annahme, das Strafrecht verlagere sich immer extensiver in das Vorfeld einer Schädigung. Als Prototyp dieses Funktionswandels wird unter anderem auf das Wirtschaftsstrafrecht verwiesen. Wie noch zu zeigen sein wird, wird jenseits der Kernnormen des Vermögensstrafrechts – § 263 I StGB, § 266 I StGB – der Großteil aller Strafnormen des Wirtschaftsstrafrechts als abstrakte Gefährdungsdelikte betitelt (B. II. 1).60 Die Dogmatik der sog. abstrakten Gefährdungsdelikte zu ergründen, verspricht demnach den Grundstein zu legen sowohl für die Erschließung der Dogmatik des Wirtschaftsstrafrechts als auch für die Ergründung des (wirtschafts-)strafrechtlichen Funktionswandels.61
Das unter dem Topos der sog. abstrakten Gefährdungsdelikte diskutierte Phänomen der Bestrafung auch konkret ungefährlichen Verhaltens dient im strafrechtswissenschaftlichen Diskurs als Anknüpfungspunkt zur vertieften Auseinandersetzung mit Struktur, Beschaffenheit, Grund und Grenzen eines folgenorientierten Wirtschaftsstrafrechts. Der zugrunde liegende Sachverhalt dieses Dilemmas gefährdungsdeliktischer Strukturen ist so zeitlos wie – analytisch (!) – simpel. Als mittlerweile klassisches Lehrbuchbeispiel mag die Trunkenheitsfahrt unter Verwirklichung des § 316 StGB dienen. Obwohl der Täter durch Einleitung von Sicherheitsvorkehrungen – Abgrenzung des Fahrbereichs, Fahren auf einem entlegenen Feldweg – die konkrete Gefährlichkeit seiner Verhaltensweise im Theoriefall ausklammert, bedroht das Strafgesetz dieses Verhalten gleichermaßen wie etwa die Trunkenheitsfahrt im großstädtischen Berufsverkehr. Ein anderes Beispiel ist das Inbrandsetzen von überprüft menschenleeren Wohnungen.62 Um Friktionen mit dem Schuldgrundsatz zu vermeiden, wird mit unterschiedlichen Begründungen die teleologische Reduktion der fraglichen Strafnormen diskutiert.63 Für die tiefere Ergründung der Struktur und Beschaffenheit abstrakter Gefährdungsdelikte als Modelldeliktstypus des Risikostrafrechts bietet es sich daher an, bei dem Streitstand um dessen teleologischer Reduktion zu beginnen. Zuvorderst ist auf das Verhältnis von Deliktsstruktur und Rechtsgut sowie damit verbundene Sonderprobleme einzugehen (B. I). Anschließend soll dieser Streitstand kursorisch unter dem Gesichtspunkt aufgerollt werden, zur Aufklärung der Deliktsstruktur hinter den abstrakten Gefährdungsdelikten bzw. zur Klärung des Begriffs der abstrakten Gefährdung beizutragen. Hierbei werden zur Auflösung der mit dem Begriff der abstrakten Gefährdung aufgeworfenen Spannungsfelder die Arbeiten Zieschangs und Hirschs zurate gezogen, um unter Einführung der Kategorie der Gefahrdelikte die abstrakte Gefährdung inhaltlich zu klären (B. II). Indem Zieschang bei der Systematisierung der Deliktsstrukturen einen Schwerpunkt auf die Entwicklung allgemeiner Kriterien zur Beschreibung gefährlicher und gefährdender Verhaltensweisen setzt, schafft er die Rahmenbedingungen für die hier vertretene These, wonach die Strafrechtswissenschaft bei der Bestimmung von Deliktsstrukturen eine Neigung aufweist, den Blick ausschließlich auf das Rechtsgut der Strafnorm zu legen. Demgegenüber plädiert die Untersuchung für eine Akzentverschiebung hin zur Tathandlung (B. I. 1). Daneben werden weitere typische Problemfelder behandelt, die im Zusammenhang mit der Bestimmung von Deliktsstrukturen auftreten: das Zusammenfallen mehrerer Rechtsgüter in einer Strafnorm (B. I. 2) sowie die Frage, ob die Bestimmung von Deliktsstrukturen, wie sie anhand von individualschützenden Strafnormen entwickelt wurde, auf den Bereich kollektiver Rechtsgüter übertragbar ist (B. I. 3).
Einschränkend sei an dieser Stelle folgender Hinweis gegeben: Sowohl die Behandlung des Problems der Strafbarkeit bei konkret ungefährlichem Verhalten nach den sog. abstrakten Gefährdungsdelikten als auch die einzuführenden Gefahrdelikte wurden jeweils auf Grundlage eines systemkritischen Rechtsgutsdenkens64 entwickelt. Zieschang selbst rechtfertigt die seinerseits geforderte Auslagerung der abstrakten Gefährlichkeitsdelikte in das Ordnungswidrigkeitenrecht de lege ferenda mit dem Verweis auf einen mangelnden Beeinträchtigungszusammenhang zwischen dem tatbestandlich verübten Verhalten und dem geschützten Rechtsgut der Norm.65 Auch die Frage nach dem Zusammenhang zwischen Rechtsgut und Deliktsstrukturen kommt notgedrungen nicht aus, ohne Überlegungen aus der Tradition systemkritischen Rechtsgutsdenkens zu streifen. Dies betrifft Fragen nach dem Verhältnis von Deliktsstruktur und Rechtsgut (B. I. 1) ebenso wie Überlegungen zu Verfahrensweisen beim Zusammenfallen mehrerer Rechtsgüter einer Norm (B. I. 2) oder die Frage nach der Übertragbarkeit der Deliktstypologien auf den Bereich kollektiver Rechtsgüter (B. I. 3). In allen drei Fällen fanden grundlegende Überlegungen auf dem Boden systemkritischen Rechtsgutsdenkens statt,66 die für die Zwecke der Untersuchung nicht ausgeklammert werden können, ohne ein unzureichendes Bild vom jeweiligen Problemfeld zu zeichnen. Dennoch dienen die nachfolgenden Überlegungen nicht der Frage nach dem Zusammenhang von Rechtsgut, Deliktsstruktur und Legitimität einer Strafnorm. Mehr noch kann der Wert einer Deliktstypologie per se nicht darin liegen, auf abstrakter Ebene und isoliert verbindliche Kriterien für die verfassungsrechtliche Legitimität von Straftatbeständen zu leisten. Hierzu kann sie nur Hilfestellung geben. Der Gegenstand der Untersuchung ist demnach von vornherein nicht der Frage nach der Legitimität sog. abstrakter Gefährdungsdelikte bzw. der Gefahrdelikte gewidmet. Vielmehr interessieren im Folgenden die Erfassung und Ausdifferenzierung gefahrdeliktischer Strukturen, d. h. die strukturelle Kategorisierung und Einordnung möglicher Angriffswege auf einen Normzweck jenseits seiner Verletzung. Dies legt den strafrechtsdogmatischen Grundstein für die anschließende Untersuchung einer Auswahl an Gefahrdelikten des Wirtschaftsstrafrechts (C), auf Grundlage derer wiederum das Wirtschaftsstrafrecht mit dem Phänomen des Risikostrafrechts zusammengeführt werden soll (D). Dafür werden auch die Überlegungen Zieschangs (nur) insoweit einbezogen, als unter ihrer Einbindung die Erscheinungsformen gefahrdeliktischer Strukturen erschöpfend beschrieben werden können. Umgekehrt ist damit keine Aussage zu Fragen der Legitimität von Tatbestandsstrukturen getroffen.67
I. Bezugspunkte zur Bestimmung von Deliktsstrukturen
1. Das Verhältnis von Deliktsstruktur und Rechtsgut
a) Herkömmliche Ansätze
Auf der Suche nach den deliktischen Strukturen, die den Strafbestimmungen zugrunde liegen, richten herkömmliche Ansätze zuvorderst einen Blick auf die Auswirkungen, die die Bestimmung des jeweils geschützten Etwas auf die Einschätzung des Deliktstyps hat. Ohne ins Auge zu fassen, welchem Rechtsgut der jeweilige Straftatbestand zu dienen verpflichtet ist, lässt sich keine Unterscheidung zwischen tatbestandlichen Strukturen treffen, da das Gesetz von sich aus dazu schweigt.68 Die strafrechtswissenschaftliche Literatur vertritt daher die These, die Bestimmung des Rechtsguts präge wesentlich die Feststellung des Deliktstyps.69 Erst wenn das Rechtsgut bestimmt ist, kann die Frage, auf welche Art und Weise, d. h. gegenüber welcher Art von Beeinträchtigung, strafrechtlich Schutz gewährleistet werden soll, sinnvoll beantwortet werden.70 Besondere Bedeutung kommt der Herausarbeitung des Rechtsguts schließlich noch dahin gehend zu, dass für die Beurteilung einer deliktischen Struktur zwischen der Beeinträchtigung des Rechtsguts und ggf. weiteren bzw. anderen Beeinträchtigungsvorgängen, die das tatbestandliche Verhalten mit sich bringt, zu unterscheiden ist.71 Dass diese zusammen-, jedoch auch auseinanderfallen können,72 lässt sich am besten anhand des § 306a I StGB erläutern.
Nach § 306a I Nr. 1, 3 StGB wird bestraft, wer eine dem Aufenthalt bzw. dem Wohnen von Menschen gewidmete Räumlichkeit in Brand setzt bzw. infolge einer Brandlegung zerstört. Der Tatbestand verweist unmissverständlich auf den Eintritt einer Veränderung der Außenwelt, mithin inkorporiert der Tatbestand in Form der Brandsetzung bzw. teilweisen Zerstörung den vermeintlich klassischen Beispielsfall eines Beeinträchtigungserfolgs.73 Indessen herrscht Einigkeit hinsichtlich des Rechtsguts hinter § 306a I StGB: Die Strafbestimmung soll dem Schutz von Leib und Leben dienen.74 Am Beispiel des § 306a I StGB wird deutlich, dass ein tatbestandlich vorausgesetzter Erfolg, auf den das tatbestandsmäßige Verhalten des Täters hinarbeitet, und das zu schützende Rechtsgut auseinanderfallen können. Während es bei der Tatbestandsverwirklichung also zur (teilweisen) Aufhebung der bestimmungsgemäßen Brauchbarkeit der angezündeten Räumlichkeit kommt, fragt die Strafnorm nicht nach einer Gefahr oder Gefährlichkeit für Leib oder Leben eines Menschen (Rechtsgut).75 Die Rechtsgüter werden gegen die generelle, vom Täter nicht kontrollierbare Gefahr eines Gebäudebrandes abgesichert.76
Da sich aber die Erarbeitung von Deliktsstrukturen der Beschreibung der Art und Weise des Angriffs auf die Rechtsgüter einer Norm verschrieben hat, interessiert für eine Klassifizierung auch nur der Wirkungszusammenhang mit dem Rechtsgut. Weitere Beeinträchtigungszusammenhänge spielen – wenn überhaupt – eine untergeordnete Rolle.77 Das Rechtsgut zu bestimmen, sortiert bzw. priorisiert mithin tatbestandlich erfasste Beeinträchtigungszusammenhänge. Mehren sich Beeinträchtigungszusammenhänge in einer Strafnorm, wie am Beispiel des § 306a I StGB der abstrakt-generelle Beeinträchtigungszusammenhang zwischen Gebäudebrand und Leib und Leben eines Menschen einerseits und der konkrete Beeinträchtigungszusammenhang zwischen Gebäudebrand und Aufhebung der bestimmungsgemäßen Brauchbarkeit andererseits, öffnet die Festlegung des Rechtsguts den Blick auf denjenigen Beeinträchtigungszusammenhang, der den Normzweck betrifft. Prominenz erfuhr diese Einsicht im Zuge der Erforschung der sog. Gefährdungsdelikte einschließlich ihrer Abgrenzung zum Verletzungsdelikt.78 Während der Eintritt eines Schadens am Rechtsgut für Verletzungsdelikte konstitutiv ist,79 blenden übrige Deliktsstrukturen klassischerweise die Manifestierung des Schadens zur Tatbestandsverwirklichung aus.80
b) Akzentverschiebung hin zur Tathandlung
Die sog. Gefährdungsdelikte verzichten in ihrem Tatbestand auf die rechtsgutsspezifische Schadensverwirklichung und geben sich demgegenüber mit einer unterschiedlich ausgeprägten und graduell abgestuften Risikoprognose einer solchen Schadensverwirklichung zufrieden.81 Ohne auf die Beschaffenheit der einzelnen Risikoprognosen an dieser Stelle vertieft einzugehen,82 lässt sich festhalten, dass sie durchweg die Berechnung eines Schadenspotenzials für das betreffende Rechtsgut zum Inhalt haben und sich daher nur vom Rechtsgut her bestimmen lassen. Die Deliktsstruktur beschreibt folglich, wie sich der Tatbestand zum geschützten Gut verhält.83 Hieran anknüpfend, soll die These entspannt werden, wonach herkömmliche Ansätze die Frage nach der Deliktsstruktur auf die Suche nach dem geschützten Rechtsgut verengen und die Tathandlung vernachlässigen.
Wie noch zu zeigen sein wird, geht die Strafrechtswissenschaft üblicherweise bei der Einordnung als sog. abstraktes Gefährdungsdelikt mit einer gewissen Stiefmütterlichkeit vor.84 Dazu passt, bei der Frage nach der Deliktsstruktur dem geschützten Rechtsgut überproportional viel Beachtung zu schenken.85 Anstatt eine dogmatische Erschließung des Täterverhaltens und dessen Auswirkungen auf das geschützte Rechtsgut zu bemühen, konzentrieren sich einschlägige Auseinandersetzungen darauf, das geschützte Rechtsgut herzuleiten, um im zweiten Schritt mit knappem Verweis auf die (Nicht-)Beeinträchtigung des geschützten Rechtsguts als Ergebnis der Tatbestandsverwirklichung die Deliktsstruktur zu bestimmen.86 Heine/Eisele bspw. ziehen sich für die Einstufung des § 298 StGB als abstraktes Gefährdungsdelikt auf die Bemerkung zurück, dieser setze weder einen Verletzungs- noch einen Gefährdungserfolg voraus.87 Ähnlich liest man bei Heger zur Deliktsstruktur des § 265b StGB, dieser „ist abstraktes Gefährdungsdelikt […] im Vorfeld des Betruges. Dem steht das mitgeschützte Allgemeininteresse nicht entgegen, weil es sich insoweit nur um ein relativ selbständiges Rechtsgut handelt, nämlich nur um Folgeerscheinungen der Gefahren, die der Gesamtheit der jeweils betroffenen Einzelnen aus dem Phänomen des Kreditbetruges erwachsen“.88 Auch hier soll der knappe Verweis auf die Beschaffenheit des (mit-)geschützten Rechtsguts ausreichen, um die Einordnung der Deliktsstruktur zu rechtfertigen. Die Verengung auf die Suche nach dem geschützten Rechtsgut spitzt sich in den Arbeiten Hassemers zu, der so weit geht, das Täterverhalten und damit die Deliktsstruktur aufgrund des Rechtsguts der Strafnorm umzudeuten. Auf Grundlage der von ihm stark gemachten sog. personalen Rechtsgutslehre können Rechtsgüter nur „vom Menschen her“89 konzipiert werden. In der Konsequenz sind Hassemer zufolge die Umweltdelikte keine Verletzungsdelikte, sondern Gefährdungsdelikte, weil sie die Gesundheit und das Leben und nicht die Umwelt als solche schützen. Umweltschädigungen werden danach als Gefährdungshandlungen für Leben und Gesundheit gelesen.90 Vergleichbar geht auch sein Schüler Hohmann vor, wie ein Blick auf dessen Kommentierung zu § 298 StGB verrät. Er konstruiert das Rechtsgut des immer wieder bestätigten Vertrauens des Einzelnen in die Funktionsfähigkeit des freien und fairen Wettbewerbs unter Verweis auf eine Notwendigkeit, Rechtsgüter auf personale Entfaltungsbedingungen des Einzelnen rückführen zu können. Ausgehend von diesem Verständnis eines Vertrauensschutzgutes, beschreibt die Tatbestandsverwirklichung des § 298 StGB Hohmann zufolge eine Verletzung ebenjenes Vertrauens.91 Durch die Abgabe eines auf einer rechtswidrigen Absprache beruhenden Angebots, so schlussfolgert Hohmann, sei das Wettbewerbsverfahren beeinträchtigt und das auf die Regelhaftigkeit des Wettbewerbsverfahrens gerichtete Vertrauen des einzelnen Verfahrensteilnehmers erschüttert.92 An dieser Stelle wird das Täterverhalten in eine Vertrauensverletzungshandlung ausgehend von der dahinter stehenden Rechtsgutskonzeption umgedeutet. In der Konsequenz stuft Hohmann93 den § 298 StGB als Verletzungsdelikt ein.94
Im Unterschied zum üblichen Vorgehen bei der Zuordnung von Tatbestands- und Deliktsstruktur hebt die Untersuchung die Tathandlung als bestimmendes Moment bei der Einstufung einer Deliktsstruktur hervor. Diese Akzentverschiebung hin zum Täterverhalten bzw. der Tathandlung ist bereits bei Wohlers zu finden. Auf der Suche nach Kriterien zur Legitimation sog. abstrakter Gefährdungsdelikte wendet sich dieser von der Herstellung eines Begründungsansatzes über das Vor- bzw. Nichtvorliegen eines Rechtsgutsbeeinträchtigungszusammenhangs ab und stützt seine Überlegungen auf eine systematisierende Aufarbeitung möglicher Tathandlungsvarianten. Im Kern ist zur Bestimmung der Deliktsstruktur für Wohlers entscheidend, welches Risikopotenzial dem tatbestandlich vorausgesetzten Täterverhalten innewohnt. Er systematisiert und unterscheidet Deliktsstrukturen nach dem Verhalten des Täters.95 Hieran schließt unter anderem Brunhöber an, die Deliktsstrukturen danach unterteilen möchte, wie bzw. auf welche Art und Weise das tatbestandlich umschriebene Verhalten schädigend wirkt.96 Ohne auf die legitimatorische Dimension zu blicken, in deren Kontext die Diskussion um das Verhältnis von Rechtsgut und Deliktsstruktur stattfindet, sensibilisieren die Ansätze Wohlers’ und Brunhöbers für die angedeutete Frage, wie sich der Straftatbestand zum geschützten Gut verhält, mithin für das Täterverhalten und seine Schädlichkeit. Nicht das Gut, sondern der Tatbestand rückt dadurch in den Mittelpunkt. Den Versuch, deliktische Strukturen zu typisieren, beschreibt Wohlers folgerichtig als das Bestreben, die verschiedenen Angriffswege, vor denen das Gesetz seine Rechtsgüter zu schützen beabsichtigt, zu erfassen und zu systematisieren.97 Schließlich geht mit der Entscheidung des Gesetzgebers, ein Rechtsgut mit strafrechtlichen Mitteln verteidigen zu wollen, weder notwendiger- noch typischerweise ein vollumfassender Schutz gegen jedwede Form von Beeinträchtigung einher.98 Strafrechtlicher Schutz wird vielmehr punktuell, also gegen bestimmte Angriffsformen, gewährt.99 Für den weiteren Verlauf der Untersuchung bleibt festzuhalten, dass sie zur Bestimmung der Deliktsstruktur die Tathandlung fokussiert. Mit der exakten Analyse des Täterverhaltens kann die tatbestandlich umschriebene Angriffsform, gegen die die jeweilige Strafnorm das Rechtsgut abzusichern verspricht, offengelegt werden. Erst indem das Täterverhalten in Bezug zum geschützten Rechtsgut gesetzt wird, wird der Grad, zu dem der Täter bei Tatbestandsverwirklichung das Rechtsgut beeinträchtigt, genau bestimmbar.
2. Zusammenfallen mehrerer Zwecke in einer Strafbestimmung
Aus der Einsicht, der Gesetzgeber sei frei in der Bestimmung der Zwecke, derentwegen er Strafgesetze schafft,100 folgt unweigerlich die Erkenntnis, dass er befugt ist, im Rahmen eines Strafgesetzes ein Zweckbündel zu verfolgen. Dementsprechend nahe liegt die Möglichkeit, bei der Suche nach dem mit dem Straftatbestand korrespondierenden Rechtsgut auf mehr als eine Antwort zu stoßen. Für die Zwecke der Untersuchung stellt sich somit die Frage, welche Auswirkungen das Zusammenfallen mehrerer Rechtsgüter in einer Strafnorm für die Bestimmung der Deliktsstruktur hat und wie in einem solchen Fall zu verfahren ist.
Das Phänomen mehrerer, nebeneinanderstehender Rechtsgüter ist bislang, soweit ersichtlich, primär auf dem Boden der systemkritischen Rechtsgutstheorie diskutiert worden. Ihr besonderes Interesse an der Abhandlung des Zusammenfallens mehrerer verfolgter Zwecke folgt aus der zentralen Bedeutung, die sie dem einzelnen Rechtsgut zuschreibt. Nach der Basisdoktrin systemkritischen Rechtsgutsdenkens bildet das Rechtsgut den zentralen Angel- und Fixpunkt der Bewertung der Legitimität einzelner Strafbestimmungen.101 Daher fällt das Bedürfnis, auf die Frage nach ihrer Legitimationsgrundlage eine eindeutige Antwort geben zu können, entsprechend groß aus. Auf dieser Grundlage hat Schulenberg102 das Zusammenfallen mehrerer Rechtsgüter analytisch erarbeitet. So seien zunächst Strafbestimmungen denkbar, die in den Diensten mehrerer, unterschiedlicher Rechtsgüter stünden. Als weiter unkritisch könne der Fall betrachtet werden, in dem zwei oder mehrere Rechtsgüter sich in demselben Substrat manifestierten, etwa das Eigentum und der Gewahrsam an einer Sache in der Sachherrschaft im Rahmen des § 242 I StGB. Daneben könne eine Strafnorm zwei oder mehrere Substrate unterschiedlicher Rechtsgüter tangieren, wie die Wegnahme mittels Gewalt bei § 249 I StGB einmal das in der Sachherrschaft zum Ausdruck kommende Eigentum und die Sachherrschaft sowie einmal die mittels Gewalt beeinträchtigte Willensfreiheit tangiere. Auf der Suche nach dem Strafgrund einer Norm unterscheiden systemkritische Rechtsgutstheorien verschiedene Verhältnisse, in denen in einem Straftatbestand zusammenfallende Rechtsgüter sich zueinander verhalten können. Neben der Koexistenz als gleichberechtigter Strafgründe tauchten Rechtsgüter auch als über einen Schutzreflex mit der Strafnorm verbunden auf. Wenn das tatbestandlich umschriebene Verhalten zur unmittelbaren Beeinträchtigung des einen Rechtsguts führe, während es die Verletzung des anderen nur vorbereite bzw. es lediglich gefährdet werde, mangele es an einer unmittelbaren Verbindung des nicht direkt beeinträchtigten Rechtsgutes zur Strafnorm. In diesen Fällen sei nur das unmittelbar beeinträchtigte Rechtsgut als Strafgrund heranzuziehen.103
Besondere Aufmerksamkeit widmen die einschlägigen Arbeiten zum systemkritischen Rechtsgutsverständnis den Konstellationen, in denen ein Tatbestand – ihrer Auffassung zufolge – die Vorbereitung bzw. abstrakte Gefährdung eines Individualrechtsguts bei gleichzeitiger Beeinträchtigung eines Kollektivrechtsguts zum Gegenstand hat.104 Ob und wonach beim Zusammenfallen mehrerer Schutzfunktionen zu priorisieren ist, beurteilen die verschiedenen Verästelungen der Rechtsgutsdoktrin jeweils anhand ihres theoretischen Unterbaus.
Details
- Seiten
- 500
- Erscheinungsjahr
- 2025
- ISBN (PDF)
- 9783631921029
- ISBN (ePUB)
- 9783631921036
- ISBN (Hardcover)
- 9783631920978
- DOI
- 10.3726/b21951
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2024 (Dezember)
- Schlagworte
- abstrakte Gefährdungsdelikte Wirtschaftsstrafrecht Risikostrafrecht Gefährdungsdelikte Präventionsstrafrecht modernes Strafrecht Feindstrafrecht Risikomanagement Risikosteuerung Trennungsthese abstrakte Gefährdung
- Erschienen
- Berlin, Bruxelles, Chennai, Lausanne, New York, Oxford, 2024. 500 S.
- Produktsicherheit
- Peter Lang Group AG