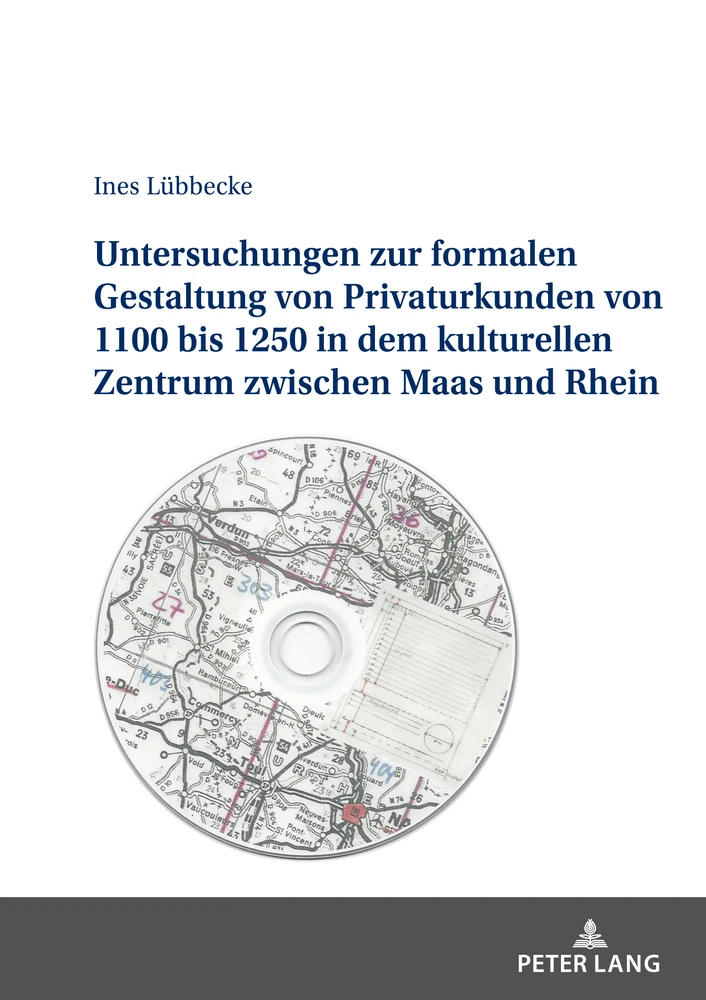Untersuchungen zur formalen Gestaltung der Privaturkunden von 1100 bis 1250 in dem kulturellen Zentrum zwischen Maas und Rhein
Zusammenfassung
Um auf das zusätzliche Material zuzugreifen, gehen Sie auf den folgenden Link und geben Sie den im Buch enthaltenen Code ein: https://www.peterlang.com/supplementary-material-4336487/
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- INHALT
- 1. Einleitung: Die Urkunde als Plakat
- 1.1 Problemstellung und Stand der Forschung
- 1.2 Methodik
- 2. Die Codierung der Urkunde
- 2.1 Einleitung und Einführung in die Problematik des Codierens
- 2.2 Kriterien der exakten Maße und der Beschreibung einer Urkundenfläche
- 2.3 Kriterien für die Einordnung der Urkunde in ihren historischen Rahmen (Datum, sozial-politisch, geographisch/naturraumbezogen und raumneutral)
- 3. Das erfaßte Urkundenmaterial in seinen Beständen
- 3.1 Einleitung: Räumliche und zeitliche Eingrenzung
- 3.2 Die Urkundenüberlieferung in den Archiven
- 4. Allgemeine Entwicklungen der Privaturkunde, ihres Formattyps und ihrer Pergamentgröße
- 4.1 Die Urkundenüberlieferung von 1091 bis 1250
- 4.2 Die Formattypen der Privaturkunde von 1091 bis 1250
- 4.3 Die Größe der Pergamenturkunde und ihrer Formattypen von 1091 bis 1250
- 5. Die Privaturkunde: räumliche Ausbreitung in der Zeit, ihre Bewegungen mit ihren Formattypen im Raum
- 5.1 Einleitung: Räumliche Verteilungen und Bewegungen der Privaturkunde von 1091–1250
- 5.1.1 Die Diözesen: Zeitliche Verteilungen
- 5.1.2 Räumliche Bewegungen der Privaturkunden: die Diözesen
- 5.1.3 Die Naturräume: Zeitliche Verteilungen
- 5.1.4 Räumliche Bewegungen der Privaturkunden: die Naturräume
- 5.1.5 Die Rasterquadrate: Zeitliche Verteilungen
- 5.1.6 Räumliche Bewegungen der Privaturkunden: die Rasterquadrate
- 5.1.7 EXKURS: Zeitliche Verteilungen in den Sonderräumen
- 5.2 Die räumlichen Verteilungen ihrer Formattypen von 1091–1250
- 5.2.1 Einleitung
- 5.2.2 Die Diözesen
- 5.2.3 Die Naturräume
- 5.2.4 Die Rasterquadrate
- 5.2.5 EXKURS: Die Sonderräume
- 5.3 Diskussion der räumlichen Verteilungen und Bewegungen der Privaturkunde und ihrer Formattypen
- 6. Formattypen und Pergamentflächengröße der Privaturkunde in Abhängigkeit von dem sozialen Status des Ausstellers und des Empfängers
- 6.1 Allgemeine Verteilungen der sozialen Gruppen als Aussteller und Empfänger in den Privaturkunden
- 6.2 Die Formattypen und ihre zeitlichen Verteilungen für die sozialen Gruppen als Aussteller und Empfänger in den Privaturkunden
- 6.3 Die Pergamentflächengrößen nach den Formattypen differenziert und ihre zeitlichen Verteilungen in den sozialen Gruppen
- 6.4 Die Beziehungen der sozialen Gruppen untereinander in ihrer primären Funktion als Aussteller oder Empfänger
- 7. Diskussion der Streuung der Formattypen und ihrer Pergamentgrößen in ihrer Zeit und in ihrem sozial – politischen Umfeld
- 7.1 Die Formattypen in ihren Flächengrößen von 1091 bis 1250
- 7.2 Die Formattypen und ihre Flächengrößen in ihrem sozial-politischen Umfeld (1091–1250)
- 8. Die Gestaltung der UrkundenFLÄCHE nach den Formattypen
- 8.1 Einleitung
- 8.2 Das Hochformat: eine elitäre Flächengestaltung (31,6 %, 540 Urkunden)
- 8.3 Das Breitformat (66,2 %, 1132 Urkunden)
- 8.4 Das Quadrat (2 %, 36 Urkunden)
- 9. Gesamtschau: Ästhetik der hochmittelalterlichen Privaturkunde
- ANHANG
- C) LITERATURVERZEICHNIS
1. Einleitung: Die Urkunde als Plakat
1.1 Problemstellung und Stand der Forschung
Die Diplomatik unterteilt die Kriterien für die Erfassung der Urkunde in äußere und innere Merkmale.1 Die äußeren Merkmale umfassen den Beschreibstoff (Papyrus, Pergament oder Papier), das Format, die Schrift (Elongata, Zierschriften), die Linierung (Schreibstoff), Mittel der Beglaubigung (Siegel, Chirograph), Recognitionszeichen, Monogramme und Vermerke der Aussteller und Empfänger. Die inneren Merkmale betreffen den Text, seine Gestaltung in bestimmten Formeln und Abschnitten und die Datierung des Stückes.
Diese Merkmale sollen die „Formen“ umfassen, in denen die Urkunde konzipiert ist und vom Betrachter als „sinnlich wahrnehmbares Objekt“ erfaßt wird. In dieser Wahrnehmung „ihrer materiellen, äußeren Erscheinung“ liegen die oben genannten „äußeren Merkmale“ einer Originalurkunde begründet.2

Die hier unternommenen Untersuchungen sollen diese Betrachtungsweise der Urkunde in bestimmten Punkten aufnehmen und zu einer Gesamtschau ihrer äußeren Gestaltung beitragen. Die Urkunde wird in ihrer formalen Gestaltung erfaßt, die den Formattyp (Hoch, Breit oder Quadrat) und die Flächengestaltung einbezieht.3 Maßverhältnisse der Seiten, Randgestaltung, Siegelplazierung, Schriftspiegel mit seinen Komponenten wie Elongata, Mittelbuchstabenhöhe und Zeilenabstand als auch die Linierung sollen hier wie bei einer Bildkomposition berücksichtigt und analysiert werden. Der Inhalt des Urkundentextes wird ausgeschlossen. Zielsetzung dieser Untersuchung ist, Kriterien für die äußere Gestaltung der Urkunden zu finden, die über den engen Bereich einer einzelnen Kanzlei hinausreichen. Die Kanzlei bietet sich nicht als ein Kriterium für die äußere Gestaltung einer Urkunde an, da hier alle Originalurkunden berücksichtigt werden sollen. Das organisierte Kanzleiwesen steht außerdem für den Schwerpunkt des Untersuchungszeitraums, für das 12. Jh., am Anfang seiner Entwicklung.4 Es wird dagegen der soziale Rang des Ausstellers und Empfängers einer Urkunde genommen, um auf der angesprochenen Ebene eine historische Einordnung zu ermöglichen.
Mit der skizzierten formalen Betrachtungsweise der Urkunde soll zum einen ein Beitrag zur Urkundenkritik in ihrer sinnlichen Erfassung als gestaltete Fläche geleistet und zum anderen versucht werden, ihre Ästhetik als hochmittelalterliche Urkunde zu erfassen.
Dieser ästhetische Aspekt erhält für die hier behandelte Zeit eine besondere, zeitprägende Bedeutung. Der Kunsthistoriker Hans SEDLMAYR bezeichnet die „Schaubegierde (im weitesten Sinn)“ als eine „grundlegende Bewegung des 12. Jh.5 In diesem Zeitgeist ist die Urkunde sicherlich auch als ein Gegenstand zu verstehen, der zum Vorzeigen und Anschauen bestimmt ist. Die Kunstgeschichte arbeitet schon lange an der Problematik der Formengestaltung. Die neueste Arbeit ist mit Paul v. NAREDI-RAINER „Architektur und Harmonie“ zu nennen.6 Gegenstand dieser Arbeiten sind Bauten und Kunstgegenstände. Für die hier angesprochene Frage der Urkundengestaltung sind maßgebend die neueren Arbeiten auf dem Gebiet der Bucharchäologie oder Codicologie. Der Belgier Léon GILISSEN befaßt sich in seinen „Prolégomènes à la codicologie“ mit dem Format und der Seitengestaltung eines Buches anhand von Handschriften aus der „Königlichen Bibliothek“ von Brüssel.7
Carla BOZZOLO und Ezio ORNATO bringen einen quantitativen Aspekt in die Codicologie ein, der sich entsprechend methodisch auswirkt.8 Sie behandeln neben dem Format auch den Gesamtaufbau eines Buches und Fragen der Handschriftenproduktion. Sie berufen sich dabei auf Arbeiten von Léon GILISSEN und von Jean VEZIN.9
Die auffallenden Wechsel der Formattypen zwischen 1000 und 1300 sollen hier in ihrer Entwicklung für den Zeitraum von 1100 bis 1250 beschrieben werden. Die historische Einordnung der Urkunde und ihres Formattyps geschieht so einmal über die Zeit neben der Einordnung in den sozialen Rang des Ausstellers und Empfängers. Die Urkunde bewegt sich aber auch in einem bestimmten geographischen Raum, der zu bestimmen ist.10 Er wird hier durch einen Naturraum, einem neutralen Raumraster und dem Diözesanraum erfaßt.
Die Festlegung des Untersuchungsraums selbst ist vornehmlich von der Überlegung bestimmt, ein Zentrum der Urkundenproduktion zur Zeit des Hochmittelalters zu erfassen. Nur so ist hinreichend Material zu erwarten, um diese Untersuchung durchzuführen. Die romanische Kernlandschaft Rhein-Mosel-Maas bietet sich hier an, wovon jedoch nur ein Teil erfaßt werden kann. Der tatsächlich erfaßte Raum besteht aus dem heutigen Ost-Belgien (im Westen bis Namur reichend), wobei die nördliche Grenze des Untersuchungsraums durch Hasselt und in Deutschland durch Düsseldorf führt, dem Land Luxemburg und Nord-Ost-Frankreich (im Westen bis Châlons-sur-Marne, im Süden bis Straßburg und im Osten bis zum Rhein). Gerade von der Quantität der Urkundenherstellung her bestätigt sich dieser Teil, der zwischen den Flußläufen Rhein und Maas liegt, als kulturelles Zentrum.
Bereits die umfangreiche Ausstellung über die „mosane Kunst“ von 800 bis 1400 (Köln 1972) wählte Rhein und Maas als geographische Umschreibung dieser Kultureinheit.11 Neben natürlichen Gegebenheiten wie Reichtum an Bodenschätzen, der „Lebensunterhalt für die Bewohner und Arbeitsmaterial für die Künstler“ bot, und der Lage im westeuropäischen Raum werden Handelswege, die die Picardie und das Rheinland verbanden, genannt. Das Gebiet wird eingegrenzt durch den Kohlenwald im Westen zum Scheldegebiet und zum Bistum Cambrai hin. Diese Begrenzung wird nach den Ausführungen des Katalogs aber eher als offen verstanden, wobei „Rhein und Maas als Fluß- und Kulturachsen gewählt wurden, die sich von 800 bis 1400 in einzigartiger Weise ergänzten“. Als „eigentliches Zentrum“ dieses Kulturraumes wird das Fürstbistum Lüttich genannt.12 Jacques STIENNON hat diese Ausstellung geleitet und seine bereits genannte Habilitationsschrift über die Urkundenschrift in der Diözese Lüttich muß hier maßgebend erwähnt bleiben. Seine Überlegungen zur räumlichen Eingrenzung der Urkundenschrift sind bei der zu beschreibenden Verteilung der Formattypen für die Privaturkunden einzubeziehen.
Grundsätzlich ist zu betonen, daß hier nur allgemeine räumliche Bewegungen der Privaturkunde, wie sie in den genannten Raumvariablen erfaßt sind, beschrieben werden können. Ebenso auf der zeitlichen und „gesellschaftlichen“ Ebene (Variablen des sozialen Ranges des Ausstellers und Empfängers einer Urkunde) sollen eher Grundzüge einer Entwicklung aufgezeigt werden, als Fragen der Spezialdiplomatik nachzugehen, was alleine schon bedingt durch die Größe des Untersuchungsraums den Rahmen dieser Arbeit weit überschreiten würde. Diese Untersuchung ist nur auf der Grundlage von Originalurkunden durchzuführen gewesen. Im Allgemeinen sind möglichst alle vorhandenen Originalstücke von einem Archivort aufgenommen. Da es sich um eine Untersuchung über die Urkundenüberlieferung handelt in einem bestimmten geographischen Raum, der primär regional erfaßt werden soll, interessieren vornehmlich die „Privaturkunden“. Vorgefundene Königsurkunden sind ebenfalls codiert, da sie als Herrscherzeugnisse für die Privaturkunden formbestimmend gewesen sein können, – ebenso wie die Papsturkunden. In diesem letzten Fall ist auf eine durchgängige Aufnahme von Originalmaterial verzichtet worden. Diplomata und Papsturkunden können in Einzelfällen auch regionalen Gebräuchen gefolgt sein. Eine solche gegenseitige Beeinflußung, die wohl eher im Schriftbild zu vermuten ist, ließe sich im Rahmen dieser Untersuchung nur auf der Ebene der Formattypen und der Gestaltung der Urkundenfläche vermuten. Diese Problematik ist aber nicht eigentlicher Gegenstand der Arbeit, sondern die „Privaturkunde“ ist in ihrem Formattyp und ihrem Flächenumfang zunächst einmal zu erfassen. Es wird zudem versucht, die Fläche in der Anordnung ihrer Textelemente und ihres Siegels auf dem Pergament zu beschreiben. Hierbei soll eine historische Einordnung, neben der zumeist gegebenen zeitlichen Fixierung, über den geographischen Raum und einen gesellschaftlichen Parameter versucht werden.
Abschließend folgt jetzt ein Einblick in die diplomatische Literatur der 80er Jahre, die die „äußere Gestaltung der Urkunden im Hinblick auf ihr „Format“, – möglichst in dem angegebenen Untersuchungszeitraum von 1100 bis 1250 –, problematisiert. Es ist kein historischer Überblick über das Urkundenformat in der Diplomatik, der bereits anläßlich des Pergamentkolloquiums in Marburg im Sept. 1987 von Peter RÜCK vorgetragen wurde.13 Bei den folgenden Ausführungen wird versucht, die das „Urkundenformat“ betreffende Terminologie der einzelnen Autoren möglichst sinngemäß wiederzugeben.
Zunächst soll an dieser Stelle BRESSLAU genannt sein, der sich bei den Kaiser- und Königsurkunden wie den Papsturkunden zu dem „Urkundenformat“ äußert.
In seinem Handbuch der Urkundenlehre distanziert sich Bresslau von der Frage nach dem „Urkundenformat“. Er weigert sich, Aussagen über das zur Herstellung von Urkunden benötigte Pergament zu formulieren, die irgendeine Regelmäßigkeit im Gebrauch des Pergaments aufzeigen.14 Seiner Meinung nach gibt es hier zu viele Schwankungen. Er beläßt die Behandlung dieser Fragestellung bei einzelnen Feststellungen, die hier aufgeführt werden sollen. Im Allgemeinen herrschen die großen Pergamentstücke vor, – besonders bei „feierlicher“ Gestaltung und „wichtigen Inhalt“. Neben dem „Umfang des Textes“ macht er grundsätzlich das „Bedürfnis des Einzelfalles“ für die Pergamentgröße verantwortlich. Für die päpstliche Kanzlei wird allgemein festgestellt, daß das Hochformat wahrscheinlich „aus der Zeit des Papyrus“ üblich ist. Nur Briefe werden auf Breitformat verfaßt. Den Gebrauch des Breitformats bei den Königsurkunden hält er dann zeitlich auch fest für das 8. bis 10. Jh. Für das 11. Jh. beschreibt er wie Erben das allmähliche Auftreten des Hochformats bei den Diplomata in Deutschland. Bresslau betont abschließend zu diesen allgemeinen Aussagen, daß sie im Einzelfall oft keine Gültigkeit haben und kaum als Kriterien für eine Urkundenkritik reichen.
Für die Kaiser- und Königsurkunden in Deutschland, Frankreich und Italien beschreibt Wilhelm ERBEN die auffallenden Formatwechsel seit dem 11. Jh. chronologisch. Heinrich II. wird als der Zeitpunkt genannt, ab dem das Format nicht mehr der karolingischen Tradition, – dem Breitformat, entspricht. Es folgt eine Zeit des parallelen Gebrauchs von Hoch- und Breitformat, ohne eine „Regel“ für diese neue Anwendung zu finden. Als Ursache nennt er den päpstlichen und überhaupt italienischen Einfluß auf die deutsche königliche Kanzlei.15 Trotz dieser Formatwechsel bleibt die Urkunde zunächst aber weiterhin groß in ihren Dimensionen und das Hochformat beherrscht das Urkundenbild im 12. Jh.16
Seit 1159 beobachtet er dann die parallele Einführung einer kleinen Urkunde, welche zwischen Hoch- und Breitformat wechselt und notwendigerweise auch Vereinfachungen der äußeren und inneren Merkmale bewirkt.17 Das Gewicht des Inhalts bestimmt nach Erben seit der Kanzlei Friedrichs II. die Pergamentgröße einer Urkunde mit. Neben dem Einfluß der päpstlichen Kanzlei führt er als äußeren Umstand dieser Entwicklung die Kämpfe mit den lombardischen Städten seit Friedrich I. an, die eine reibungslose Pergamentbeschaffung erschweren. Außerdem wird die Spaltung der päpstlichen Kanzlei seit dem Schisma für einen erhöhten Pergamentverbrauch verantwortlich genannt.
Einen Formatwechsel zum vorherrschenden Breitformat stellt ERBEN erst nach 1220 fest, der sich über fast quadratische Formen am Ende der ersten Regierungsperiode Friedrichs II. vollzieht (1212). Als möglichen französischen Einfluß wertet er dieses zeitweilige Auftreten des Quadrats: Ludwig VI., Philipp August und Ludwig IX. werden als Beispiele genannt. Gleichzeitig ist aber auch hier der Gebrauch von „kleinen, schmalen Blättern“ zu beobachten. Das Breitformat setzt sich dann auch in Frankreich seit Ludwig IX. für das 13. Jh. durch, – auch bei größeren Pergamentstücken.18 Erben skizziert aufgrund seiner oben dargestellten Ergebnisse die Entwicklung des „Urkundenformats“ und seiner Ausmaße für das 13. Jh. dahingehend, daß aus der Not (des Pergamentmangels) eine Tugend geschaffen wird.19
Eine kritische Ergänzung zu Erben, gerade in dem zuletzt genannten Punkt, gibt hier Rainer EGGER in seiner Arbeit über Die Schreiber der Urkunden Friedrich Barbarossas (Vorstudien zu einer Kanzleigeschichte). Er setzt dem Pergamentmangel die „zunehmende Schriftlichkeit in der 2. Hälfte des 12. Jh.“ als Begründung für das Auftreten der kleineren Urkunden hinzu. Mit Erben übereinstimmend in dem Jahr 1159 setzt Egger den Zeitpunkt fest für das Erscheinen dieser kleineren Urkunden, wobei er einschränkend nur für die Urkunden Friedrichs II. spricht.20
Rudolf THOMMEN bleibt in der Folge in seiner diplomatischen Darstellung der Kaiser- und Königsurkunden sehr nah der Position Bresslaus.21 Er schreibt ihnen eine „schöne und sorgfältige Ausstattung“ zu. Das Pergament ist „scharf rechtwinklig“ zugeschnitten. Lediglich das Breitformat wird zeitlich insofern eingeordnet, daß Diplome Friedrich Barbarossas noch alle Hochformate sind, – lediglich Mandate und Briefe auf breitformatigen Urkunden erscheinen. Das Auftreten des „hängenden Siegels“ wird dann im Zusammenhang mit dem Erscheinen des kleinen Breitformats gesehen, – ebenso die einfachere Gestaltung der Diplome. Diese Beobachtungen bleiben jedoch in ihrer zeitlichen Einordnung sehr vage. Sie müssen bei Thommen aber auch im Hinblick auf seine Formulierungen in der „Allgemeinen Diplomatik“ gesehen werden.22 Hier betont er, daß das „Format der Urkunde“ kaum für eine diplomatische Kritik hilfreich sein kann, – sehr wohl dagegen die Qualität des Pergaments. Er unterstreicht die Formatfrage noch dahingehend, daß sie keineswegs von dem Inhalt oder der Provenienz eines Stückes abhängig ist.23
Die Papsturkunden bilden insofern eine Ausnahme, als sie aufgrund ihrer zahlenmäßigen Masse und scheinbar augenfälligen Regelmäßigkeit, – gerade des „Formats“, eine Betrachtung der äußeren Form eher zulassen.24
Julius von PFLUGK-HARTTUNG gibt in seiner Untersuchung über die Papstbullen bis zum Ende des 12. Jh. genaue Meßdaten über die Länge und Breite der Urkunden und ordnet sie zumeist zeitlich ein, – in das jeweilige Ponitifikat.25 Für die Frühzeit (bis ins 10. Jh.) stellt er ein Längen-/Breitenverhältnis von 3 zu 2 fest, – als Nachwirken der Papyrusrolle wird es gedeutet. Unregelmäßigkeiten und Abweichungen treten immer wieder auf, die häufig einer unausgebildeten Kanzlei oder politischen Unruhen zugeschrieben werden (z. B Gegenpapst Anaklet II.).26 Seit Eugen III. verlieren sich diese Schwankungen.
Die Pergamentgröße richtet sich generell nach dem Umfang des Textes. PFLUGK-HARTTUNG betont aber auch die mutmaßliche Bedeutung eines „hervorragenden Stifters“. Hier werden „… große, feierlich aussehende Pergamentstücke gewählt…“.
Den Papsturkunden wird generell seit Kaiser Lothar und den Staufern eine Vorreiterrolle in der Urkundengestaltung zugesprochen, die für alle deutschen und französischen, geistlichen und weltlichen Kreise gilt. In diesem Zusammenhang wird explizit das „Pergamentformat“ genannt.27
Ludwig SCHMITZ-KALLENBERG geht kurz im üblichen Zusammenhang mit den äußeren Merkmalen einer Urkunde bei dem Beschreibstoff auf die „Formatfrage“ ein. Der Umfang des Textes, aber gerade auch die „Wichtigkeit des Inhaltes“ werden für die Größe des Schreibstoffes mitbestimmend gesehen.28 Dieser „Größe des Schreibstoffes“ schreibt er häufige Unregelmäßigkeiten zu, wobei unklar bleibt, ob der Formattyp oder das Flächenausmaß eines Pergamentstückes gemeint ist. In seinen folgenden Ausführungen über das „Urkundenformat“ schließt er sich der allgemeinen diplomatischen Meinung an, daß „anfänglich“ das Hochformat als eine „Nachwirkung des Papyrus“ zu betrachten ist. „Später“ herrscht dann das Breitformat vor.
Paulus RABIKAUSKAS behandelt in seiner Untersuchung über die „Römische Kuriale in der päpstlichen Kanzlei“ das Format jener Papsturkunden ebenfalls sehr knapp.29 Er folgt hier der allgemein üblichen Darstellung der hochformatigen Papsturkunde (charta transversa), welche sich „aus der Zeit des Papyrus“ entwickelt. Das späte 12. Jh. wird als der Zeitpunkt gesetzt, wo das Breitformat, – besonders bei einfachen Briefen –, auftritt. P. Rabikauskas unterscheidet dann klar von dem „Format“ die Flächengröße einer Urkunde. Diese Größe ist von der „Art der Urkunde“ im rechtlichen Sinne (z. B. Privileg) und der Textlänge abhängig. Für das Hochformat bei Privilegien gibt er Maße an: von 55–75 cm (bis über 80 cm) für die Länge und von 40–65 cm für die Breite.30
Thomas FRENZ will eine Entwicklung der äußeren Form der Papsturkunden aufzeigen, die auf exakten Messungen und statistischen Methoden beruht und nicht ästhetische Wertungen einbringt. Der Untersuchungszeitraum erstreckt sich über 1230 bis 1530.31 Ein Zeitraum, in dem sich auch in anderen Bereichen der Spezialdiplomatik feste Formen der Kanzlei verschiedenster Ausprägung herausgebildet haben. Die 11 exakten Messungen, die er an jeder Urkunde (Gesamtanzahl 568) vornimmt, vermitteln ausschließlich deskriptive Ergebnisse, welche sich durchgehend in absoluten Häufigkeitsdarstellungen erschöpfen.32 Die äußere Form der Urkunde (der Formattyp) bleibt dabei im Vergleich zu den paleographischen Kriterien im Hintergrund und kann auch nicht Hauptgegenstand sein, da sich bereits im 13. Jh. das Breitformat als die „DIN-Form“ durchsetzt und längst nicht mehr die Formenwechsel des 12. Jh. zu beobachten sind.
Die „Privaturkunden“ werden bei der hier behandelten Problematik zuerst von Harold STEINACKER berücksichtigt.33
Steinacker stellt den grundsätzlichen Stellenwert der Privaturkundenlehre innerhalb der allgemeinen Diplomatik dar, wobei er deren historische Entwicklung aufzeigt und hier von dem methodischen Ansatz der „organisierten“ und „nichtorgansierten“ Art der (Privat-) Urkundenherstellung ausgeht. Neben dieser Unterscheidung wird die zeitliche Einordnung der Privaturkunden in das frühe (10./11. Jh.) und späte (12./13. Jh.) Mittelalter berücksichtigt.34 Bei der Darstellung der „geistlichen Urkunde“ geht Steinacker dann global auf ihr „Format“ ein, der er jegliche „Gleichmäßigkeit“ abspricht, die eine organisierte Herstellung in einer Kanzlei bieten würde.35 Er stellt vielmehr für „alle Gruppen“ der Urkundenarten eine zeitlich bedingte gleiche Entwicklung fest: die „ältere“ Privat-Urkunde ist oft feierlich verfaßt. Diese „Feierlichkeit“ äußert sich in einer großzügigen und gelegentlich kunstvollen Flächengestaltung, die nach Steinacker den Papst- und Königsurkunden entlehnt ist. „Im Verlauf der Zeit“ beobachtet er einen Trend zur graphischen Vereinfachung und Verkleinerung der Urkunde: die nur noch „fortlaufend in einem geschriebenen“ Pergamentstücke tauchen vermehrt auf.36
In diesem Zusammenhang muß Steinackers grundsätzliche Position einer nicht organisierten Herstellung der „geistlichen Urkunde“ hervorgehoben werden. Sie wird einer nicht kanzleimäßigen Herstellungsart gleichgesetzt, die eine unregelmäßige Gestaltung der Urkunde (äußere und innere Form) bedingt.37 Wenn sich Regelmäßigkeiten in der äußeren Form feststellen lassen, wie Schreibernennung, so ordnet er es als „gedankenlose Nachahmung“ aus den Königs- und Papsturkunden ein oder bezeichnet es als „formelhafte Anlehnung“ an frühere „Privaturkunden“, wo diese Nennung üblich ist.38 Er läßt hier keine systematische Behandlung zu, was besonders deutlich im Bezug auf die Schrift und ihren Duktus wird.39 So betont er auch die Tatsache, daß es „ständige Notare“ für die geistliche Urkunde nicht gab.40 Mit diesen Beispielen soll lediglich die Methodik Steinackers versucht werden zu skizzieren. Aufgrund dieses methodischen Vorgehens muß er sich wie Bresslau davon distanzieren, das „Urkundenformat“ als Kriterium der diplomatischen Urkundenkritik aufzunehmen, weil es eine systematische Analyse des Kriteriums „Urkundenformat“ voraussetzen würde.
Einen besonderen Stellenwert innerhalb der Gruppe der „geistlichen Urkunden“ mißt er der „Offizialatsurkunde“ bei, da sie in einem bestimmten Rahmen das öffentliche Notariat ersetzt. Außerdem soll sie Wegweiser für den „besonderen Charakter“ der geistlichen Urkunde im späteren Mittelalter sein.41 Die „weltliche Urkunde“ ist eigentlich nur in ihrer „allgemeinen Verwicklung mit geistlichen Empfängern oder geistlichen Gelegenheitsschreibern“ zu betrachten.42 Schon an früherer Stelle verweist er auf die Tatsache der Empfängerherstellung für das 12. Jh., – hergestellt von den empfangenden geistlichen Stellen (wie z. B. Klöster). Für ihn sind erst ab 1240 Urkunden nachweisbar, die vom Schreiber des Ausstellers (= des Urhebers) hergestellt werden.43 Die „weltliche Urkunde“ ist also zumeist als „geistliche Urkunde“ zu behandeln.
Zusammenfassend kann gesagt werden, daß STEINACKER die „Privat – Urkunden“ auf der Ebene einer organisierten, kanzleimäßigen Herstellung analysiert, die zunächst einmal, historisch gesehen, für diese Urkunden fehlt. So kann nach ihm auch keine Gleichmäßigkeit in ihrer Gestaltung gefunden werden, die sich in den für Diplomata angewandten äußeren und inneren Merkmalen einer Urkunde äußert. Andere Eigenschaften, wie das „Urkundenformat“, werden zwar erwähnt, aber aufgrund ihrer scheinbaren Unregelmäßigkeit, gemessen an den üblichen diplomatischen Kriterien einer Urkundenkritik, als Randerscheinung, – wenn überhaupt –, gewertet.
Diese diplomatischen Äußerungen stehen im Zusammenhang mit von Steinackers einleitend formulierten Einordnung der Privaturkundenproduktion in die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung.44 Aufgrund der steigenden Produktion im 12. Jh. wird die Urkunde wieder „Bedürfnis“. Für das 13. Jh. stellt er dann eine massenhafte Urkundenherstellung fest und damit das Verlangen, diese Produktion zu organisieren. Das Planen dieses Produktes (Urkunde) erläutert er im üblichen diplomatischen Rahmen auf der rechtlichen Ebene in ihrer „Formelhaftigkeit“. Aufgrund der Masse an Urkunden im 13. Jh. tritt das Einzelstück allmählich in den Hintergrund. Es entwickelt sich ein „allgemeiner Urkundenstil“, „das individuelle Diktat ist nicht mehr möglich und nötig“. Fälschungen verschwinden ebenfalls. Die „Provenienzmethode“ verliert somit ihren Gegenstand. Der sich vom 12. Jh. zum 13. Jh. hin wandelnde Gegenstand Urkunde läßt einen „allgemeinen Urkundenstil“ erkennen, der die Gesamtheit der Urkunden und nicht das Einzelstück in seiner diplomatischen Eigenart umschreibt.
Mit Oswald REDLICH scheint die gerade erst zur Diskussion gekommene „Formatfrage“ überhaupt und jener der Privaturkunde insbesondere beendet worden zu sein. In der Nachfolge von Harold Steinacker geht Oswald Redlich mit seiner Schrift Die Privaturkunden des Mittelalters so gut wie überhaupt nicht auf das Format einer Urkunde ein.45 Für die Frühzeit der Pergamenturkunde, – seit dem 8. Jh., stellt er einen willkürlichen Gebrauch in der äußeren Form (= Formattyp) fest.46 Die Zeit 1100 bis 1250, die bei Redlich teilweise in die „Übergangszeit“ des Urkundenwesens bis zu seiner neu gewonnenen, stabilen Position nördlich der Alpen fällt, wird primär unter dem Aspekt einer Beglaubigungsform dargestellt: dem Siegel, das auch der Privaturkunde wieder neue Glaubwürdigkeit verschafft.47 Er betont weiter, daß die Privaturkunde hierbei die Königs- und Papsturkunden stark nachgeahmt hat, – gerade in ihren „äußeren Merkmalen“. Er nennt Beispiele wie das Chrismon und Elongata in der 1. Zeile oder das Monogramm bei Bischofsurkunden.48 Die äußere Form des Beschreibstoffes, verstanden als das „Urkundenformat“, wird jedoch nicht besprochen.
Richard HEUBERGER soll an dieser Stelle schon aus dem historischen Grund genannt werden, der ihn als den offiziellen direkten Nachfolger von Harold Steinacker auftreten läßt.49 Die übliche Aufteilung in Urkundentypen (Königs- u. Kaiserurk., Papsturk. u. Privaturk.) löst Heuberger auf in den allgemeinen Begriff der „Urkunde“, so daß seine Formulierungen hier nicht nur für die Privaturkunden gesehen werden müssen.50 So betont er auch, daß „das Urkundenwesen“ in einem gesamtgesellschaftlichen Rahmen steht und seine Entwicklung dort analysiert werden muß.51 Er beschreibt das Urkundenwesen für zwei Länder, Italien und Deutschland, und für zwei große Zeitabschnitte: vom 6. bis zum 12. Jh. und vom 12. bis zum 18. Jh. Leider bleiben die Ausführungen über das „Urkundenformat“ sehr kurz. Für den ersten Abschnitt in Deutschland führt er für die Frankenzeit „ ein oft kleines, unregelmäßiges und bis zu den Rändern ausgenutztes Quadrat- oder Querformat…“ an. „Später“ beobachtet Heuberger „auch ein breites Hochformat“.52 Für den zweiten Abschnitt vom 12. bis 18. Jh. sind seine Aussagen zu dem Urkundenformat in Deutschland noch genereller: er beschreibt ein „schön rechteckiges, oft liniertes“ Pergamentblatt (meist gefaltet vor der Ausgabe), dessen Höhe und Breite variieren, aber generell in ihrer Länge zunehmen. Die Urkundenfläche wird also wieder größer, – bei Heuberger ist ein längerer Zeitraum von dem 14. Jh. bis zum 17./18. Jh. gemeint.53 Das in dieser Untersuchung besonders interessierende 12. Jh. wird von Heuberger für die Pergamenturkunde kaum erwähnt, obwohl er allgemein für das 11. als auch das 12. Jh. „tiefgreifende Veränderungen“ in dem Urkundenwesen feststellt.54
Zusammenfassend kann für die Kaiser- und Königsurkunden festgehalten werden, daß sie in ihrer grafischen Gestaltung vorweg als „regelmäßig und schön“ beschrieben sind. BRESSLAU und THOMMEN bleiben in der Darstellung des „Urkundenformats“ sehr punktuell, – sowohl in der zeitlichen Einordnung als auch in den sachlichen Zusammenhängen (diplomatisch und politisch). Wesentliche allgemeine Aussagen sind bei Bresslau, daß Bedeutung und Länge des Textes ausschlaggebend für die Größe des Pergamentblattes sind. Thommen ergänzt negativ, daß Provenienz und Inhalt der Urkunde nicht ihr „Format“ bestimmen. ERBEN bemüht sich hingegen um eine chronologische Übersicht über das „Format“ bei den Kaiser- und Königsurkunden, die eine grobe geographische Verteilung auf die Länder Deutschland, Italien und Frankreich einbezieht. Er zeigt politische und wirtschaftliche Erklärungszusammenhänge auf. Auch Erben kommt zu einer allgemeinen Aussage über den Inhalt einer Urkunde, dessen Bedeutung seit Friedrich II. ihre Größe bestimmt haben soll.
Die Papsturkunden werden einmal in ihrem „Format“ chronologisch dargestellt, wobei man eine „Frühzeit“ (bis ins 11. Jh.) mit dem Hochformat und eine „Spätzeit“ (ab dem 12. Jh.) mit dem Auftreten des Breitformats (primär bei Briefen) unterscheidet. Mit ihrer institutionellen Stabilisierung in der Kanzlei, – spätestens seit Eugen III. am Ende des 12. Jh., wird der Papsturkunde eine Vorbildrolle für alle anderen Urkunden zugeschrieben. Die Einflußkette verläuft von den Papsturkunden über die Kaiser- und Königsurkunden zu den Privaturkunden. Hier nennt Pflugk-Harttung ausdrücklich das „Urkundenformat“ als Beispiel. Die Größe dieser Pergamenturkunde wird einstimmig von allen dargestellten Autoren mit der Textlänge begründet. Außerdem sind die Bedeutung des Inhalts (Schmitz-Kallenberg) und damit, diplomatisch gesehen, die Urkundenart (Rabikauskas) sowie die „Bedeutung des Stifters“(!, Pflugk-Harttung) als Begründungen angegeben. Bei den „litterae cum serico“ beschreibt Herde sogar einen Zusammenhang zwischen deren Inhalten und ihren „Formaten“, wobei er wohl eher auch die Größe der Urkundenfläche meint.
Die Privaturkunden werden nicht wie die Kaiser- und Königsurkunden als auch die Papsturkunden als eine selbständige Urkundengruppe behandelt, sondern primär in ihrer Abhängigkeit von jenen beiden anderen Urkundenbereichen gesehen. Sie sind zunächst einmal die Nachahmer in den „äußeren“ und „inneren“ Merkmalen der Herrscher- und Papsturkunden. Diese Merkmale sind jedoch die Grundlage für eine diplomatische Kritik an Urkunden, die vornehmlich von „professionellen Schreibern“ oder sogar bereits in einer Kanzlei hergestellt sind. So muß die Darstellung der Privaturkunden als unorganisierte Urkundengruppe, die gerade für das 12. Jh. noch keine professionell gestaltete Herstellung kennt, sehr lückenhaft und inkohärent ausfallen. Andererseits weist man auf die Entwicklung in der 1. Hälfte des 13. Jh. zu einem „allgemeinen Urkundenstil“ hin (besonders Steinacker), der das Einzelstück in der Masse verschwinden läßt. Es tauchen die grafisch einfach gestalteten, kleinen, breitformatigen Urkunden auf, die alle Urkundenbereiche zu erfassen scheinen (Erben für die Kaiser- u. Königsurkunden) und organisiert werden „wollen“.
Es bleibt bei diesen bruchstückhaften Beobachtungen, die das Format eher als zufällige Erscheinungsform des auf ein Stück Pergament geschriebenen Textes sehen, der aufgrund seiner diplomatischen, paleographischen und historisch-juristischen Bedeutung bestimmend auch für die „äußere Form“ der Urkunde zu sein scheint. Die „äußere Form“ wird hierbei oft gleichgesetzt mit der Pergamentgröße einer Urkunde, wobei der jeweilige Formattyp gegebenenfalls festgestellt wird. Am auffälligsten erscheint mir bei dieser Diskussion um das Urkundenformat seine ungenaue Bezeichnung. Sie umfaßt die „Größe des Pergamentblattes“, das „Format“ oder die „Größe der Urkunde“ mit unzähligen weiteren sprachlichen Varianten, die den gemeinten Tatbestand oft nur durch ergänzende Ausführungen schließen läßt.
Hauptaufgabe dieser Untersuchung ist zunächst einmal, diese Eigenschaften einer Urkunde (hier primär der Privaturkunde) mit ihrem Formattyp und der Größe ihrer Pergamentfläche zu definieren und an einer größeren Fallzahl von Privaturkunden durchgehend zu erfassen. Diese Eigenschaften, die die ästhetische Wirkung einer Urkunde auf den Betrachter und Leser mitbestimmen, sind in der Regel bei jeder unbeschädigten Urkunde vorzufinden. Sie legitimieren sich deshalb aber nicht gleich als neue Kriterien der herkömmlichen, diplomatischen Urkundenkritik. Sie sollen lediglich helfen, die Urkunde im Hochmittelalter in ihrer Ästhetik zu erfassen und andere Eigenschaften in den Vordergrund zu rücken, die immer schon bei jeder Urkunde vorhanden waren.
1.2 Methodik
Das weit gestreute Material dieser Untersuchung kann nur mit Hilfe statistisch-informatischer Mittel bewältigt werden.55
Die bekannten Methoden der Diplomatik lassen sich aufgrund der Fülle des Materials von 1714 Urkunden und ihrer geographisch weiten Streuung nur bedingt anwenden. Die Behandlung des Materials nach Provenienzgruppen wäre nur möglich, wenn zunächst diplomatische Einzelstudien verfaßt würden, – was entsprechend zeitaufwendig ist. Dagegen wird die systematische Methode, die alle Urkunden eines Ausstellers oder einer Ausstellergruppe zusammen nach bestimmten allgemeinen diplomatischen Regeln untersucht, aufgegriffen und weitergeführt. Die datenverarbeitende Methode ist ebenfalls systematisch, indem sie jede eingegebene Untersuchungseinheit, hier die Urkunde, nach bestimmten vorgegebenen Kriterien aufnimmt. Die Auswertungsmöglichkeiten können dagegen im Vergleich zur klassischen Methode wesentlich variabler sein. Außerdem kann eine wesentlich größere Dichte des Untersuchungsmaterials bewältigt werden, wie es manuell nicht mehr möglich ist.56
Diese Arbeitsweise erfordert Vorentscheidungen über die Kriterien, nach welchen die Urkunden analysiert werden sollen. Sie hat somit wesentliche inhaltliche Auswirkungen auf die Redaktion und endgültige Darstellung der Ergebnisse. Die Überlegungen dieser Untersuchung für eine formatierte Aufnahme der Urkunde in einem Code können in folgende Sachbereiche zusammengefaßt werden:
- 1. Lagerort und Identifikation der Stücke,
-
2. Kriterien für die Einordnung der Urkunde in einen historischen Rahmen:
- zeitlich, geographisch (Naturraum und neutraler Raum) und sozial-politisch (Diözese und sozialer Rang des Ausstellers und Empfängers),
- 3. Kriterien der Maße und der Beschreibung der Fläche einer Urkunde.
Die detaillierte Codierung der Urkunde nach diesen Grundüberlegungen ist Gegenstand des folgenden Kapitels 2.
Vorweg soll eine Darstellung der hier implizierten Wahrnehmung der Urkunde einen ersten Überblick, der neurodidaktisch ausgerichtet ist, verschaffen.57
1 Harry BRESSLA U: Handbuch der Urkundenlehre für Deutschland und Italien; Georges TESSIER: La Diplomatique; A. GIRY: Manuel de diplomatique; A. de BOÜARD: Manuel de diplomatique française et pontificale; Rudolf THOMMEN, Ludwig SCHMITZ-KALLENBERG, Richard HEUBERGER: Urkundenlehre I–III; Wilhelm ERBEN: Die Kaiser- und Königsurkunden des Mittelalters in Deutschland, Frankreich und Italien, S. 23–25, aber auch die gesamte Konzeption des Buches hält diese Einteilung ein. Oswald REDLICH: Die Privaturkunden des Mittelalters; Robert DELORT: Introduction aux sciences auxiliaires de l’histoire.
2 Oswald REDLICH: Allgemeine Einleitung zur Urkundenlehre, S. 23.
3 Der ältere, bekannte Begriff der „Raumaufteilung“ wird hier nicht angewandt, da z.T. andere Kriterien für die Beschreibung des „Raumes“ einer Urkunde (hier: Fläche) gewählt sind.
4 Das organisierte Kanzleiwesen ist zuerst bei den Papsturkunden und Diplomata im 12. Jh. festzustellen und erst im 13. Jh. sind Ansätze auch im Bereich der „Privaturkunden“ nachzuweisen. Vgl.: Peter RÜCK: Die Urkunden der Bischöfe von Basel bis 1213, S. 8.
5 Hans SEDLMAYR: Die Wende der Kunst im 12. Jh., S. 435.
6 Vgl. z. B. auch: Gilbert OUY, Krystyna OUY-PARCZEWSKA: Les origines des règles de l’art (première enquête).
7 Léon GILISSEN: Prolégomènes à la codicologie.
8 Carla BOZZOLO, Ezio ORNATO: Pour une histoire du livre manuscrit au moyen âge. Trois essais de codicologie quantitative.
9 Léon GILISSEN: La composition des cahiers, le pliage du parchemin et l’imposition; Jean VEZIN: La réalisation matérielle des manuscrits latins pendant le haut Moyen Age. Im Rahmen der „quantitativen Bucharchäologie“ muß noch die Arbeit von J. P. GUMBERT: The sizes of manuscripts. Some statistics and notes, genannt werden.
10 Dieser geographische Aspekt wurde zum ersten Mal schriftlich formuliert von SCHUBERT mit seinen Untersuchungen über die Lütticher „Schriftprovinz“, dem neuen Aspekt eines „größeren landschaftlichen Umkreises“: Hans SCHUBERT: Eine Lütticher Schriftprovinz nachgewiesen an Urkunden des 11. und 12. Jh. Jacques STIENNON erweitert diesen Begriff der „Schriftprovinz“ wesentlich in seiner Habilitationsschrift: L’écriture diplomatique dans le diocèse de Liège du 11e au milieu du 13e siècle. Reflet d’une civilisation.
11 Rhein und Maas-Kunst und Kultur 800–1400, Bd. 1, S. 16 (Ausstellungskatalog).
12 Ebda., S. 16.
13 Vgl.: Peter RÜCK: Zum Stand der hilfswissenschaftlichen Pergamentforschung, in: Pergament. Geschichte, Struktur, Restaurierung, Herstellung, hg. v. Peter Rück, S. 13–23.
14 Harry BRESSLA U: Handbuch der Urkundenlehre für Deutschland und Italien, Bd. 2, S. 495 f.
15 Wilhelm ERBEN: Die Kaiser- und Königsurkunden des Mittelalters in Deutschland, Frankreich und Italien, S. 125.
Details
- Seiten
- 378
- Erscheinungsjahr
- 2024
- ISBN (PDF)
- 9783631921388
- ISBN (ePUB)
- 9783631921395
- ISBN (Hardcover)
- 9783631921371
- DOI
- 10.3726/b21973
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2024 (November)
- Schlagworte
- Visuelle Kommunikation Ästhetik als Ausdruck der Zeit Analphabetismus Privaturkunden visualisieren und verkünden historische Ästhetik
- Erschienen
- Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 2024. 378 S., 22 Tab., 1 Graf.
- Produktsicherheit
- Peter Lang Group AG