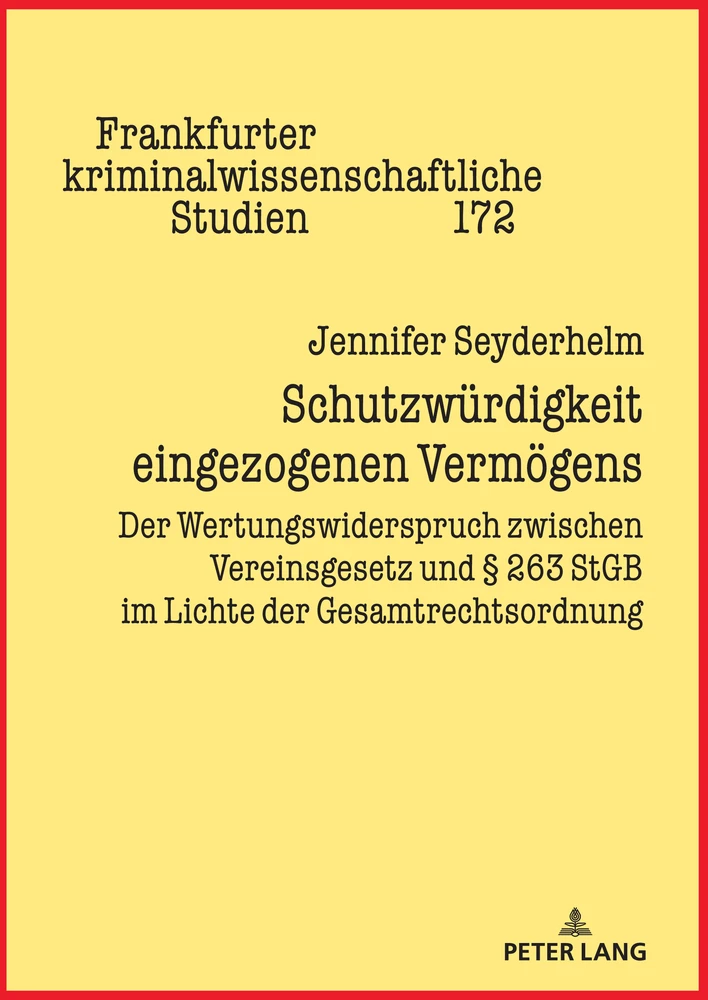Schutzwürdigkeit eingezogenen Vermögens
Der Wertungswiderspruch zwischen Vereinsgesetz und § 263 StGB im Lichte der Gesamtrechtsordnung
Zusammenfassung
Argumente, die für die Auflösung des Wertungswiderspruchs sprechen, werden aus der Gesamtrechtsordnung entwickelt. Im Fokus steht dabei das straf- und verfassungsrechtlich beleuchtete Argument der Einheit der Rechtsordnung. Das Werk erarbeitet Maßstäbe, die Wissenschaft und Praxis befähigen sollen, den Wertungswiderspruch zu erkennen und aufzulösen.
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- A. Einführung
- I. Anlass der Untersuchung
- 1. Der Fall: Betrug zu Lasten einer Terrororganisation
- 2. Die Rechtsprechung als Verfechterin des wirtschaftlichen Vermögensbegriffs
- 3. Das Literaturecho
- a) Die Kritiker
- b) Die Fürsprecherin
- c) Bewertung
- 4. Fazit
- II. Gegenstand der Untersuchung
- 1. Eigene Analyse: Die (übersehene) Rolle des VereinsG
- 2. Zu analysierender Fall: Betrug zu Lasten eines Mitglieds eines verbotenen Vereins
- III. Gang der Untersuchung
- B. Einordnung des Widerspruchs zwischen Vereins- und Strafrecht
- I. Analyse: Betrugsstrafrechtlicher Vermögensschutz
- 1. Schutzzweck des Betrugs
- 2. Strafrechtliche Einziehung und Vermögensschutz
- 3. Relevanz des strafrechtlichen Vermögensbegriffs
- a) Vermögensbegriffe
- aa) Der juristische Vermögensbegriff
- bb) Der wirtschaftliche Vermögensbegriff
- cc) Der juristisch-ökonomische Vermögensbegriff
- dd) Der personale Vermögensbegriff
- ee) Der funktionale Vermögensbegriff
- ff) Der normativ-ökonomische Vermögensbegriff
- gg) Zwischenfazit
- b) Überzeugend: Die normative Komponente
- aa) Keine Sorge vor rechtsfreien Räumen
- bb) Zivilrechtlicher Besitzschutz hilft nicht weiter
- cc) Kohärenz mit Eigentumsdelikten möglich
- dd) Inkonsequenz der rein wirtschaftlichen Betrachtung
- ee) Unbestimmtheit der rein wirtschaftlichen Betrachtung
- ff) Zwischenfazit
- 4. Fazit: Normativ geprägter Vermögensbegriff als Grundlage für die Berücksichtigung des Widerspruchs
- II. Analyse: Vereinsgesetzliche Einziehung
- 1. Einordnung in das Maßnahmenprogramm des VereinsG
- a) Beschlagnahme
- b) Abwicklung
- 2. Voraussetzungen der Einziehung
- a) Besondere Einziehungsanordnung
- b) Anknüpfen an Verbotstatbestand
- aa) Erster Verbotsgrund: Verstoß gegen Strafgesetze
- bb) Zweiter Verbotsgrund: Verstoß gegen die verfassungsmäßige Ordnung
- cc) Dritter Verbotsgrund: Verstoß gegen den Gedanken der Völkerverständigung
- 3. Rechtsfolgen der Einziehung
- a) Umfang der Einziehung
- aa) Vereinsvermögen
- bb) Gegenstände Dritter
- cc) Verzicht auf Vermögenseinziehung
- b) Erfasste Vermögen inhabende Rechtssubjekte
- aa) Verein und Teilorganisation
- bb) Ersatzorganisation
- cc) Dritte
- c) Zwischenfazit
- 4. Charakter und Zweck der Vermögenseinziehung
- a) Charakter
- b) Doppelte Zwecksetzung
- 5. Wertbestimmung im Kontext der vereinsrechtlichen Einziehungsvorschriften
- 6. Fazit: Umfassende Abschöpfung und Auslöschung des Vermögensinhabers durch das VereinsG
- III. Der Wertungswiderspruch
- 1. Einordnung des Widerspruchs
- a) Logischer Widerspruch
- b) Terminologischer Widerspruch
- c) Normlogischer Widerspruch
- aa) Deontischer Widerspruch
- bb) Normativer Widerspruch
- d) Wertungswiderspruch
- aa) Voraussetzungen
- bb) Subsumtion
- cc) Konsequenz für den Vermögensbegriff
- e) Zwischenfazit: Wertungswiderspruch liegt vor
- 2. Warum der Wertungswiderspruch aufgelöst werden muss
- a) Einheit der Rechtsordnung
- aa) Konturierung des Begriffs
- bb) Adressierung
- cc) Konsequenz
- b) Im Kontext des Vermögensbegriffs: Legitimes Wirtschaften
- 3. Fazit
- IV. Fazit: Wertungswiderspruch muss beachtet werden
- C. Betrachtung des Wertungswiderspruchs im Lichte der Gesamtrechtsordnung
- I. Strafrechtliche Flankierung des Wertungswiderspruchs
- 1. Argumentation: Schutzunwürdigkeit kraft Einziehung
- a) Eigentum des Staates
- b) Generalpräventive Zwecksetzung
- c) Kein Zirkelschluss
- d) Zwischenfazit
- e) Konsequenz für die vereinsrechtliche Einziehung
- aa) Eigentum des Staates
- bb) (General)präventive Zwecksetzung
- cc) Zwischenfazit: Übertragbarkeit der Argumentation auf vereinsrechtliche Einziehung
- 2. Analyse: Strafrechtliche Einziehung
- a) Überblick
- b) Voraussetzungen der Einziehung
- aa) Die einfache Einziehung
- bb) Die erweiterte Einziehung
- c) Beschränkung der Einziehung
- aa) Ausschluss der Einziehung
- bb) Absehen von der Einziehung
- cc) Unterbleiben der Vollstreckung
- dd) Zwischenfazit
- d) Rechtsfolgen der Einziehung
- aa) Umfang der Einziehung
- bb) Erfasste Einziehungsbetroffene
- cc) Zwischenfazit
- e) Zweck und Charakter der strafrechtlichen Einziehung
- aa) Zwecksetzung
- bb) Charakter
- f) Wertbestimmung im Kontext der strafrechtlichen Einziehungsvorschriften
- g) Zwischenfazit: Grenzen der strafrechtlichen Einziehung
- 3. Vergleich von straf- und vereinsrechtlicher Einziehung
- a) Gemeinsamkeiten
- aa) Staat als neuer Rechtsträger
- bb) Maßnahme ohne Strafcharakter
- cc) Präventionszweck
- dd) Wirtschaftlicher Maßstab
- ee) Zwischenfazit
- b) Unterschiede
- aa) Unterschiedliche Beschränkungsmöglichkeiten der Einziehung
- bb) Unterschiedliche Voraussetzungen: VereinsG geht über StGB-Verstoß hinaus
- cc) Unterschiedlicher Bezugspunkt der Abschöpfung: VereinsG schöpft umfassend und nicht tatbezogen ab
- dd) Unterschiedliche Konsequenz für Rechtssubjekt: VereinsG normiert das Erlöschen
- ee) Zwischenfazit: Vereinsrechtliche Einziehung geht über die strafrechtliche Einziehung hinaus
- c) Zwischenfazit für den Vergleich: Argumentation kann uneingeschränkt übertragen werden
- 4. Fazit zur strafrechtlichen Flankierung des Wertungswiderspruchs
- II. Zivilrechtliche Flankierung des Wertungswiderspruchs
- 1. Keine Primäransprüche
- a) Verstoß gegen gesetzliches Verbot
- b) Verstoß gegen die guten Sitten
- 2. Keine Sekundäransprüche
- a) Kein Anspruch aus § 823 Abs. 2 BGB i.V.m. § 263 StGB
- b) Kein Anspruch aus § 826 BGB
- c) Kein Anspruch aus § 812 Abs. 1 BGB
- d) Kein Anspruch aus § 985 BGB
- 3. Fazit: Keine zivilrechtlichen Ansprüche
- 4. Weitere zivilrechtliche Folgen
- a) Keine Anwendung zivilrechtlicher Abwicklungsregulatorik
- b) Eintragung in öffentliche Register
- c) Auswirkung auf zivilrechtliche Beziehungen
- 5. Fazit zur zivilrechtlichen Flankierung des Wertungswiderspruchs
- III. Verfassungsrechtliche Flankierung des Wertungswiderspruchs
- 1. Grundrechtliche Verankerung des VereinsG
- 2. Strafverfassungsrecht
- a) Forschungsgegenstand
- b) Zwischenfazit
- 3. Verfassungsrechtliche Grenzen des Strafrechts
- a) Strafrecht als ultima ratio
- b) Grundsatz der Verhältnismäßigkeit
- c) Fragmentarischer Charakter und Subsidiarität des Strafrechts
- d) Zwischenfazit
- 4. Verfassungsrechtliche Maßstäbe für das Strafrecht
- a) Grundrechte
- aa) Grundrechte als Wertordnung
- bb) Verfassungskonforme Auslegung
- cc) Verfassungsorientierte Auslegung
- dd) Bedeutung der Grundrechte im strafrechtlichen Deliktsaufbau
- ee) Zwischenfazit
- b) Prinzip der Einheit der Rechtsordnung
- aa) Verfassungsrechtliche Dimension
- bb) Bedeutung für den Wertungswiderspruch
- cc) Zwischenfazit: Verletzung des Prinzips der Einheit der Rechtsordnung
- c) Zwischenfazit
- 5. Fazit zur verfassungsrechtlichen Flankierung des Wertungswiderspruchs
- IV. Fazit: Argumente folgen aus Gesamtrechtsordnung
- D. Eigener Lösungsansatz
- I. Instrumente für die Auflösung des Wertungswiderspruchs
- 1. Analogie
- 2. Teleologische Reduktion
- 3. Korrektur des Strafrahmens
- 4. Auslegung
- 5. Fazit: Auslegung von § 263 StGB
- II. Einzelne Kriterien für das Vorliegen des Wertungswiderspruchs
- 1. Eindeutige rechtliche Missbilligung durch Vereinsverbot und Einziehungsanordnung
- a) Bestimmung des Zeitpunkts
- aa) Zeitpunkt vor Erlass der Verbotsverfügung
- bb) Materielle Bestandskraft: Wirksame Verbotsverfügung
- cc) Vollziehbarkeit der Verbotsverfügung
- dd) Formelle Bestandskraft: Unanfechtbare Verbotsverfügung
- ee) Zwischenfazit: Unanfechtbarkeit von Vereinsverbot und Einziehungsanordnung
- b) Ausstrahlungswirkung in die Zukunft
- c) Berücksichtigung behördlicher Entscheidungen bei der Auslegung von Strafnormen
- aa) Grundsatz der Gewaltenteilung
- bb) Formen der Akzessorietät
- cc) Möglichkeit der Berücksichtigung der Verbotsentscheidung
- dd) Zwischenfazit: Strafgericht kann behördliche Entscheidung berücksichtigen
- d) Zwischenfazit: Vereinsverbot und Einziehungsanordnung müssen unanfechtbar sein
- 2. Persönlicher Anwendungsbereich
- a) Maßstab
- b) Verbotene Organisation
- c) Mitglied
- d) Nichtmitglied
- e) Kritik
- aa) Viktimodogmatik
- bb) Feindstrafrecht
- f) Zwischenfazit
- 3. Einsatz des Vermögens zu rechtlich missbilligten Zwecken
- a) Abgrenzung zur Individualsphäre
- b) Konkrete Zweckbestimmung
- aa) Zweck der Terrorismusfinanzierung
- bb) Anknüpfen an vereinsrechtliche Zurechnungskriterien
- cc) Rechtlich missbilligter Zweck: Einsatz zu verbotenen Zielen des Vereins
- c) Zwischenfazit
- 4. Relevanter räumlicher Geltungsbereich
- a) Ausländervereine
- b) Ausländische Vereine
- c) Zwischenfazit
- 5. Fazit: Übersicht über die drei einzelnen Kriterien
- III. Rechtsfolge
- 1. Keine Betrugsstrafbarkeit
- a) Kein vollendeter Betrug
- b) Untauglicher Versuch und Wahndelikt
- aa) Kein untauglicher Versuch
- bb) Wahndelikt
- 2. Alternative Strafbarkeit
- a) Geldwäsche
- b) Vereinigungsstrafrecht
- c) Versuch der Beteiligung
- 3. Fazit: Keine Strafbarkeitslücke
- IV. Auseinandersetzung mit denkbarer Kritik
- 1. Vereinbarkeit mit der Auslegung des Vermögensbegriffs
- a) Wortlaut
- b) Systematik
- c) Historie
- d) Telos
- e) Zwischenfazit
- 2. Vereinbarkeit mit strafverfassungsrechtlichen Garantien
- 3. Keine Umgehung der Vorlagepflicht
- 4. Weder Freibrief noch Anreiz
- a) Kein Freibrief
- b) Kein Anreiz
- c) Zwischenfazit
- 5. Kein Verstoß gegen den ne bis in idem-Grundsatz
- 6. Keine Divergenz zu Eigentumsdelikten
- 7. Fazit: Kritik kann entkräftet werden
- V. Fazit: Wertungswiderspruch kann durch eigenen Lösungsvorschlag erkannt und aufgelöst werden
- E. Anwendungsfälle und parallel gelagerter Wertungswiderspruch
- I. Praktische Anwendungsfälle
- 1. Rechtsextremismus
- a) Verbote rechtsextremistischer Vereine
- b) Anwendungsbeispiel
- aa) Fall
- bb) Rechtliche Bewertung
- 2. Linksextremismus
- a) Verbote linksextremistischer Vereine
- b) Anwendungsbeispiel
- aa) Fall
- bb) Rechtliche Bewertung
- 3. Islamismus
- a) Verbote islamistischer Vereine
- b) Anwendungsbeispiel
- aa) Fall
- bb) Rechtliche Bewertung
- 4. Rockergruppierungen
- a) Verbote von Rockergruppierungen
- b) Anwendungsbeispiel
- aa) Fall
- bb) Rechtliche Bewertung
- 5. Reichsbürgerliche Vereinigungen
- a) Verbot einer Reichsbürger-Vereinigung
- b) Anwendungsbeispiel
- aa) Fall
- bb) Rechtliche Bewertung
- 6. Fazit
- II. Parallel gelagerter Wertungswiderspruch: Parteiverbot und Einziehung
- 1. Wertungswiderspruch
- a) Zu analysierender Fall: Betrug zu Lasten eines Mitglieds einer verbotenen Partei
- b) Maßstab
- aa) Eindeutige rechtliche Missbilligung durch Parteiverbot und Einziehung
- bb) Persönlicher Anwendungsbereich: Parteimitglied
- cc) Einsatz des Vermögens zu rechtlich missbilligten Zwecken
- c) Zwischenfazit
- 2. Rechtsmethodologische Überprüfung
- a) Voraussetzungen eines Wertungswiderspruchs
- aa) Ergebnis
- bb) Begründung
- cc) Widerspruch
- b) Zwischenfazit
- 3. Praktische Anwendungsfälle
- a) Parteiverbotsverfahren
- b) Zwischenfazit
- 4. Fazit
- III. Nicht geeignete Anknüpfungspunkte
- 1. Anknüpfung an Struktur des Verbotssubjekts
- 2. Anknüpfung an Einziehungsvorschriften in anderen Gesetzen
- 3. Fazit
- IV. Fazit: Lösungsvorschlag ist praxistauglich
- F. Zusammenfassung und Ergebnisse der Untersuchung
- G. Literaturverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Die in dieser Arbeit verwendeten Abkürzungen richten sich nach Kirchner.1
1 Kirchner/Böttcher, Abkürzungsverzeichnis der Rechtssprache.
A. Einführung
Ist das Vermögen einer Terrororganisation strafrechtlich schutzwürdig? Der Bundesgerichtshof bejahte dies in einem Fall aus dem Jahr 2017, in dem es um einen Betrug zu Lasten der Vereinigung „Islamischer Staat“2 ging. Besonders ist und viel Beachtung fand diese Entscheidung, weil es sich bei der verletzten Person um ein (vermeintliches) Mitglied einer Terrororganisation handelte.3 Die dadurch ausgelöste Diskussion bewegte sich zwischen dem wirtschaftlichen und dem juristisch-ökonomischen Vermögensbegriff und entzweite sich an der Frage, ob normative Wertungen im Rahmen der Schutzwürdigkeit von Vermögen zu berücksichtigen seien.4
Die Entstehung dieser Dissertation ist auf diesen Fall zurückzuführen. Er diente der Verfasserin als Ausgangspunkt, um einen normativen Wertungswiderspruch im Kontext des Betrugstatbestands zu analysieren.
I. Anlass der Untersuchung
Zum besseren Verständnis wird der Fall und die sich daran anschließende Literaturdiskussion im Folgenden kurz erläutert.
1. Der Fall: Betrug zu Lasten einer Terrororganisation
Im maßgeblichen Fall befasste sich der 5. Strafsenat des Bundesgerichtshofs im Rahmen einer Revision mit der Frage, ob das Vermögen des „Islamischen Staats“ dem schutzwürdigen Vermögen des § 263 StGB unterlag und bejahte dies.5
Dem lag folgender Sachverhalt zu Grunde: Der Angeklagte hatte via Facebook Kontakt zu einem vermeintlichen Funktionär des „Islamischen Staats“ aufgenommen – der Facebook-Account war zum Tatzeitpunkt tatsächlich in den Händen eines syrischen Oppositionellen –, um diesem einen Deal vorzuschlagen. Er wolle sich um die Beschaffung von acht mit einer nicht näher bezeichneten Substanz beladenen Autos kümmern und im Gegenzug 180.000 € erhalten. Dabei verfolgte der Angeklagte nicht die Absicht, den behaupteten Plan in die Tat umzusetzen, sondern wollte das Geld lediglich für eigene Zwecke verwenden. Letztlich scheiterte die Umsetzung dieses Plans. Die Auffassung des Landgerichts Saarbrückens, der Angeklagte habe sich eines versuchten Betruges zu Lasten des „Islamischen Staats“ strafbar gemacht, bestätigte der Bundesgerichtshof.
2. Die Rechtsprechung als Verfechterin des wirtschaftlichen Vermögensbegriffs
Der Bundesgerichtshof positionierte sich in diesem Urteil klar zum wirtschaftlichen Vermögensbegriff. Ohne große Umschweife lehnte der Senat eine normative Einschränkung des schutzwürdigen Vermögens ab. Mit Verweis auf die ständige Rechtsprechungspraxis hielt er am ausschließlich wirtschaftlich ausgerichteten Beurteilungsmaßstab fest und wiederholte das bereits aus vielen Urteilen bekannte Dogma: „Die Rechtsordnung kennt im Bereich der Vermögensdelikte allgemein kein wegen seiner Herkunft, Entstehung oder Verwendung schlechthin schutzunwürdiges Vermögen.“6 Eine andere Beurteilung ergebe sich auch nicht aus § 89c StGB, dem Tatbestand der Terrorismusfinanzierung. Weder sei vorliegend § 89c StGB tatbestandlich erfüllt noch habe sich der Gesetzgeber bei Schaffung der Norm mit dem strafrechtlichen Vermögensschutz befasst.7 Damit sah der Bundesgerichtshof ausdrücklich keinen Widerspruch in folgender Konstellation: Eine Person macht sich nach § 263 StGB strafbar, wenn sie dem „Islamischen Staat“ durch Täuschung zur einer Vermögensverfügung veranlasst, die ihrerseits gleichzeitig nach § 89c StGB strafbar wäre.
3. Das Literaturecho
Trotz der Kürze des Falls und der überschaubaren Argumentationskette des Strafsenats ist der – fast ausschließlich kritische – Widerhall in der Literatur dazu nicht gering ausgefallen. Ob der wirtschaftliche Vermögensbegriff auch auf den Fall mit dem „Islamischen Staat“ als Verletzten passe, hat die anschließende Literaturdiskussion deutlich in Frage gestellt.8 Denn durch den vor dem Bundesgerichtshof entschiedenen Fall ist die Betrugskasuistik um einen Fall mit einer ungewöhnlichen verletzten Person, namentlich einem Mitglied einer Terrororganisation, ergänzt worden.9
a) Die Kritiker
Jahn stellt – aus juristisch-ökonomischer Perspektive – auf einen Widerspruch des Urteils mit der hinter § 89c StGB stehenden Wertung ab.10 Unabhängig von einer hier zu verneinenden Strafbarkeit nach § 89c StGB wäre das Spannungsfeld zwischen dem strafrechtlichen Vermögensschutz einerseits und dem Verbot der Terrorismusfinanzierung andererseits zu reflektieren gewesen.11 Ebner tendiert in die gleiche Richtung und unterzieht die Entscheidung einer Kohärenzprüfung mit innerhalb und außerhalb des StGB liegenden Normen – dabei rekurriert er innerhalb auf die Wertungen aus §§ 129a, 129b, 89c, 261 Abs. 1 S. 2 Nr. 5, 73 ff. StGB und außerhalb auf §§ 40, 85 S. 1 AO, § 50 EStDV.12 Auch Wachter schließt sich dem an und stellt (ausschließlich) auf einen genuin strafrechtlichen Widerspruch mit § 89c StGB ab; durch die Anwendung des wirtschaftlichen Vermögensbegriffs würden Erwartungen der Terrororganisation geradezu abgesichert und in den Stand eines Schutzguts gehoben.13 Bechtel erläutert den Zusammenhang mit § 89c StGB wie folgt und spricht dabei von einer „doppelten Bemakelung“14: Der Zweck, Terror zu finanzieren, sei in § 89c StGB pönalisiert und die Finanzierung desselben sei folglich rechtlich missbilligt. Als Besonderheit stellt er in diesem Zusammenhang heraus, dass gerade der Finanzierung von Terror ein eigener Straftatbestand gewidmet sei.15 In anderen Worten kritisieren die dargestellten Literaturstimmen Folgendes: Wenn die Finanzierung eines Zwecks in § 89c StGB ausdrücklich pönalisiert sei, könne das dafür aufgewandte Geld nicht überzeugend auch gleichzeitig von § 263 StGB geschützt werden.16
b) Die Fürsprecherin
Li, die einzige Kritikerin, die die Anwendung des wirtschaftlichen Vermögensbegriffs in diesem Fall als überzeugend bewertet, tritt dem entschieden entgegen.17 Dass die Finanzierung eines Zwecks unter Strafe gestellt sei, habe keine Implikation für die Strafbarkeit einer Betrugstat; denn der gesetzgeberischen Intention, die § 89c StGB zugrunde liegt, sei keine Aussage zu entnehmen, wie mit einem betrügerischen vermögensschädigenden Verhalten umzugehen ist.18 Es bestehe gerade kein Widerspruch zu § 89c StGB, da ein staatlicher Kampf gegen den Terror keine Inkohärenz zu einem Zugriff durch Privatpersonen auf das Vermögen einer Terrororganisation darstelle.19
c) Bewertung
Die Argumentation von Li verkennt, dass es sich in dieser Konstellation um einen Wertungswiderspruch handeln könnte. Dabei geht es nicht um die – wie Jahn zu Recht ausführt – „technische Tatbestandserfüllung im Einzelfall, sondern um die hinter der neuen Strafnorm stehende[n] Wertung.“20 Abzugrenzen ist ein Wertungswiderspruch von einem möglichen normlogischen Widerspruch, der leichter erkennbar ist, aber hier wohl nicht vorliegt: § 263 StGB ist nicht die Erlaubnis zu entnehmen, Terrorismus zu finanzieren und enthält auch kein entsprechendes Gebot, dies zu tun.21 Dennoch könnten die Wertungen beider Tatbestände im Widerspruch stehen, wenn einerseits die finanzielle Unterstützung von Terrororganisationen sanktioniert werde und andererseits gleichzeitig diese Geldflüsse unter den Schutz des § 263 StGB gefasst werden würden.22 Die Kernfrage, die es in der Literaturdiskussion zu beantworten gilt, ist Folgende: Kann ein strafrechtlicher Tatbestand das schützen, was ein anderer gerade verbietet?23
Zudem geht es – auch bei normativer Einschränkbarkeit des Vermögensbegriffs und damit einer potentiellen Verneinung der Betrugsstrafbarkeit als Folge – nicht darum, eine Einladung an Privatpersonen auszusprechen, das Vermögen einer Terrororganisation zu schädigen. Vielmehr geht es darum, das Tatbestandsmerkmal normativ zu konturieren und nur das vermögensstrafrechtlich zu erfassen, was sich sowohl wirtschaftlich als auch normativ betrachtet als schutzwürdige Vermögensposition erweist.24
Ordnet man die Diskussion, die dieser Fall ausgelöst hat, Vermögensbegriffen zu, wird deutlich, dass die Argumentation der Literatur vorrangig auf dem juristisch-ökonomischen Vermögensbegriff basiert, der eine normative Einschränkung auf wirtschaftlicher Grundlage zulässt.25 Dem gegenüber steht der von der Rechtsprechung angewandte wirtschaftliche Vermögensbegriff, der aufgrund der ausschließlichen Ausrichtung an wirtschaftlichen Maßstäben eine zusätzliche normative Beurteilung ablehnt.26 Achenbach bewertet die Entscheidung – Bezug nehmend auf das vom Bundesgerichtshof wiederholte Dogma „Die Rechtsordnung kennt im Bereich der Vermögensdelikte allgemein kein wegen seiner Herkunft, Entstehung oder Verwendung schlechthin schutzunwürdiges Vermögen“27 – wie folgt: „Schade! Der Fall hätte nun wirklich Gelegenheit geboten, diese unbeirrt aufrechterhaltene Formel zu reflektieren und mit den dadurch aufgeworfenen Widersprüchen in der Rechtsordnung zu konfrontieren […].“28
4. Fazit
Das dargestellte Urteil hat eine rege und kritische Diskussion über die normative Einschränkung schutzwürdigen Vermögens im Rahmen des § 263 StGB erneut entfacht. Primär bleibt diese allerdings im StGB verhaftet. Die Debatte hat die Frage nach der Berücksichtigung normativer Inkohärenzen am Tatbestandsmerkmal des Vermögens aufgeworfen und unbeantwortet gelassen. Der Verfasserin dient diese Feststellung als Einladung, den Fall abstrahiert zu betrachten und einen Wertungswiderspruch herauszuarbeiten, der – soweit ersichtlich – noch nicht Gegenstand vertiefter rechtswissenschaftlicher Analyse war.
II. Gegenstand der Untersuchung
In dieser Untersuchung geht es allerdings nicht darum, eine weitere Besprechung des „IS-Falls“ zu verfassen, sondern abstrakt einen Wertungswiderspruch zu betrachten und zu analysieren. Der Fall dient insofern nur als anschauliches Vehikel und nicht als Beschränkung für diese Untersuchung.
Unabhängig von den bereits dargestellten Literaturstimmen gilt es zu erarbeiten, welche weiteren tragenden Gesichtspunkte es geben könnte, die im Rahmen der Schutzwürdigkeit strafrechtlichen Vermögens eine Rolle spielen können. Unterstellt wird – wie es auch in der Literaturdiskussion unausgesprochen der Fall war – dass es sich tatsächlich bei der verletzten Person um ein Mitglied des „Islamischen Staats“ gehandelt hätte. Nur aufgrund dieser Zuordnung der verletzten Person zu einer Terrororganisation sticht dieser Fall heraus und wirft die Frage auf, ob auch das Vermögen einer Terrororganisation schutzwürdig ist. Allein die Mitgliedschaft in einer Terrororganisation kann und darf allerdings nicht dazu führen, dass strafrechtlicher Vermögensschutz versagt wird. Der Anknüpfungspunkt der Betrugsstrafbarkeit liegt nicht in der Person des Verletzten oder der Bewertung der dahinterstehenden (Terror-) Organisation, sondern in der Tatbestandsmäßigkeit des in Rede stehenden Verhaltens.29 Vielmehr offenbart sich ein Widerspruch, der an die Vermögensposition an sich anknüpft.
1. Eigene Analyse: Die (übersehene) Rolle des VereinsG
Die normative Grundlage, die einen Widerspruch hervorruft und bis jetzt keinen Einzug in die Diskussion gefunden hat, liegt im Vereinsgesetz. Bei der Terrororganisation „Islamischer Staat“ handelt es sich um eine Organisation, deren Tätigkeit gemäß § 3 Abs. 1 i.V.m. § 15 Abs. 1 und § 18 S. 2 VereinsG seit dem 12. September 2014 durch Verbotsverfügung vom zuständigen Bundesinnenministerium verboten ist, weil sie Strafgesetzen zuwiderläuft, sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung und den Gedanken der Völkerverständigung richtet.30 Von der in der Regel damit verbundenen Einziehung und Beschlagnahme gemäß § 3 Abs. 1 S. 2 VereinsG von Vermögen, Sachen und Forderungen Dritter wurde in Nrn. 4–6 der Verbotsverfügung Gebrauch gemacht.31
Daraus ergibt sich folgende Konstellation: Das Vermögen dieser als verfassungsfeindlich eingestuften Vereinigung wurde als Folge eines Verbots eingezogen. Gleichzeitig wird die Schutzwürdigkeit einer solchen Vermögensposition von Rechtsprechung und einem Teil der Literatur bejaht, indem diese als Schutzgut des § 263 StGB qualifiziert wird. Ob dieses Ergebnis überzeugend ist, wird durch die Thesen, die in dieser Untersuchung aufgestellt werden, beurteilt werden können. Gegenstand dieser Untersuchung ist vor diesem Hintergrund ein Wertungswiderspruch zwischen vereinsrechtlichen Wertungen aus §§ 3 Abs. 1, 11 Abs. 1, 2 VereinsG und strafrechtlichen Wertungen aus § 263 Abs. 1 StGB.
2. Zu analysierender Fall: Betrug zu Lasten eines Mitglieds eines verbotenen Vereins
Die Untersuchung beschränkt sich nicht auf den „IS-Fall“, sondern wählt den im Folgenden vorgestellten Fall als Ausgangsfall für die Prüfung eines Wertungswiderspruchs. Denn das Vorliegen eines möglichen Wertungswiderspruchs ist nicht abhängig davon, ob die verletzte Person dem „Islamischen Staat“ angehört. Es kommt maßgeblich darauf an, ob die Person und ihr Verhalten einem – unter bestimmten Voraussetzungen – verbotenen Verein „zugerechnet“ werden können. Wie der Zusammenhang zwischen der getäuschten Person und dem verbotenen Verein ausgestaltet sein muss und warum infolgedessen vermögensstrafrechtlicher Schutz zu versagen ist, wird in dieser Untersuchung zu prüfen sein.
Zunächst dient folgendes Beispiel als Ausgangsfall: A ist Mitglied eines Vereins. Dieser Verein wurde durch Verbotsverfügung verboten und aufgelöst, weil er Strafgesetzen zuwiderläuft und sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung richtet. Die Einziehung des Vereinsvermögens wurde angeordnet, sodass dieses auf den Staat übergegangen ist. A tritt in der Folgezeit an B heran mit folgender Bitte: B erhalte von A finanzielle Mittel, um einen Terroranschlag zu finanzieren. A übergibt B den vereinbarten Geldbetrag; die Gegenleistung bleibt allerdings aus, weil B nicht vorhatte, das Geld entsprechend einzusetzen. Täuschungsbedingt hat A in dieser Konstellation Geld zu illegalen Zwecken an B geleistet, die ihren Teil der Verabredung nicht erfüllt hat.
Es stellt sich die Frage, ob B sich des Betruges zu Lasten des A strafbar gemacht hat. Bejaht man diese Frage und stützt sich ohne große Umschweife auf das Dogma der Rechtsprechung32, kann dieses Ergebnis – wie im „IS-Fall“ auch – sowohl bei Laien als auch in der Rechtswissenschaft ein irritierendes „Störgefühl“ auslösen.33 Denn es wird Vermögen als strafrechtlich schutzwürdig qualifiziert, das einem Verein zugeordnet werden kann, der aufgrund einer staatlichen Intervention weder existiert noch über Vermögen verfügt noch darüber verfügen darf. Die Frage nach der Strafbarkeit kann allerdings aus überzeugenden Gründen verneint werden, wenn der juristisch-ökonomischen Vermögenslehre gefolgt wird. Auf dieser Grundlage kann die schwer zu fassende normative Inkongruenz berücksichtigt und aufgelöst werden, die sich als Wertungswiderspruch herausstellen wird.
III. Gang der Untersuchung
Ziel dieser Untersuchung ist es, einen Wertungswiderspruch zwischen vereins- und betrugsstrafrechtlichen Wertungen zu analysieren. Es werden Maßstäbe entwickelt, die Rechtswissenschaft und -praxis befähigen sollen, die Konstellation, in der ein solcher Wertungswiderspruch entsteht, zu erkennen und diesen aufzulösen. Ausgehend von einer Analyse der entsprechenden Wertungen aus §§ 3 Abs. 1, 11 Abs. 1, 2 VereinsG und § 263 Abs. 1 StGB, wird eine rechtsmethodologische Prüfung des bestehenden Widerspruchs vorgenommen.
Der analysierte Wertungswiderspruch soll nicht nur punktuell zwischen VereinsG und StGB betrachtet werden, sondern auch in den Zusammenhang mit der Gesamtrechtsordnung gestellt werden. Dafür wird zunächst eine Parallele zwischen vereins- und strafrechtlicher Einziehung gezogen. Daraus werden Konsequenzen für die Schutzwürdigkeit einer eingezogenen Vermögensposition abgeleitet. Daran anschließend wird geprüft, ob die verletzte Person im vorliegenden Fall Schutz durch das Zivilrecht beanspruchen könnte. Schließlich wird eine verfassungsrechtliche Betrachtung vorgenommen, aus der Argumente für die Berücksichtigung des Wertungswiderspruchs folgen. Das Argument der Einheit der Rechtsordnung wird ebenfalls verfassungsrechtlich eingeordnet und geprüft, welche Implikation diesem Argument für den Umgang mit Wertungswidersprüchen entnommen werden kann.
Wie die Auflösung des Wertungswiderspruchs erfolgen kann, ist Gegenstand von Abschnitt D. dieser Untersuchung. Dort werden zunächst rechtsmethodologisch Möglichkeiten vorgestellt, die für die Auflösung eines Wertungswiderspruchs zur Verfügung stehen. Zudem wird die Kernfrage beantwortet, die dieser Untersuchung zugrunde liegt: In welcher Konstellation liegt ein Wertungswiderspruch zwischen §§ 3 Abs. 1, 11 Abs. 1, 2 VereinsG und § 263 Abs. 1 StGB vor, der aufzulösen ist? Die Antwort wird in Gestalt eines eigenen Lösungsansatzes entwickelt. Er enthält drei Kriterien, die als normative Komponente beim juristisch-ökonomischen Vermögensbegriff zu berücksichtigen sind und zur Schutzunwürdigkeit der entsprechenden Vermögensposition führen. Die Kriterien dienen als Instrument, den Wertungswiderspruch zu erfassen. Der eigene Lösungsansatz wird auf die Vereinbarkeit mit straf- und verfassungsrechtlichen Vorgaben hin untersucht und mit naheliegender Kritik konfrontiert werden.
In Abschnitt E. werden praktische Anwendungsfälle vorgestellt, die veranschaulichen, in welchen Konstellationen ein aufzulösender Wertungswiderspruch vorliegen kann. Schließlich wird untersucht, ob ein parallel gelagerter Wertungswiderspruch vorliegt, wenn eine Auflösung des Vermögensinhabers und Einziehung von entsprechendem Vermögen nicht aufgrund eines Vereins-, sondern eines Parteiverbotsverfahrens erfolgte und welche weiteren Anwendungsfälle denkbar sind.
Das nicht leicht zu verortende „Störgefühl“, das entsteht, wenn normative Widersprüche nicht beachtet werden, kann beseitigt werden. Es wird in dieser Arbeit die Frage beantwortet, warum sich in hiesiger Fallkonstellation ein Wertungswiderspruch offenbart und wie dieser aufzulösen ist. Diese Untersuchung will damit einen Beitrag dazu leisten, den Wertungswiderspruch rechtswissenschaftlich und rechtsmethodologisch einzuordnen und diesen für die Praxis erfassbar zu machen. Im Ergebnis führt das dazu, dass der Wertungswiderspruch aufgelöst werden kann.
2 In der Politik und der arabischen Presse wird anstatt „Islamischer Staat“ der Begriff „Daesh/Da’ish/Daesch“ verwendet, der ein Akronym von „Al-daula al-Islamija fi-l-Iraq wa-l-Scham” darstellt und der Bedeutung „Zwietracht säen“ ähnelt. Hintergrund davon ist eine Abwertung und eine Verweigerung der Anerkennung des selbst gewählten Namens und damit verbundenen Herrschaftsanspruch der Terrororganisation. Die Terrororganisation hatte sich selbst vor 2014 so benannt, die deutsche Übersetzung des Begriffs heißt „Islamischer Staat in Irak und der Levante (ISIL)“, dazu hier: Schulte von Drach, Warum der Name ”Daesch” den Islamischen Staat ärgert, SZ vom 23.11.2015.
3 BGH, NStZ-RR 2018, 221.
4 Siehe dazu Abschnitt A.I.3. dieser Untersuchung.
Details
- Seiten
- 252
- Erscheinungsjahr
- 2024
- ISBN (PDF)
- 9783631921852
- ISBN (ePUB)
- 9783631921869
- ISBN (Hardcover)
- 9783631921807
- DOI
- 10.3726/b22000
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2024 (Juli)
- Schlagworte
- Vereinsgesetz Juristisch-ökonomischer Vermögensbegriff Schutzwürdiges Vermögen IS-Fall des BGH Einheit der Rechtsordnung Vereinsverbot Vermögenseinziehung Verbotene Vereine als Betrugsopfer Wertungswiderspruch
- Erschienen
- Berlin, Bruxelles, Chennai, Lausanne, New York, Oxford, 2024., 252 S. s/w Abb., 0 Tab.,
- Produktsicherheit
- Peter Lang Group AG