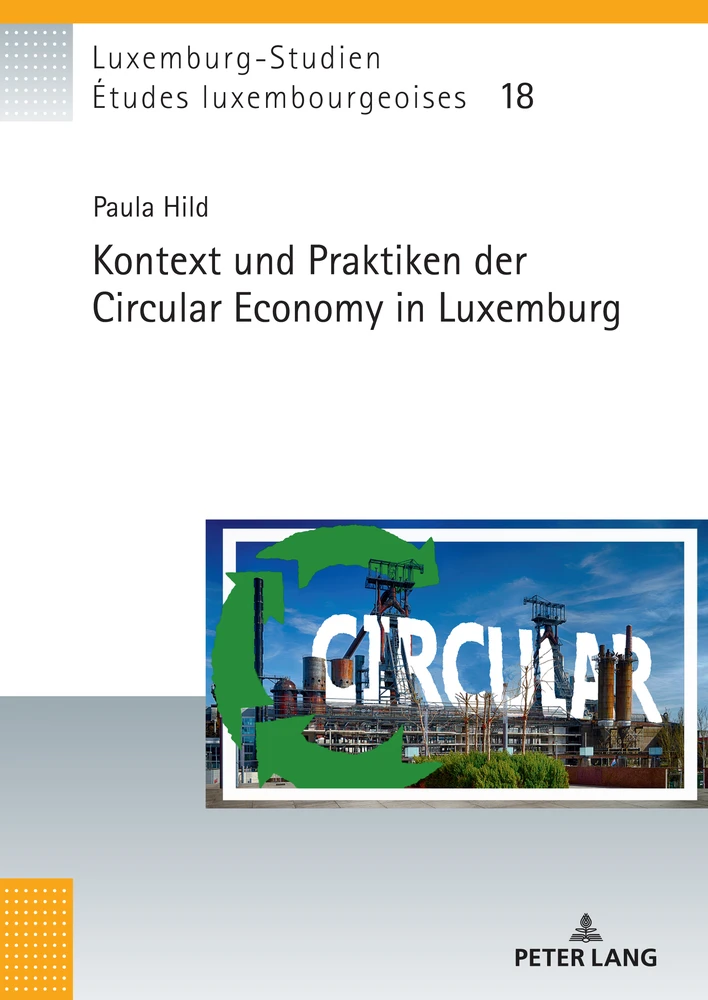Kontext und Praktiken der Circular Economy in Luxemburg
Summary
Excerpt
Table Of Contents
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Danksagung
- Inhaltsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1. Einführung in die Circular Economy und Praktikentheorien
- 1.1.1 Die Entstehung der Circular Economy als Untersuchungsgegenstand
- 1.1.2 Die Denkschulen der Praktikentheorien
- 1.2. Problemstellung und forschungsleitende Fragen
- 1.2.1 Problemstellung
- 1.2.2 Forschungsleitende Fragen
- 1.3. Rahmung und Aufbau der Arbeit
- 2. Theoretische Einbettung und sensibilisierende Konzepte
- 2.1. Circular Economy Forschung
- 2.1.1 Die systemisch-institutionelle Perspektive
- 2.1.2 Die technologische Perspektive
- 2.1.3 Die unternehmerische Perspektive
- 2.1.4 Die sozialwissenschaftliche Perspektive
- 2.1.5 Eine kritische Auseinandersetzung mit Circular Economy Forschungsansätzen
- 2.1.6 Die Circular Economy Forschungsperspektive dieser Arbeit
- 2.2. Praxistheoretische Forschung
- 2.2.1 Soziale Praktiken als Untersuchungsgegenstand: Konzeptualisierung einer Praktik
- 2.2.2 Praktikenforschung in der Wirtschaftsgeographie
- a. Die relationale Perspektive
- b. Die institutionelle Perspektive
- c. Transitionen und Wandelprozesse
- 2.2.3 Praktiken stabilisieren, verhandeln und verändern
- a. Kontinuität, Wiederholung und Gleichförmigkeit
- b. Institutionen als Moderatoren
- 2.2.4 Praktiken und Materialität
- 2.2.5 Alternative Praktiken in Unternehmen
- 2.2.6 Eine kritische Auseinandersetzung mit praxistheoretischer Forschung
- 2.2.7 Die Einbindung von Praxistheorien in dieser Arbeit
- 2.3. Synthetisierung des Forschungsansatzes
- 3. Das Forschungsdesign
- 3.1. Methodologische Grundlagen
- 3.2. Methodische Operationalisierung
- 3.2.1 Thematische Materialsammlung
- 3.2.2 Unstrukturierte Interviews
- a. Korpusbildung und Datensuffizienz
- b. Erhebung und Dokumentation
- c. Auswertung
- 3.2.3 Semi-strukturierte Interviews
- a. Korpusbildung
- b. Erhebung und Dokumentation
- c. Auswertung: Kodierschema und Expertenworkshop
- 3.3. Kritische Auseinandersetzung mit dem Forschungsdesign
- 3.3.1 Positionalität
- 3.3.2 Datenkorpus
- 3.3.3 Sprache
- 3.4. Synthetisierung des Forschungsdesigns
- 4. Die thematische Darstellung der Circular Economy in Luxemburg
- 4.1. Der RAHMEN der Circular Economy in Luxemburg
- 4.1.1 Der politische Rahmen für eine Circular Economy
- 4.1.2 Luxemburgs Circular Economy in Praxis und Forschung
- 4.2. Das Verständnis des Circular Economy-Konzepts
- 4.2.1 Das Konzept ist weitgehend bekannt
- 4.2.2 Das Konzept wird technisch ausgelegt
- 4.2.3 Das Konzept wird multidimensional verstanden
- 4.2.4 Zwischenfazit: Die Prioritäten der Circular Economy in Luxemburg
- 4.3. Der Umgang mit Materialien in einer Circular Economy
- 4.3.1 Abgrenzung zum Abfallbegriff
- 4.3.2 Vermeidung, Trennung, Weiternutzung
- a. Trennung
- b. Weiternutzung
- 4.3.3 Recycling und Sekundärrohstoffe
- a. Recyclingbeton
- b. Holz
- 4.3.4 Informationen, Materialherkunft und Rückverfolgbarkeit
- 4.3.5 Zwischenfazit: Materialien und die Circular Economy in Luxemburg
- 4.4. Design und Kooperation für eine Circular Economy
- 4.4.1 Planung und Design
- 4.4.2 Digitale Vernetzung
- 4.4.3 Plattformen des Austauschs
- 4.4.4 Zwischenfazit: Zusammenarbeit und die Circular Economy in Luxemburg
- 4.5. Trends und zukünftige Erwartungen an die Circular Economy
- 4.5.1 Die Skeptiker
- 4.5.2 Die Bereiche mit Potenzial
- 4.5.3 Die Überzeugten
- 4.5.4 Zwischenfazit: Die Zukunft der Circular Economy in Luxemburg
- 4.6. Circular Economy in der Praxis
- 4.6.1 Beweggründe und Anreize
- 4.6.2 Hemmnisse und Barrieren
- a. Fehlende Rahmenbedingungen
- b. Staat und Regierung
- 4.6.3 Zwischenfazit: Viele sind überzeugt, aber die praktische Umsetzung ist komplex
- 4.7. Synthese der Ergebnisdarstellung
- 5. Kontext der Circular Economy in Luxemburg
- 5.1. Ein unternehmerisch funktionaler Ansatz
- 5.1.1 Unternehmerische Perspektiven und Zielsetzungen
- 5.1.2 Die Rolle einzelner Personen
- 5.2. Ein institutioneller pfadabhängiger Ansatz
- 5.2.1 Technokratische Governance
- 5.2.2 Politikkohärente Pfadabhängigkeit
- 5.3. Eine öffentlich-private partnerschaftliche Umsetzung
- 5.3.1 Räumliche Cluster der Circular Economy
- 5.3.2 Das Circular Hotspot Wiltz Pilotprojekt
- 5.4. Zwischenfazit: Die Umsetzung der Circular Economy ist in einem frühen Stadium
- 6. Praktiken der Circular Economy in Luxemburg
- 6.1. Praktiken als Untersuchungsgegenstand
- 6.1.1 Praktiken, die das Phänomen der Circular Economy in Luxemburg strukturieren
- 6.1.2 Zooming in and out: Dimensionen der Circular Economy in Luxemburg
- 6.1.3 Zwischenfazit: Mehrwert durch die Untersuchung von Praktiken
- 6.2. Circular Economy-Praktiken stabilisieren, verhandeln und verändern
- 6.2.1 Kontinuität, Wiederholung und Gleichförmigkeit
- 6.2.2 Institutionen als Moderatoren
- 6.2.3 Praktiken und Materialität
- 6.2.4 Zwischenfazit: Veränderte Praktikendimensionen und Praktikenketten
- 6.3.Circular Economy-Praktiken aus einer gesellschaftlichen Perspektive: Zugang, Gleichberechtigung und Macht
- 6.4.Synthese: Circular Economy-Praktiken als Motor für Wandelprozesse
- 7. Zusammenfassende Diskussion und Ausblick
- 7.1. Beitrag zur wissenschaftlichen Debatte
- 7.2. Methodische Erkenntnisse aus der Fallstudie
- 7.3. Abschließende Überlegungen zu Luxemburgs Circular Economy
- 7.4. Ausblick und weiterführende Forschungsfragen
- Bibliographie
- Anhänge
- Reihenübersicht
1.Einleitung
Die Umweltpolitik in Europa verfolgt mittlerweile einen integrativen Ansatz. Es wird versucht, klima- und energiepolitische Zielsetzungen nicht isoliert, sondern in einem systemischen Ansatz mit sozialen und wirtschaftlichen Interessen, z. B. bei Fragen der Ressourcennutzung, zu betrachten. Der Aktionsplan der Europäischen Union (EU) für die Circular Economy (2015: 303) ist ein Beispiel für den politischen Willen, Lösungsansätze für „eine nachhaltige, CO2-arme, ressourceneffiziente und wettbewerbsfähige Wirtschaft“ (EC, 2015: 1) auszuarbeiten.
Das grundlegende Ziel der Circular Economy besteht darin, den Verbrauch natürlicher Ressourcen (z. B. fossiler Brennstoffe, Boden, Wasser und Mineralien) innerhalb eines Systems (z. B. einer nationalen Wirtschaft) durch eine optimierte Verwaltung der Energie- und Materialflüsse zu verringern. „Die zentrale Idee ist es, Materialkreisläufe zu schließen, den Materialeinsatz zu reduzieren und Produkte und Abfälle wiederzuverwenden oder zu recyceln, um eine höhere Lebensqualität durch verbesserte Ressourceneffizienz zu erreichen“ (Peters et al., 2007: 5943). In einer Circular Economy bleibt der Wert von Produkten, Materialien und Ressourcen so lange wie möglich erhalten, und Abfall wird erheblich reduziert oder sogar ganz vermieden (im Idealfall). Per Definition erfordert der Übergang zu einer Circular Economy radikale und signifikante Veränderungen in den Bereichen Design, Produktion, Vertrieb, Verbrauch und Nutzung, damit eine Behandlung von Produkten als Abfall überflüssig wird.
Wie ein politisches Leitmotiv von Unternehmen aufgenommen wird, hängt von den einzelnen Akteuren des betroffenen Wirtschaftsgefüges ab. Das in diesem Buch vorgestellte Forschungsvorhaben beschäftigte sich mit Unternehmen der Bau- und Automobilzulieferindustrie in Luxemburg und ihrem Umgang mit dem Leitmotiv der Circular Economy auf regionaler Ebene. Die Leitfrage, die sich wie ein roter Faden durch die Arbeit zieht ist dabei: Welche Motivationen und Barrieren können in Luxemburg festgestellt werden, wenn es um zirkuläre Praktiken geht? Für die Beantwortung dieses Hauptanliegens wurden sowohl Ansätze aus der praxistheoretischen Forschung als auch Perspektiven zu Konzepten der zirkulären Wertschöpfung herangezogen.
1.1.Einführung in die Circular Economy und Praktikentheorien
Die vorliegende Arbeit setzt sich mit Praktiken der Circular Economy am Beispiel der Bau- und Automobilzulieferindustrien in Luxemburg auseinander. Der Untersuchungsgegenstand der Circular Economy wird in einer praxeologischen Forschungsperspektive analysiert. Beide Forschungsfelder – soziale Praktiken und Circular Economy – verlangen nach einer Begriffserklärung, Abgrenzung und Konkretisierung im Hinblick auf forschungsrelevante Fragestellungen. Die zwei Literaturfelder werden deshalb im Hinblick auf ihre Entstehung und Rezeption eingeordnet. Diese Einführung schlägt eine Brücke zu der im Anschluss erörterten Problemstellung und den forschungsleitenden Fragen in Kapitel 1.2.
1.1.1Die Entstehung der Circular Economy als Untersuchungsgegenstand
Circular Economy-Forschung geht in ihrem theoretischen Ansatz auf verschiedene Denkschulen unterschiedlicher Disziplinen zurück, vor allem in den Natur- und Wirtschaftswissenschaften. Der Mathematiker und Wirtschaftswissenschaftler Georgescu-Roegen veröffentlichte in den 1970er Jahren ein Bestands-Fluss-Modell, das die biophysikalische Dimension von Wirtschaftsprozessen aufzeigt. Seiner Ansicht nach kann die Entwicklung des Wirtschaftssystems nicht von der Umwelt isoliert (betrachtet) werden (Georgescu-Roegen, 1971). Georgescu-Roegen führte die für die Circular Economy so entscheidende Unterscheidung von erneuerbaren und nicht-erneuerbaren Energie- und Materialflüssen ein. Land- und Wasserressourcen wurden damit zu einem kontinuierlichen Lieferanten von Energie (Wasser-, Wind- und Solarkraft, Biogas) und Biomasse (Nahrungsmittel, Tierfutter, Heizmaterial). Gleichzeitig schlug er vor, die menschliche Arbeit als einen erneuerbaren Energiestrom in Modellierungen von Wirtschaftsprozessen zu berücksichtigen.
Fast zeitgleich zur biophysikalischen Perspektive lieferten der Physiker Ayres und der Wirtschaftswissenschaftler Kneese ein ökonomisches Argument für die Untersuchung von Wechselwirkungen zwischen Wirtschaftsprozessen und der Umwelt (Ayres und Kneese, 1969). Wirtschaftliche Aktivitäten, vor allem in Industriestaaten, sind auf scheinbar frei verfügbare Ressourcen wie saubere Luft und Wasser angewiesen. Dieser Zustand führt zu einer unausgeglichenen Ressourcenallokation und erzeugt externe Effekte (Externalitäten).1 Ayres und Kneese betrachten Externalitäten im Wesentlichen als ein bilanzielles Ungleichgewicht: Das Gesetz der Massenerhaltung (Massenerhaltungssatz)2 sollte auch für Wirtschaftssysteme gelten. Ihr Ansatz knüpft damit an Überlegungen des Wirtschaftswissenschaftlers Boulding an, der 1966 für das Wirtschaftssystem die Raumschiffmetapher einführte (Boulding, 1980 [1966]) und als ein Vertreter der allgemeinen Systemtheorie gilt (z. B. von Bertalanffy, 1950; 1968). In einem geschlossenen System müsse man versuchen, mit möglichst wenig Durchfluss, also ohne Austausche mit der äußeren Umgebung, auszukommen. Dieser Grundgedanke wurde zu einem Eckpfeiler der Energie- und Stoffstromanalyse, die auch Anwendung in der industriellen Ökologie bzw. im industriellen Metabolismus findet (z. B. Ayres und Ayres, 1996) und einen Vorläufer von Lebenszyklusbetrachtungen darstellt. Die Umweltökonomen Pearce und Turner (1990) ordneten schließlich der natürlichen Umwelt explizit Funktionen zu, die ökonomische Relevanz für den Menschen haben. Vor allem Pearce setzte sich dafür ein, Umweltleistungen3 wie Wirtschaftsgüter zu betrachten und mit einem Preis zu versehen. Mittlerweile werden Umweltfunktionen, die oft ein öffentliches Gut darstellen (wie Luft- und Wasserqualität), zwar verstärkt von Politik und Wissenschaft diskutiert, in der Regel gibt es für sie jedoch weder einen Preis noch einen Markt, selbst wenn sie einen eindeutigen Wert oder Nutzen für Einzelpersonen und die Gesellschaften haben.
Dieser volkswirtschaftliche Ansatz, der die Beziehungen zwischen Wirtschaft und natürlicher Umwelt des Menschen betrachtet wird als Umweltökonomie bezeichnet. Erforscht werden z. B. die Auswirkungen des industriellen Wirtschaftens auf die Umwelt, um daraus Empfehlungen für eine ökonomische Umweltpolitik oder für umweltverträgliche Produktionsverfahren geben zu können. Oft wird in diesem Zusammenhang vom Ausgleich zwischen Ökonomie und Ökologie gesprochen. Im Gegensatz dazu befasst sich die ökologische Ökonomie mit der Fragestellung, wie menschliches Handeln innerhalb der Grenzen und Bedingungen von ökologischen Systemen gestaltet werden kann. Dabei wird eine ganzheitliche Perspektive eingenommen, um Wechselwirkungen zwischen Wirtschaft, Gesellschaft und Natur zu verstehen und nachhaltige Lösungswege zu entwickeln (Beckenbach, 1998).
Das heutige Verständnis des Konzepts der Circular Economy ist noch immer geprägt durch die beiden Perspektiven biophysikalischer und umweltökonomischer Denkschulen. Immer häufiger werden aber auch ökologisch- ökonomische Ansätze verfolgt, in denen die Wirtschaft und die Umwelt nicht mehr isoliert von der Gesellschaft, sondern mit ihr verwoben betrachtet werden. In neueren Publikationen wird die Circular Economy deshalb als ein Wirtschaftsmodell charakterisiert, das den Wohlerhalt der Umwelt und der Gesellschaft verfolgt (Murray et al., 2017: 377). Das ökologische Modernisierungskonzept (Mol, 1995) baut auch auf dem Gedanken der Circular Economy auf, verfolgt dabei aber einen wirtschaftlichen Ansatz. Es wird davon ausgegangen, dass eine nachhaltigkeitsorientierte Transformation der Wirtschaft auch eine gewisse Geschäftslogik verfolgen kann, z. B. Kostensenkung durch Ressourceneinsparungen. Der Politikwissenschaftler Christoff (1996) unterscheidet zwischen einer schwachen und einer starken Artikulation von ökologischer Modernisierung, wobei sich die erste lediglich auf technologische Korrekturen und Umweltmanagementinstrumente konzentriert, während letztere grundlegendere institutionelle Veränderungen und demokratische Partizipation umfasst (z. B. die Einbindung von Verbrauchern und zivilgesellschaftlichen Akteuren).
Details
- Pages
- 370
- Publication Year
- 2024
- ISBN (PDF)
- 9783631922828
- ISBN (ePUB)
- 9783631922835
- ISBN (Hardcover)
- 9783631922811
- DOI
- 10.3726/b22051
- Language
- German
- Publication date
- 2024 (December)
- Keywords
- Praktikentheorien Zirkularität nachhaltiges Wirtschaften Circular Economy Praktikenforschung
- Published
- Berlin, Bruxelles, Chennai, Lausanne, New York, Oxford, 2024. 370 S., 2 farb. Abb., 28 s/w Abb., 19 Tab.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG