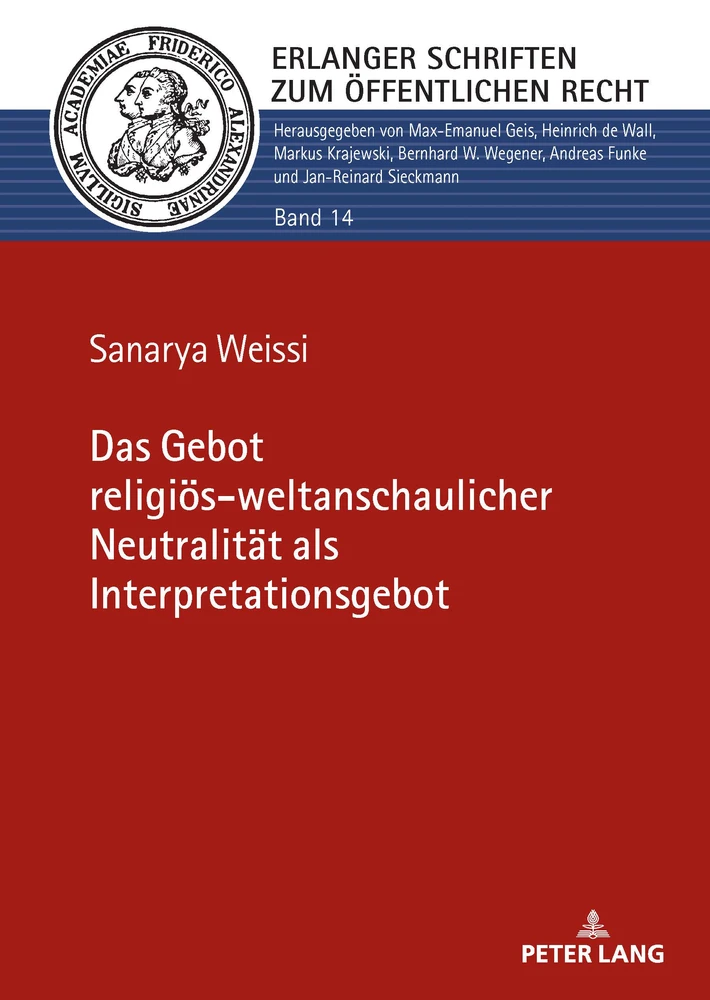Das Gebot religiös-weltanschaulicher Neutralität als Interpretationsgebot
Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Abdeckung
- Titelseite
- Copyright-Seite
- Hingabe
- Vorwort
- Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- A. Gegenstand der Arbeit und Problemstellung
- B. Religiös-weltanschauliche vs. ethische Neutralität
- C. Die religionsverfassungsrechtlichen Grundlagen
- D. Steigende Bedeutung des Neutralitätsgebotes und abnehmender Konsens
- E. Das Neutralitätsgebot als Interpretationsgebot
- F. Gang der Untersuchung
- Erster Teil: Begründung des Neutralitätsgebotes
- A. Ansätze in der Literatur
- I. Toleranzmodelle: Die Privilegierung des Christentums
- II. Abschied vom Neutralitätsgebot?
- III. Weitere Ansätze
- 1. Krüper: Neutralität als Verbot staatlicher Aneignung religiös-weltanschaulicher Gehalte
- 2. Volkmann: Leitbildorientierte Verfassungsanwendung
- IV. Huster: Neutralität als Begründungsneutralität
- 1. Zentrale Aussagen
- 2. Kritik
- 3. Dreier: Begründbarkeits- statt Begründungsneutralität
- V. Fazit
- B. Die zugrunde liegenden Vorschriften des Neutralitätsgebotes
- I. Art. 4 Abs. 1 GG Glaubens-, Gewissens- und Bekenntnisfreiheit
- II. Art. 3 Abs. 3 S. 1 GG Diskriminierungsverbot
- III. Art. 33 Abs. 3 GG Diskriminierungsverbot im Berufsbeamtentum
- IV. Art. 140 GG i. V. m. Art. 136 Abs. 1 und 4 und Art. 137 Abs. 1 WRV
- V. Inhalt des Neutralitätsgebots
- C. Das Neutralitätsgebot als Interpretationsgebot
- I. Methodik nach F. Müller/R. Christensen: Verfahren der Normkonkretisierung
- 1. Normprogramm und Normbereich
- 2. Prinzipien der Verfassungsinterpretation
- a. Einheit der Verfassung
- b. Maßstab funktioneller Richtigkeit
- c. Maßstab integrierender Wirkung
- d. Normative Kraft der Verfassung
- e. Praktische Konkordanz
- 3. Grenzen der Verfassungsinterpretation
- II. Erkenntnisse
- Zweiter Teil: Anwendungen und Lösungsansätze – Religiöse Symbole in öffentlichen Räumen
- A. Einführung in die Schulkreuzproblematik
- B. Meinungsstand in der Schulkreuzdiskussion
- I. Schutzbereich der Glaubensfreiheit
- II. Eingriffsqualität
- III. Das Kreuz als ausschließlich religiöses Symbol?
- IV. Rechtfertigungsebene
- 1. Befürworter der Entscheidung
- a. Ungeeignetheit der positiven Glaubensfreiheit als Kollisionsgut
- b. Zum Spannungsverhältnis zwischen Art. 4 GG und Art. 7 GG
- 2. Kritik an der Entscheidung
- a. Der staatliche Erziehungsauftrag als verfassungsimmanente Schranke
- b. Staatliche Neutralität als untauglicher Maßstab
- c. Keine Laizität des Grundgesetzes
- d. Kreuz als Symbol der Verfassungsidentität
- e. Dominanz der negativen Glaubensfreiheit
- C. Exkurs: Das Bayerische Erziehungs- und Unterrichtsgesetz
- I. Die Doppelbödigkeit des Art. 7 Abs. 4 BayEUG
- II. Vereinbarkeit mit den Vorgaben der Schulkreuzentscheidung?
- D. Die Rechtfertigung des Schulkreuzes
- I. Die Rechtfertigung aus der positiven Glaubensfreiheit
- 1. Positive Glaubensfreiheit als Kollisionsgut?
- a. Anspruchsargument
- b. Staatliche Anordnung
- 2. Die Aufspaltung in negative und positive Glaubensfreiheit
- a. Reiner Konfrontationsschutz
- b. Kein Ertrag aus der Gegenüberstellung
- 3. Zwischenergebnis
- II. Der staatliche Erziehungsauftrag als Rechtfertigungsgrund
- 1. Staatlicher Erziehungsauftrag auf Grundlage christlicher Werte?
- 2. Rechtsprechung zur christlichen Gemeinschaftsschule
- a. Inhalt der Entscheidung
- b. Zweigleisigkeit der Entscheidung
- 3. Rezeption in der Schulkreuzentscheidung
- 4. Zwischenergebnis
- 5. Das Verhältnis zwischen staatlichem Erziehungsauftrag und Elternrecht
- a. Eigener Erziehungsauftrag nach Art. 7 Abs. 1 GG
- b. Das elterliche Erziehungsrecht nach Art. 6 Abs. 2 GG
- c. Gleichordnung der Erziehungsaufträge
- d. Das Problem der Erziehung aus Neutralitätsperspektive
- III. Erziehungsziele in der Analyse
- 1. Keine explizite Regelung von Erziehungszielen im Grundgesetz
- 2. Erziehungsziele in den Landesverfassungen und ihre Bindungswirkung
- 3. Verfassungsmäßige Erziehungsziele
- a. Autonome Persönlichkeitsentfaltung, Art. 2 Abs. 1 i. V. m. Art. 1 Abs. 1 GG
- b. Verfassungsessenz, Art. 79 Abs. 3 GG
- c. Pädagogische Verfassungsinterpretation
- aa. Grundrechte als Erziehungsleitlinie
- bb. Das Menschenbild des Grundgesetzes als Erziehungsleitlinie
- d. Zwischenergebnis
- IV. Die Interpretation des staatlichen Erziehungsauftrages im Wege der Normkonkretisierung
- 1. Art. 7 Abs. 1 GG in der Normkonkretisierung
- a. Normprogramm
- aa. Grammatische Auslegung
- bb. Historische Auslegung
- cc. Genetische Auslegung
- dd. Systematische Auslegung
- b. Normbereichsanalyse
- aa. Ethikunterricht
- bb. Lebensgestaltung – Ethik – Religionskunde (LER)
- cc. Leitkultur und das Bayerische Integrationsgesetz
- dd. Zwischenergebnis
- c. Einheit der Verfassung
- d. Funktionelle Richtigkeit
- e. Grenzen der Interpretation
- 2. Erziehungszwecke: Persönlichkeitsentfaltung und Integration
- a. Eigenverantwortliche Lebensführung
- b. Bürgertugenden
- c. Gesetzestreue
- d. Moralerziehung
- e. Ehrfurcht vor Gott
- 3. Ergebnis
- 4. Verhältnis des Landesrechts zum Bundesrecht
- 5. Fazit und Abgrenzung
- V. Die Ungeeignetheit des Kreuzes als Mittel zur Darstellung zulässiger Erziehungsinhalte
- E. Das Kreuz im Gerichtssaal und in der Behörde
- I. Ungeeignetheit der positiven Glaubensfreiheit als Kollisionsgut
- II. Die Funktion des öffentlichen Raums als Differenzierungskriterium
- 1. Justiz
- 2. Behörde
- III. Die verschiedenen Kollisionsgüter als Differenzierungskriterien
- IV. Ergebnis: Das Kreuz in öffentlichen Räumen
- F. Das Kopftuch von Amtsträgerinnen
- I. Analyse der Kopftuch I- und Kopftuch II-Entscheidungen
- 1. Dogmatische Fragen der Glaubensfreiheit
- 2. Symbolgehalt des Kopftuchs und Deutungshoheit
- 3. Abstrakte oder konkrete Gefahr?
- 4. Erforderlichkeit einer Plenumsentscheidung?
- II. Analyse der Kopftuch III-Entscheidung
- 1. Erforderlichkeit einer gesetzlichen Grundlage
- 2. Materielle Rechtfertigungsmöglichkeiten für ein Kopftuchverbot
- a. Staatliche Selbstdarstellung und Neutralitätsgebot
- b. Unabhängigkeit der Justiz
- c. Anscheinsargument
- d. Negative Glaubensfreiheit der anderen Verfahrensbeteiligten
- 3. Gleichsetzung von Rechtsreferendarinnen mit Richterinnen und Staatsanwältinnen
- G. Die Rechtfertigung des Kopftuchverbots in Schule und Justiz
- I. In der öffentlichen Schule
- 1. Aus der negativen Glaubensfreiheit
- 2. Aus dem elterlichen Erziehungsrecht
- 3. Aus dem staatlichen Erziehungsauftrag
- II. In der Justiz
- 1. Aus der negativen Glaubensfreiheit
- 2. Aus der Sicherung des weltanschaulich-religiösen Friedens
- 3. Aus dem Grundsatz der religiös-weltanschaulichen Neutralität
- 4. Aus dem Gebot richterlicher Unparteilichkeit
- 5. Aus dem Grundsatz der Funktionsfähigkeit der Rechtspflege
- III. Zwischenergebnis
- IV. Die Interpretation des staatlichen Erziehungsauftrags und der Funktionsfähigkeit der Rechtspflege im Wege der Normkonkretisierung
- 1. Art. 7 Abs. 1 GG in der Normkonkretisierung
- a. Normprogramm
- b. Normbereichsanalyse
- aa. Spiegel der Gesellschaft und Einübung von Toleranz
- bb. Neutralitätsgebot und verschiedene öffentliche Räume
- c. Zwischenfazit
- 2. Das beamtenrechtliche Mäßigungsgebot als Schranke der Glaubensfreiheit?
- 3. Die Funktionsfähigkeit der Rechtspflege in der Normkonkretisierung
- a. Normprogramm
- b. Normbereichsanalyse
- aa. Gesellschaftliches Vertrauen in die Justiz, Art. 92 GG
- bb. Neutralitätsgebot und Dienstpflichten
- 4. Das beamtenrechtliche Mäßigungsgebot in Justiz und Schule im Vergleich
- a. In der Justiz
- b. Güterabwägung
- c. Vergleich zwischen Schule und Justiz
- d. Attraktivität der Anwendung des Mäßigungsgebots
- V. Erkenntnisse
- Dritter Teil: Die Dogmatik des Neutralitätsgebotes
- A. Das Neutralitätsgebot des Grundgesetzes als Interpretationsgebot
- I. Ziehung einer Bilanz
- II. Anwendungsbereich und Gemeinwohlbezug
- 1. Anwendungsbereich
- 2. Gemeinwohlbezug
- B. Das Neutralitätsgebot in der Grundrechtsprüfung
- I. Grundrechtsprüfung: Verletzung des Art. 4 GG durch staatlich verordnetes Aufhängen eines Kreuzes im Klassenzimmer
- 1. Schutzbereich
- 2. Eingriff
- 3. Rechtfertigung
- a. Legitimer Zweck
- b. Geeignetheit
- 4. Ergebnis
- II. Grundrechtsprüfung: Verletzung des Art. 4 GG durch staatlich verordnetes Anbringen eines Kreuzes im Gerichtssaal
- 1. Schutzbereich
- 2. Eingriff
- 3. Rechtfertigung
- a. Legitimer Zweck
- b. Geeignetheit
- 4. Ergebnis
- III. Grundrechtsprüfung: Verletzung des Art. 4 GG durch staatlich verordnetes Aufhängen eines Kreuzes in der Behörde
- 1. Schutzbereich
- 2. Eingriff
- 3. Rechtfertigung
- a. Vorbehalt des Gesetzes
- b. Legitimer Zweck
- c. Geeignetheit
- 4. Ergebnis
- IV. Grundrechtsprüfung: Verletzung des Art. 4 GG durch ein Kopftuchverbot für Lehrerinnen
- 1. Schutzbereich
- 2. Eingriff
- 3. Rechtfertigung
- a. Staatlicher Erziehungsauftrag
- b. Mäßigung im Dienst
- c. Güterabwägung
- 4. Ergebnis
- V. Grundrechtsprüfung: Verletzung des Art. 4 GG durch ein Kopftuchverbot für Richterinnen und Staatsanwältinnen?
- 1. Schutzbereich
- 2. Eingriff
- 3. Rechtfertigung
- a. Funktionsfähigkeit der Rechtspflege
- b. Mäßigung im Dienst
- c. Güterabwägung
- 4. Ergebnis
- VI. Erkenntnisse
- 1. Kriterien für die Zulässigkeit religiösen Verhaltens in öffentlichen Räumen
- 2. Freiheitserweiternde Wirkungen
- 3. Personalität vs. Apersonalität
- 4. Der öffentliche Raum und seine Funktion als Differenzierungskriterium
- 5. Steuerungsfunktion und Widerspruchsfreiheit
- 6. Gemeinwohlkonkretisierungen
- C. Dogmatische Verortung des Neutralitätsgebotes
- I. Normstruktur des Neutralitätsgebotes
- 1. (Un-)Selbstständiges Gebot?
- 2. Prinzip oder Regel?
- 3. Funktion des Neutralitätsgebotes
- 4. Objektives Gebot oder subjektives Recht?
- 5. Vergleich mit den Interpretationsprinzipien der verfassungskonformen Auslegung und der Einheit der Verfassung
- a. Verfassungskonforme Auslegung
- b. Einheit der Verfassung
- c. Gemeinsamkeiten und Unterschiede
- aa. Anwendungsebenen
- bb. Inhalt und Rechtsnormqualität
- cc. Selbstständigkeit
- dd. Funktionellrechtliche Bedeutung
- ee. Rückwirkung
- ff. Verhältnis zu herkömmlichen Auslegungsregeln
- gg. Keine Prinzipieneigenschaft
- hh. Objektivrechtlicher oder subjektivrechtlicher Charakter?
- d. Schlussfolgerungen
- II. Verhältnis zu verwandten Rechtsinstituten
- 1. Toleranz
- 2. Parität
- 3. Abgrenzung
- Schlussüberlegungen
- Leitgedanken
- Literatur
Das Gebot religiös-weltanschaulicher Neutralität als Interpretationsgebot

Berlin · Bruxelles · Chennai · Lausanne · New York · Oxford
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Zugl.: Erlangen-Nürnberg, Univ., Diss., 2023
D 29
ISSN 2192-8460
ISBN 978-3-631-92693-2 (Print)
E-ISBN 978-3-631-92694-9 (E-PDF)
E-ISBN 978-3-631-92695-6 (EPUB)
DOI 10.3726/b22357
© 2025 Peter Lang Group AG, Lausanne (Schweiz)
Verlegt durch Peter Lang GmbH, Berlin (Deutschland)
Alle Rechte vorbehalten.
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Diese Publikation wurde begutachtet.
Für Daya und Baba
Vorwort
Die vorliegende Arbeit wurde im Sommersemester 2023 von der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg als Dissertation angenommen. Rechtsprechung und Literatur konnten bis Oktober 2024 berücksichtigt werden.
Meinem Doktorvater Prof. Dr. Andreas Funke danke ich für die Erstellung des Erstgutachtens und die sehr gute Betreuung. Es war eine lehrreiche Zeit. Prof. Dr. Heinrich de Wall danke ich für die zügige Erstellung des Zweitgutachtens.
Auf diesem Weg wurde ich von Familie und Freunden begleitet. Besonderer Dank gebührt meinen Eltern Sirwa und Rozgar für die liebevolle Unterstützung von Anfang an. Ohne sie wäre diese Arbeit nicht möglich gewesen. Ihnen die Arbeit zu widmen, ist mir deshalb ein Herzensanliegen. Mein Ehemann Manuel hielt mir stets den Rücken frei und hatte ein offenes Ohr für meine Gedanken und Ideen. Meinen Geschwistern Bawan und Tschawan und meinem Onkel Shalau bin ich für die motivierenden Gespräche sehr dankbar. Schließlich möchte ich meiner guten Freundin Marion danken, die für manch wichtigen Perspektivenwechsel sorgte.
München, im Oktober 2024
Sanarya Weissi
Inhaltsverzeichnis
A. Gegenstand der Arbeit und Problemstellung
B. Religiös-weltanschauliche vs. ethische Neutralität
C. Die religionsverfassungsrechtlichen Grundlagen
D. Steigende Bedeutung des Neutralitätsgebotes und abnehmender Konsens
E. Das Neutralitätsgebot als Interpretationsgebot
Erster Teil: Begründung des Neutralitätsgebotes
I. Toleranzmodelle: Die Privilegierung des Christentums
II. Abschied vom Neutralitätsgebot?
1. Krüper: Neutralität als Verbot staatlicher Aneignung religiös-weltanschaulicher Gehalte
2. Volkmann: Leitbildorientierte Verfassungsanwendung
IV. Huster: Neutralität als Begründungsneutralität
3. Dreier: Begründbarkeits- statt Begründungsneutralität
B. Die zugrunde liegenden Vorschriften des Neutralitätsgebotes
I. Art. 4 Abs. 1 GG Glaubens-, Gewissens- und Bekenntnisfreiheit
II. Art. 3 Abs. 3 S. 1 GG Diskriminierungsverbot
III. Art. 33 Abs. 3 GG Diskriminierungsverbot im Berufsbeamtentum
IV. Art. 140 GG i. V. m. Art. 136 Abs. 1 und 4 und Art. 137 Abs. 1 WRV
V. Inhalt des Neutralitätsgebots
C. Das Neutralitätsgebot als Interpretationsgebot
I. Methodik nach F. Müller/R. Christensen: Verfahren der Normkonkretisierung
1. Normprogramm und Normbereich
2. Prinzipien der Verfassungsinterpretation
b. Maßstab funktioneller Richtigkeit
c. Maßstab integrierender Wirkung
d. Normative Kraft der Verfassung
3. Grenzen der Verfassungsinterpretation
Zweiter Teil: Anwendungen und Lösungsansätze – Religiöse Symbole in öffentlichen Räumen
A. Einführung in die Schulkreuzproblematik
B. Meinungsstand in der Schulkreuzdiskussion
I. Schutzbereich der Glaubensfreiheit
III. Das Kreuz als ausschließlich religiöses Symbol?
1. Befürworter der Entscheidung
a. Ungeeignetheit der positiven Glaubensfreiheit als Kollisionsgut
b. Zum Spannungsverhältnis zwischen Art. 4 GG und Art. 7 GG
a. Der staatliche Erziehungsauftrag als verfassungsimmanente Schranke
b. Staatliche Neutralität als untauglicher Maßstab
c. Keine Laizität des Grundgesetzes
d. Kreuz als Symbol der Verfassungsidentität
e. Dominanz der negativen Glaubensfreiheit
C. Exkurs: Das Bayerische Erziehungs- und Unterrichtsgesetz
I. Die Doppelbödigkeit des Art. 7 Abs. 4 BayEUG
II. Vereinbarkeit mit den Vorgaben der Schulkreuzentscheidung?
D. Die Rechtfertigung des Schulkreuzes
I. Die Rechtfertigung aus der positiven Glaubensfreiheit
1. Positive Glaubensfreiheit als Kollisionsgut?
2. Die Aufspaltung in negative und positive Glaubensfreiheit
a. Reiner Konfrontationsschutz
b. Kein Ertrag aus der Gegenüberstellung
II. Der staatliche Erziehungsauftrag als Rechtfertigungsgrund
1. Staatlicher Erziehungsauftrag auf Grundlage christlicher Werte?
2. Rechtsprechung zur christlichen Gemeinschaftsschule
b. Zweigleisigkeit der Entscheidung
3. Rezeption in der Schulkreuzentscheidung
5. Das Verhältnis zwischen staatlichem Erziehungsauftrag und Elternrecht
a. Eigener Erziehungsauftrag nach Art. 7 Abs. 1 GG
b. Das elterliche Erziehungsrecht nach Art. 6 Abs. 2 GG
c. Gleichordnung der Erziehungsaufträge
d. Das Problem der Erziehung aus Neutralitätsperspektive
III. Erziehungsziele in der Analyse
1. Keine explizite Regelung von Erziehungszielen im Grundgesetz
2. Erziehungsziele in den Landesverfassungen und ihre Bindungswirkung
3. Verfassungsmäßige Erziehungsziele
a. Autonome Persönlichkeitsentfaltung, Art. 2 Abs. 1 i. V. m. Art. 1 Abs. 1 GG
b. Verfassungsessenz, Art. 79 Abs. 3 GG
c. Pädagogische Verfassungsinterpretation
aa. Grundrechte als Erziehungsleitlinie
bb. Das Menschenbild des Grundgesetzes als Erziehungsleitlinie
IV. Die Interpretation des staatlichen Erziehungsauftrages im Wege der Normkonkretisierung
1. Art. 7 Abs. 1 GG in der Normkonkretisierung
bb. Lebensgestaltung – Ethik – Religionskunde (LER)
cc. Leitkultur und das Bayerische Integrationsgesetz
2. Erziehungszwecke: Persönlichkeitsentfaltung und Integration
a. Eigenverantwortliche Lebensführung
4. Verhältnis des Landesrechts zum Bundesrecht
V. Die Ungeeignetheit des Kreuzes als Mittel zur Darstellung zulässiger Erziehungsinhalte
E. Das Kreuz im Gerichtssaal und in der Behörde
I. Ungeeignetheit der positiven Glaubensfreiheit als Kollisionsgut
II. Die Funktion des öffentlichen Raums als Differenzierungskriterium
Details
- Seiten
- 304
- Erscheinungsjahr
- 2025
- ISBN (PDF)
- 9783631926949
- ISBN (ePUB)
- 9783631926956
- ISBN (Hardcover)
- 9783631926932
- DOI
- 10.3726/b22357
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2025 (April)
- Schlagworte
- Kreuz Kopftuch Richterin Lehrerin Beamtenverhältnis Amtsträger Staatsdienst Gleichheit Glaubensfreiheit Grundrechte religiös-weltanschauliche Neutralität Verfassungstheorie Verfassungsinterpretation Verfassungsrecht Normstruktur Grundrechtsdogmatik Dogmatik Behörde Gerichtssaal Schule öffentliche Räume Kruzifix
- Erschienen
- Berlin, Bruxelles, Chennai, Lausanne, New York, Oxford, 2025. 304 S.
- Produktsicherheit
- Peter Lang Group AG