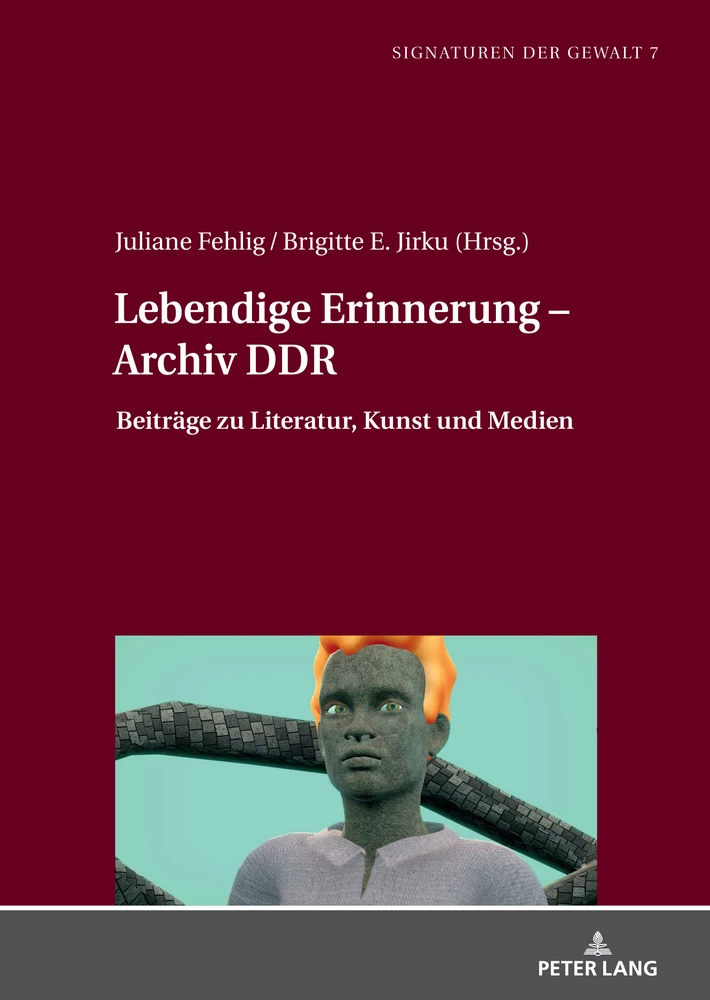Lebendige Erinnerung – Archiv DDR
Beiträge zu Literatur, Kunst und Medien
Summary
Excerpt
Table Of Contents
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Inhaltsverzeichnis
- Archiv und Gegenarchiv: Zukünftige Erinnerung (Juliane Fehlig / Brigitte E. Jirku)
- Das Archiv als Zeuge von (Staats-)Gewalt
- Das Überdauern der Erinnerung. Zur Bedeutung von Spuren der Nationalen Mahn- und Gedenkstätte Buchenwald für die heutigen Erzählungen im Raum (Alexandra Klei)
- Einblicke in ein „unheimliches Erbe“? – Die Stasi-Akten als Herausforderung und Chance im Erinnerungsdiskurs über die DDR (Nadja Häckel)
- „[D]er Wald ist eben einmal abgeholzt worden“. Anna Seghers als Präsidentin des DDR-Schriftstellerverbandes im Lichte ihrer Stasiakte (Loreto Vilar)
- Gegen-Geschichten und Gegen-Gedächtnis im Archiv unterdrückter Literatur in der DDR (Anja Rothenburg)
- Gegenarchiv Alltagsleben
- Open Memory Box, das DDR-Schmalfilm-„Anti-Archiv“: Erinnern und Einheit im Zeitalter des Vergessens und des Verfälschens (Laurence McFalls)
- Tradierung und Aneignung des ,DDR-Gedächtnisses‘ im postdigitalen Zeitalter – Die „Open Memory Box“ als alternatives Archiv (Johanna Vollmeyer)
- Ich sehe was, das du nicht siehst – Bilder vom Erwachsenwerden in zwei politischen Systemen (Kerstin Lorenz)
- Die Archive des Heiner Müller. Von Dialogen, Spuren und Begegnungen (Kristin Schulz)
- Literatur als Archiv
- Comics als (zweifelhaftes) DDR-Archiv (Sonja E. Klocke)
- Kontaminierte (Seelen)Landschaften: Auf der Spur der Vermissten in Lutz Seilers Kruso (Ana Giménez Calpe)
- Narrative Archivierungsversuche von Jenny Erpenbeck und Judith Schalansky zum Palast der Republik (Juliane Fehlig)
- Film und Kunst: Archiv der Gefühle
- Verknüpfte Erinnerungen in Der lachende Mann (1966): Nationalsozialismus und Entkolonialisierung in der DDR (Juanjo Monsell)
- Archive der Gefühle in Verriegelte Zeit (1990) (Brigitte E. Jirku)
- Mögliche Archive. Begegnung mit einem Überwachungsfoto in Karl Marx City (2016) (Anke Pinkert)
- wabe[]ost: Zeitzeug:innen und Erb:innen der DDR als Digital-Media-Installation. Ein Gespräch mit der Künstlerin Caroline Creutzburg (Caroline Creutzburg / Juliane Fehlig)
- „Formen der Dissidenz: der Körper als Archiv“. Ein Interview mit der Künstlerin Elske Rosenfeld (Elske Rosenfeld)
- Autor:innen
- Reihenübersicht
Juliane Fehlig / Brigitte E. Jirku (Hrsg.)
Lebendige Erinnerung – Archiv DDRBeiträge zu Literatur, Kunst und Medien
 Berlin - Bruxelles - Chennai - Lausanne - New York - Oxford
Berlin - Bruxelles - Chennai - Lausanne - New York - Oxford
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Der vorliegende Band wurde durch die Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport der Generalitat Valenciana
(AICO 2018/136) gefördert.
Umschlagabbildung:
wabe[]ost,
Caroline Creutzburg
ISSN 2566-946X
ISBN 978-3-631-81097-2 (Print)
E-ISBN 978-3-631-92846-2 (E-PDF)
E-ISBN 978-3-631-92847-9 (EPUB)
DOI 10.3726/b22498
© 2025 Peter Lang Group AG, Lausanne
Verlegt durch: Peter Lang GmbH, Berlin, Deutschland
info@peterlang.com - http://www.peterlang.com/
Alle Rechte vorbehalten.
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Autorenangaben
Juliane Fehlig studierte Germanistik und Spanische Philologie an der Universität Potsdam und war an der Universität Granada und der Universität Valencia als DAAD-Lektorin tätig. Ihre Forschungsinteressen liegen u.a. im Bereich der Post-DDR-Literatur. Derzeit promoviert sie zur Generation der (Nach-)Wendekinder in der Literatur.
Brigitte E. Jirku ist Professorin für Germanistik an der Universität Valencia. Zu ihren Forschungsschwerpunkten gehören u.a. Literatur von Frauen im 20./21. Jahrhundert, Gender und (Post-)Memory Studies sowie Inter- und Transkulturalität, Gewalt und Grenzerfahrungen in der deutschsprachigen Literatur.
Über das Buch
Mehr als drei Jahrzehnte nach dem Fall der Berliner Mauer und der deutschen Einheit lebt die DDR weiter – nicht nur in der (lebendigen) Erinnerung von Zeitzeug:innen und Erb:innen, sondern auch in vielfältigen kulturhistorischen, künstlerischen, literarischen und medialen Produktionen und Erinnerungsdiskursen, die nicht selten auf Archive und Gegenarchive zurückgehen. Dieser Band enthält zum einen Beiträge, die sich mit dem klassischen Archiv als Zeuge von (Staats-)Gewalt befassen, zum anderen steht das Alltagsleben in der DDR als Gegenarchiv im Mittelpunkt der Analysen. Besprochen werden mediale und digitale Archivformen, die den Blick erweitern, sowie literarische und mediale Produktionen, die durch verschiedene Identitätserzählungen und -entwürfe die offiziellen Erinnerungsdiskurse prägen oder sich ihnen entgegenstellen. So entsteht ein heterogenes Bild von dem, was von der DDR in unterschiedlichen Medien und Generationen erinnert wird.
Zitierfähigkeit des eBooks
Diese Ausgabe des eBooks ist zitierfähig. Dazu wurden der Beginn und das Ende einer Seite gekennzeichnet. Sollte eine neue Seite genau in einem Wort beginnen, erfolgt diese Kennzeichnung auch exakt an dieser Stelle, so dass ein Wort durch diese Darstellung getrennt sein kann.
Juliane Fehlig / Brigitte E. Jirku (Universitat de València)
Archiv und Gegenarchiv: Zukünftige Erinnerung
Abstract: Based on the definitions of Michel Foucault and Jacques Derrida, this study presents an introduction to the discussion of archive and counterarchive in regard to the ‘reunification’ of Germany. The process has sparked numerous narratives of memory, furthered by traditional archives and, above all, by the creation of counter-archives in literature, art and the media.
2024 gedenkt Deutschland zum 75. Mal der Gründung der beiden deutschen Staaten sowie zum 35. Mal der Friedlichen Revolution und dem Fall der Berliner Mauer. Zu diesem Anlass hat die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur eine Ausstellung mit dem Titel „Aufarbeitung. Die DDR in der Erinnerungskultur“ konzipiert, in der u.a. auf die Tatsache verwiesen wird, dass die Aufarbeitung bis heute nicht abgeschlossen sei und dass sich nur langsam ein Bewusstsein dafür entwickelt, dass die vierzig Jahre Teilung alle in Deutschland lebenden Menschen betrifft. Die Ausstellung versucht, ein mehrdimensionales Bild der Erinnerungskultur zu vermitteln, das nicht nur ausschließlich an Unterdrückung und Widerstand in der SED-Diktatur erinnert, sondern auch den DDR-Alltag sowie die Transformationserfahrungen vieler ehemaliger DDR-Bürger:innen nach 1989 thematisiert.1
Dies war im öffentlichen Gedenken an die DDR und die Friedliche Revolution nicht immer der Fall. In den 1990er Jahren dominierte das sogenannte ‚Diktaturgedächtnis‘2 den öffentlichen Erinnerungsdiskurs. Gedenkstätten für die Opfer der SED-Diktatur wurden in ehemaligen Haftanstalten errichtet, staatliche Einrichtungen und zivilgesellschaftliche Institutionen wurden gegründet, um vierzig Jahre Unrechtsstaat aufzuarbeiten. Staatsarchive und geheime Akten des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) wurden geöffnet, nachdem sie nach dem Mauerfall durch Bürgerrechtler:innen vor der Vernichtung gerettet wurden. Das daraus entstandene Stasi-Unterlagen-Archiv zählt bis heute zu den bekanntesten und wichtigsten offiziellen DDR-Archiven. Zunächst in den 1990er Jahren von Joachim Gauck – dem späteren Bundespräsidenten – geleitet, folgten 2000 Marianne Birthler und 2011 Roland Jahn als Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen (BStU). Unter ihrer Leitung hat das Archiv sukzessiv die Verfügung der Unterlagen sowie ihre Einsehbarkeit, auch für ein breiteres Publikum mit den medialen Mitteln des 21. Jahrhunderts verbessert.3 Im Jahr 2021 wurden die Akten schließlich ins Bundesarchiv überführt, wo man heute im Berliner Zentralarchiv bzw. in einer der Außenstellen Akteneinsicht beantragen kann. Es existieren jedoch noch diverse weitere offizielle Archive mit DDR-Bezug, darunter Bild-, Medien- und Themenarchive wie u.a. das Stiftungsarchiv der Bundesstiftung Aufarbeitung, das Archiv der DDR-Opposition der Robert-Havemann-Gesellschaft, das Archiv Bürgerbewegung Leipzig, das Archiv unterdrückter Literatur in der DDR und diverse zeitgeschichtliche Landes-, Stiftungs-, Zeitungs- und Hochschularchive. Viele dieser Archive wurden ab den 1990er Jahren als Gegenarchive zur offiziellen Erinnerungspolitik konzipiert und gegründet. Die meisten von ihnen sind nunmehr auf der Webseite der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED- Diktatur als Teil der offiziellen Erinnerungspolitik erfasst.4
Der Historiker Ilko-Sascha Kowalczuk mahnt an, dass trotz der Existenz vielfältiger Archivgüter die Erinnerungsarbeit jahrelang auf eine öffentlich wirksame Beschäftigung mit den Stasi-Akten reduziert worden sei, weshalb andere Aspekte der DDR-Geschichte unberücksichtigt geblieben seien: „Die Wiederaneignung der Geschichte erfolgte weithin anhand staatlicher Akten, denen dadurch oftmals eine geradezu groteske Interpretationsmacht über die eigene wie die kollektive und gesellschaftliche Geschichte zugesprochen wurde.“5 Außerdem führte der radikale Elitentransfer, der Anfang der 1990er Jahre von den alten in die neuen Bundesländer stattfand und die Deutsche Einheit auf institutioneller Ebene rechtskräftig garantierte, dazu, dass zur DDR-Geschichte anfänglich hauptsächlich aus der Perspektive westdeutscher Historiker:innen an den Universitäten geforscht wurde. „Es kam zu dem absurden Umstand, dass fast ausnahmslos Kultureliten mit einer gänzlich anderen Sozialisation einer ganzen Gesellschaft deren eigenes Gewordensein zu erklären suchten“6, was zu einer „Schieflage“ führte, „die erhebliches Unruhepotenzial im Osten erzeugte“7. Dieses Unruhepotential ist bis heute präsent, was an immer wiederkehrenden Debatten über die Deutungshoheit von DDR- und Transformationsgeschichte erkennbar ist. Streitschriften wie Dirk Oschmanns Der Osten: eine westdeutsche Erfindung (2023) und Katja Hoyers Diesseits der Mauer. Eine neue Geschichte der DDR (2023), die beide in den ostdeutschen Bundesländern zu Bestsellern zählen, beleben erneut diese Debatten und regen zu weiteren Gegen-Diskursen an.
Parallel zu den staatlichen Archiven, Ausstellungen und Gedenkstätten, die zu Recht an die Gräueltaten und die Opposition im SED-Unrechtsstaat erinnern, wurden bereits in den 1990er Jahren durch verschiedene Vereine kleinere privatwirtschaftliche DDR-Museen gegründet, die das Alltagsleben in der DDR anhand von Sammlerobjekten ausstellten. 2006 entstand schließlich das erste größere DDR-Museum in Berlin, das sich unter seinem wissenschaftlichen Leiter Stefan Wolle bis heute der Darstellung der DDR-Alltagskultur verschrieben hat. Persönliche Erinnerungen ehemaliger DDR-Bürger:innen an ihren sozialistischen Alltag sollen hier an symbolträchtige Gegenstände geknüpft oder durch diese repräsentiert werden, die zusammen mit der DDR untergegangen sind. Die Historikerin Annette Leo schreibt, es seien
[g]enau die Dinge, die Ostdeutsche zu Beginn der neunziger Jahre so schnell wie möglich loswerden wollten und die sie nun gern im Museum betrachten – nicht weil sie die Vergangenheit zurück haben wollen, sondern weil sie trotzig darauf beharren, dass es außer der Stasi und den Zuchthäusern, der Zensur und der Propaganda noch etwas anderes gab, an das sie sich erinnern, wenn sie an die DDR denken.8
Persönliche Erinnerungen jenseits des ‚Diktaturgedächtnisses‘ – jenseits von Täter:innen und Opfern – wurden häufig unreflektiert und einseitig entweder als ‚Ostalgie‘ oder als Verharmlosung der Diktatur dargestellt. Jedoch sind beide Perspektiven – die auf das Unrecht und die auf den Alltag in der Diktatur – wichtig für eine offene und heterogene DDR-Erinnerungskultur, die zu Debatten anregt und Widersprüche sichtbar und erzählbar macht.9
Nach über dreißig Jahren ‚Wiedervereinigung‘ stellen sich neue Fragen, auch von einer Generation der Nachgeborenen, die entweder noch ihre erste Sozialisation in der DDR erlebt hatten oder erst danach geboren wurden, aber deren Eltern, Lehrer:innen und andere Bezugspersonen aus dem näheren Umfeld noch in der DDR sozialisiert worden waren. Die Frage nach den Ursprüngen von Erinnerung stellte sich, besonders anlässlich des dreißigjährigen Jubiläums im Jahre 2019, mit neuer Dringlichkeit. Welche Fragen stellen die Nachgeborenen der Vergangenheit, welchem Narrativ schenken sie Glauben, welches Narrativ ist ihrer Herkunft geeignet? In den Bänden ging es der dritten Generation bzw. den Nachgeborenen weniger um die Aufarbeitung der DDR- Diktatur, sondern vielmehr um die Diskurse, wie das Leben in der DDR ‚wirklich‘ war und wie diese Diskurse ihre Identität bestimmen,10 denn westdeutsche und westliche Sprechweisen dominierten nach der ‚Wiedervereinigung‘ nicht nur in den gesamtdeutschen Mainstream-Öffentlichkeiten, sondern auch in feministischen, queeren, postmigrantischen und linken Kreisen. Um dem entgegenzutreten, kann das Gespräch zwischen Jana Hensel und Naika Foroutan in Die Gesellschaft der Anderen (2020) gelesen werden. Aus der Doppelperspektive der (Post-)Migrant:in und Ostdeutschen treiben sie das Bestreben voran, in einem politisch, aber keineswegs kulturell oder gesellschaftlich vereinten Deutschland Fragen nach Gesellschaft und Identität in eine breitere Diskussion einzubetten, die Erfahrungen und Prägungen von Randgruppen kennen und verstehen zu lernen und so zum Verständnis einer pluralen deutschen Gesellschaft beizutragen.11
Im Laufe der letzten drei Jahrzehnte haben sich daher verschiedene DDR-Gedächtnis- und Erinnerungsdiskurse herausgebildet, die die jeweilige gesellschaftspolitische Lage spiegeln. Die verschiedenen Etappen einer lebendigen Erinnerungskultur werden (noch) durch Jubiläen markiert und in verschiedenen Arten von Archiven und Gegenarchiven festgehalten. Kunst, Medien und Literatur tragen aktiv und kreativ in unterschiedlichen Formen von Archiven zu den erinnerungspolitischen Entwicklungen der DDR-Geschichte der letzten Jahrzehnte bei, formen sie oder werden von ihnen geformt.
Archiv: Der Blick ins Archiv hilft gegen das Vergessen
Ohne Archive gibt es keine Erinnerung. Das Narrativ des Mauerfalls und der ‚Wiedervereinigung‘ schien viele zunächst auszuschließen. Archive können erste, entscheidende Anhaltspunkte bieten. So schreibt Peter Haber: „Das Archiv wird zum Archiv durch die Ordnung des Wissens“12, und er lenkt die Aufmerksamkeit auf die Kriterien und die Gegenwart, die entscheiden, was in der Zukunft aufbewahrt werden soll. Essentiell ist somit der Zeitpunkt des Entstehens des Archivs und der Kräfte dahinter. Haber beruft sich hierbei auf Michel Foucault, der Archive als „System der Diskursivität und [der] Aussagemöglichkeiten und -unmöglichkeiten“13 verstand, das historisches Wissen formt und autorisiert sowie es ermöglicht, es nach seinen Gründen zu befragen. Über Fragen der materiellen Praxis hinaus befasst sich Foucaults Theorie der Archive zunächst mit ihrer epistemologischen Macht, Wissen zu produzieren und zu kanonisieren. Das Archiv ermöglicht es jedoch auch, sich Fragen des kulturellen Gedächtnisses und historischer Narrative durch die Ränder, blinden Flecken oder Lücken der archivarischen Formationen zu nähern und ‚Gegenarchive‘ zu bilden.
Foucault sieht das Archiv als Formationsregel des Diskurses und daher als Inhaber der Macht. Er definiert das Archiv als
das Gesetz dessen, was gesagt werden kann, das System, das das Erscheinen der Aussagen als einzelne Ereignisse beherrscht. Aber das Archiv ist auch das, was bewirkt, daß all diese gesagten Dinge sich nicht bis ins Unendliche in einer amorphen Vielzahl anhäufen, sich auch nicht in eine bruchlose Linearität einschreiben und nicht allein schon bei zufälligen äußeren Umständen verschwinden; sondern daß sie sich in distinkten Figuren anordnen, sich aufgrund vielfältiger Beziehungen miteinander verbinden, gemäß spezifischen Regelmäßigkeiten sich behaupten oder verfließen.14
Es geht Foucault weniger um das Archiv als Ort des Bewahrens, sondern vielmehr als Wissens- und Informationsspeicher, „das allgemeine System der Formation und der Transformation von Aussagen.“15 Es interessieren ihn die diskursiven Normen.
Denn der Diskurs – die Psychoanalyse hat es uns gezeigt – ist nicht einfach das, was das Begehren offenbart (oder vergibt): er ist auch Gegenstand des Begehrens; und der Diskurs – dies lehrt uns immer wieder die Geschichte – ist auch nicht bloß das, was die Kämpfe oder die Systeme der Beherrschung in Sprache übersetzt: er ist dasjenige, worum und womit man kämpft; er ist die Macht, deren man sich zu bemächtigen sucht.16
Wer das Archiv kontrolliert, sitzt an der Macht. Archive (ἀρχή als „Regierung“ oder „Ursprung, erster Ort“) bilden sowohl einen Ort als auch einen konzeptionellen Rahmen für die Ordnung von Material, also von Aufzeichnungen aus der Vergangenheit. Sie reichen von historischen, institutionellen und nationalen bis hin zu persönlichen, familiären oder kommunalen Sammlungen. Das Archiv war ein zentraler Teil des imperialen Staates im späten 19. Jahrhundert, ein Speicher kodifizierter Anschauungen, die die Verbindungen zwischen Geheimhaltung, Gesetz und Macht bündelten und bezeugten. Das geschriebene Dokument als einzige Quelle der Realität und Wahrheit, wie es sich im 19. Jahrhundert etabliert hatte, wird im Laufe des 20. Jahrhunderts immer mehr hinterfragt. In zunehmendem Maße wird deutlich, dass es noch weitere Dokumente gibt, meist medialer Art, die eine weitere wichtige Quelle darstellen. Im 20. Jahrhundert kommen „Oral History“ Quellen hinzu,17 und digitale Online-Archive sind mittlerweile essentielle Forschungs- und Bildungsmittel.18 Es geht daher nicht nur um die Gründung von Gegenarchiven, sondern auch um die Struktur und Umstrukturierung herkömmlicher Archive. Archive sind nicht nur als Denkmäler des Staates und Orte des Wissensabrufs, sondern auch – und vor allem – der Wissensproduktion zu betrachten. Dies erfordert eine Auseinandersetzung mit Archiven als kulturellen Akteuren der „Fakten“-Produktion und der staatlichen Autorität. Welche Form das Archiv annimmt und welche Klassifizierungs- und Erkenntnissysteme zu bestimmten Zeiten gültig sind, signalisiert und spiegelt die (Staats-)Macht. Dass Archive „Manipulationen“ unterworfen und keineswegs als objektive Stätten autoritativer Macht zu betrachten sind, beschreibt Jacques Derrida in der Schrift Dem Archiv verschrieben (Mal d’Archive) mit dem Begriff der „archivischen Macht“19. Es geht ihm dabei um die machtpolitischen Implikationen des Einsatzes von Archivtechniken, insbesondere um die Frage, wer entscheiden kann, welche Inhalte in ein Archiv gelangen und, darüber hinaus, wie diese zu interpretieren sind.
Geht es Foucault in erster Linie darum, die diskursiven Regeln aufzuspüren, die die verschiedenen Episteme des Wissens bilden, kehrt Derrida in die griechische Antike zurück, um das Arkheion zu untersuchen, das „ursprünglich ein Haus, ein Domizil, eine Adresse, die obersten Magistrate, die Archonten, die Befehlshaber“20 war und die politische Macht sicherte. Für Derrida ist das Archiv daher sowohl ein Ort des Beginns als auch ein Ort der Macht: Ein Archiv fand (als Ereignis) statt, weil es sowohl physisch als auch politisch an einem Ort gehalten werden konnte. Von Bedeutung ist, dass ein solches materielles Gedächtnis nicht einfach ein toter, unbeweglicher Speicher ist, sondern ein dynamisches, ja ein kreatives System, das das abgelegte Material stets mitgestaltet.21 Der französische Titel „Mal d’archive“ kann Archivschmerz bedeuten, das Archiv als Übel anprangern, aber auch als eine Art Sehnsucht (Heimweh) nach dem Archiv bezeichnen. Das Archiv ist in dem Spannungsfeld zu verorten, zwischen Eros und Thanatos, d.h. zwischen (lustvoller) Erhaltung und (Selbst-)Auslöschung.
Als Derrida 1994 seine Gedanken zum Verhältnis von Archiv und Erinnerung zum ersten Mal vorträgt, hatten E-Mails eben erst begonnen, die Kommunikation zu verändern. Er ahnt aber bereits gewaltigere Veränderungen der letzten Jahrzehnte voraus und ruft dazu auf, das Archiv im Lichte der durch die digitalen Kommunikations- und Speichermedien hervorgerufenen Veränderungen neu zu überdenken, denn auch das Speichermedium prägt das Gespeicherte. Von den psychoanalytischen Ausführungen Freuds ausgehend, erörtert Derrida, wie sich die Bedürfnisse und Verwendungszwecke der heutigen Gesellschaft für das Archiv im Vergleich zu denen der Vergangenheit verändert haben, und schlägt vor, dass künftige Archive dieser Entwicklung Rechnung tragen sollten, um sicherzustellen, dass sie nicht zu inaktiven und passiven Ressourcen werden. Zu finden sind alternative Archivstrukturen, die auch außerhalb traditioneller Aufbewahrungsorte existieren können.
Archive sind in diesem Sinne ein wichtiger Referenz- und Ausgangspunkt, wenn eine bestimmte kollektive Erinnerung (neu) gestaltet und narrativiert werden soll. Es wird danach gefragt, was damals passiert ist, wer die Akteuer:innen waren und was diese dokumentiert haben. Was wollten sie bewahren? Wie sollten wir diesen ‚Auftrag‘ verstehen? Und was passiert mit dieser Narration, wenn Akteur:innen gar nicht vertreten sind und im Archiv nicht dokumentiert, konserviert und für eine zukünftige kollektive Narration nicht mitgedacht wurden? Wer hat das Handlungsrecht und wer wird zur Platzhalter:in der fehlenden Akteur:innen? Die Historikerin Arlette Farge argumentiert pragmatisch, dass das Archiv kein Lager ist, aus dem man nach Belieben schöpft, sondern stets ein Mangel.22 Es ist also im doppelten Sinn geprägt von dem, was fehlt: Dokumente sind stets nur eine abstrakte Repräsentation der entschwundenen Wirklichkeit und die gewissenhafteste Archivsammlung weist Lücken auf. Sie bekennt dabei, dass die Fiktion, die Literatur, diese Dokumente zum Leben erwecken kann. In diesem Sinne zeichnet sich eine Verwandtschaft zwischen Archiv, Literatur und Kunst ab: das Archiv als eine Art Roman – und das Kunstwerk als Archiv. Ann Cvetkovich geht noch einen Schritt weiter und lenkt die Aufmerksamkeit auf Archive und kulturelle Texte als Repositorium für (kollektive) Emotionen und Gefühle (2003).23
Wie Elske Rosenfeld bemerkte, so tendiert die im deutschen Kontext institutionalisierte Erinnerungskultur dazu, die Wende mit der Friedlichen Revolution, dem Fall der Mauer und der ‚Wiedervereinigung‘ in einem scheinbar natürlichen und abgeschlossenen Ereignisverlauf zu verschmelzen. Ebenso führt das Narrativ der ‚Wiedervereinigung‘ direkt auf den kolonialen und faschistischen ‚Boden‘ zurück, auf dem die BRD und DDR als post-faschistische Staaten errichtet worden waren, und verschleiert ihn zugleich.24 In diesem Kontext entstehen „Gegenarchive“ oder „Anti-Archive“ gegen die Anmaßung der Erinnerung gewisser dominanter Gruppen und gewisser Kulturen des (Nicht-)Erinnerns, die intersektionale Erinnerungsarbeit und alternative Geschichtsschreibung ausschließen.25
Archive als kulturelle Praxen
In diesem Band sollen aufgrund des heterogenen Ansatzes ganz unterschiedliche Archive und Gegenarchive zur DDR eine Rolle spielen: offizielle und inoffizielle, öffentliche und private, analoge und digitale, literarische, künstlerische, filmische und metaphorische, die den offiziellen Erinnerungsdiskurs ergänzen. Archive bieten eine besondere Beziehung zum Raum, entweder als Ort der Auseinandersetzung mit der Vergangenheit – räumliche Anordnungen und Präsenz prägen Erinnerungsmuster – oder metaphorisch als Erinnerungsorte der Gegenwart und Zukunft. Die umgekehrte zeitliche Beziehung zum Raum birgt aber vor allem auch das Potential für eine kritische (Neu-)Ordnung und die Auseinandersetzung mit vergangenen Manipulationsversuchen, denn gerade in der räumlichen Veränderung und Gegenüberstellung werden die jeweiligen Fragestellungen der Zeit an den Artefakten ersichtlich.26 Die Beiträge sind ein Plädoyer für eine vielfältige und diverse Erinnerungskultur und registrieren die ‚ostdeutschen Umwelten‘ als literarische, sozio-kulturelle und letztendlich politische Archive. Sie reflektieren „Archivierungspraxen“, die als bewusste, zum Teil widerständige Gesten nicht nur als Gegenerzählungen zum DDR-Regime Raum einfordern, sondern auch einen kritischen Beitrag zur deutschen Mainstream-Erinnerung an 1989/90 und an postsozialistisch- kapitalistischen Realitäten leisten, und legen weiterhin vorhandene Leerstellen bloß.
Details
- Pages
- 422
- Publication Year
- 2025
- ISBN (PDF)
- 9783631928462
- ISBN (ePUB)
- 9783631928479
- ISBN (Hardcover)
- 9783631810972
- DOI
- 10.3726/b22498
- Language
- German
- Publication date
- 2025 (March)
- Keywords
- Archiv unterdrückter Literatur Stasi-Archive deutsche Wiedervereinigung Installation Dokumentarfilm Foucault Buchenwald Derrida Erinnerungsliteratur Comic als Geschichte DDR Medien Kunst Archive
- Published
- Berlin, Bruxelles, Chennai, Lausanne, New York, Oxford, 2025. 422 S., 23 S/W Abb.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG