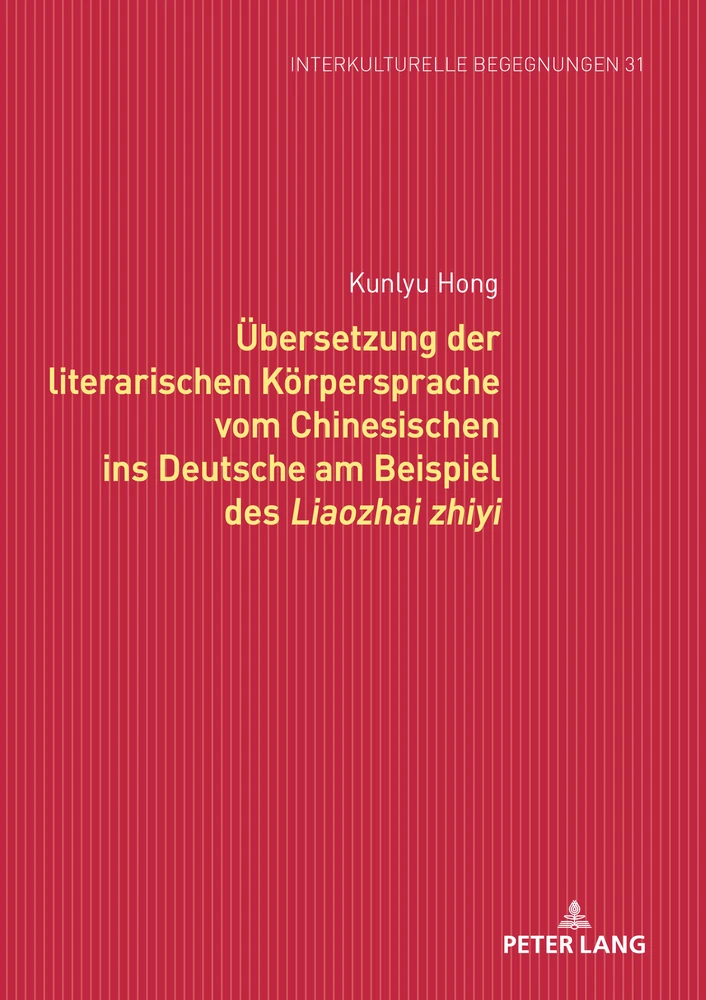Übersetzung der literarischen Körpersprache vom Chinesischen ins Deutsche am Beispiel des Liaozhai zhiyi
Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Forschungsthema und Fragestellungen
- Stand der Forschung
- Theoretische und methodologische Aspekte
- Zum Aufbau
- TEIL I: THEORETISCHE GRUNDLAGEN
- Übersetzungstheoretische Grundlagen
- Funktionale Übersetzungstheorie nach Christiane Nord
- Das Konzept „Funktionsgerechtigkeit + Loyalität“
- Übersetzungstypen
- Übersetzungsprobleme
- Übersetzung (erzähl)literarischer Texte aus funktionaler Sicht
- Häufige Kennzeichen und das Verstehen literarischer Texte
- Kommunikationsmodell erzählliterarischer Texte
- Kommunikative Funktion
- Wirkung
- Theoretische Grundlagen zur Körpersprache
- Begriffsbestimmung und modale Klassifikation
- Körpersprache in der interkulturellen Kommunikation
- Körpersprache als Ergebnis der Evolutionsgeschichte
- Körpersprache als Kulturprodukt
- Versprachlichung der Körpersprache
- Sprache und Körpersprache
- Verbalisierungsmöglichkeiten der Körpersprache
- Implizite Existenz der Körpersprache in der Erzählliteratur
- Kommunikative Funktionen der Körpersprache
- In der Alltagswelt bzw. Textwelt
- In der Text-Leser-Kommunikation
- TEIL II: DAS LIAOZHAI ZHIYI UND DIE DEUTSCHEN ÜBERSETZUNGEN
- Pu Songling und das LZZY
- Zum Autor Pu Songling
- Zum Werk LZZY
- Entstehung und Verbreitung
- Inhalt und Stoffquellen
- Sprache
- Textform
- Vermischung des Historischen und des Literarischen
- Exkurs: einige deutsche Genrebezeichnungen im Vergleich
- Rezeption in China
- Deutsche Übersetzungen des LZZY
- Skizze der Übersetzungsgeschichte des LZZY
- Mandschurisch, Japanisch und Koreanisch
- Russisch
- Englisch
- Französisch
- Italienisch
- Staatlich organisierte LZZY-Übersetzungen in China
- Deutsche Übersetzungen von 1901 bis 1918
- Allgemeines
- Chinesische Geister- und Liebesgeschichten (1911) von Martin Buber
- Chinesische Volksmärchen (1914) von Richard Wilhelm
- Deutsche Übersetzungen von 1919 bis 1948
- Allgemeines
- Seltsame Geschichten aus dem Liao Chai (1924) von Erich Schmitt
- Deutsche Übersetzungen von 1949 bis 1978
- Allgemeines
- Gaukler, Füchse und Dämonen (1955) von E. P. Schrock und Liu Guan-ying
- Deutsche Übersetzungen von 1979 bis 2001
- Allgemeines
- Die vollständige Übersetzung (1987–1992) von Gottfried Rösel
- Wundersame Geschichten aus der Studierstube der Muße (2001) von Zhang Penggao
- Zusammenfassung
- TEIL III: DIE LITERARISCHE KÖRPERSPRACHE IM LIAOZHAI ZHIYI UND DIE ÜBERSETZUNGSPROBLEME
- Funktionen der literarischen Körpersprache im LZZY
- Funktionen in der Textwelt
- Referentielle Funktion
- Expressive Funktion
- Emotionen und Gefühle
- Zwischenmenschliche Einstellungen
- Persönlichkeit, Geschlecht, Alter und Gesundheit
- Soziale Aspekte wie Beruf, Gruppenzugehörigkeit, Status, Familienstand usw.
- Zukunft und Umgang mit übernatürlichen Wesen
- Appellfunktion
- Ästhetische Funktion
- Phatische Funktion
- Funktionen in der Text-Leser-Kommunikation
- Referentielle Funktion
- Widerspiegelung der Volkskunde
- Körpersprache im Handlungsverlauf
- Thematische Funktion
- Expressive Funktion
- Zuneigung und Würdigung
- Abneigung und Kritik
- Appellfunktion
- Appell an Lebenserfahrung
- Appell an Phantasie
- Appell an Emotion und Einstellung
- Ästhetische Funktion
- Phatische Funktion
- Zusammenfassung
- Übersetzungsprobleme der literarischen Körpersprache im LZZY
- Pragmatische Übersetzungsprobleme
- Kulturspezifische Körperverhaltensformen
- Begrüßung und Abschied
- Volksglauben und religiöse Rituale
- Bekleidung und Frisur
- Intertextualität
- Konventionsbezogene Übersetzungsprobleme
- Konventionalisierte Verbalisierungen
- Unechte Verbalisierungen
- Konventionalisierte Metaphern und Vergleiche
- Überpräzise Verbalisierungen
- Das Erotische
- Texttitel
- Sprachenpaarspezifische Übersetzungsprobleme
- Lexik
- Mehrdeutigkeit bzw. semantische Undifferenziertheit
- ran 然-Bildungen
- Einsilbigkeit
- Morphologie und Syntax
- Numerus
- Auslassen der Satzglieder und fehlende Kohäsionsmittel
- Textspezifische Übersetzungsprobleme
- Zusammenfassung
- Schlussbetrachtung
- Tabellen-, Abbildungs- und Diagrammverzeichnis
- Literaturverzeichnis
- Anhang: Bibliographie der deutschen LZZY-Übersetzungen
1. Einleitung
1.1 Forschungsthema und Fragestellungen
Die Körpersprache ist ein grundlegendes Phänomen des Menschen, das zu verschiedenen Zeiten aus verschiedenen Perspektiven betrachtet worden ist. Bereits der chinesische Klassiker Zhouli 周禮 [Riten der Zhou], der Mitte des 2. Jahrhunderts v. u. Z. wiederentdeckt wurde, schreibt vor, dass der Richter beim Verhör neben der Sprache auch die Körpersprache des Anklägers1 und des Angeklagten beachten soll, um die Wahrheit herauszufinden. Unter den fünf Aspekten, die der Richter beobachten soll, sind drei körpersprachliche: der Gesichtsausdruck, der Atem und der Blick.
以五聲聽獄訟 求民情 一曰辭聽 二曰色聽 三曰氣聽 四曰耳聽 五曰目聽。(Zhouli 2014: 744)
Anhand fünf Aspekte wird ein Prozess beurteilt und die Wahrheit herausgefunden: erstens die Worte, zweitens der Gesichtsausdruck, drittens der Atem, viertens das Gehör, fünftens der Blick. (Übers. d. Verf.)
Zheng Xuan 鄭玄 (127–200), Kommentator und Gelehrter der Östlichen Han-Dynastie (25–220), erläutert die fünf Aspekte und verdeutlicht die Körpersignale beim Lügen: das Gesicht wird rot, der Atem wird unruhig, der Blick wird unscharf, d. h., der Blickkontakt wird vermieden.
觀其出言 不直則煩 。
察其顏色 不直則赧然。
觀其氣息 不直則喘。
觀其聆聽 不直則惑。
觀其眸子視 不直則眊然。(Zhouli 2014: 744–745)
Seine Worte beobachten, bei Unehrlichkeit sind sie umständlich und verwirrend.
Seine Gesichtsfarbe beobachten, bei Unehrlichkeit ist sie rot.
Sein Atem beobachten, bei Unehrlichkeit ist er unruhig.
Sein Gehör beobachten, bei Unehrlichkeit ist es stumpf.
Seine Augen und seinen Blick beobachten, bei Unehrlichkeit ist er unscharf. (Übers. d. Verf.)
Während das Zhouli und seine Kommentatoren die genaue Beobachtung der Körpersprache betonen und somit die Funktion der Körpersprache als Manifest des inneren Zustands eines Menschen hervorheben, beschäftigen sich die westlichen antiken Rhetoriker mit dem Einsatz der Körpersprache. Dabei geht es um „Ausführungen einer praktischen Psychologie, einer Psychagogik zur partnerbezogenen Körperwirkung, zur publikumswirksamen Selbstdarstellung und einflußnehmenden Präsentation der Sachinhalte“ (Kalverkämper 1998: 1345). Als Beispiel ist u. a. das Kapitel „Actio“ des im Jahr 55 v. u. Z. veröffentlichten Buchs De oratore [Über den Redner] von Marcus Tullius Cicero (2007: 412–423) zu nennen. Für ihn spielt die Körpersprache für die Wirksamkeit des Vortrags nach der Stimme die größte Rolle. Unter den verschiedenen Modi der Körpersprache hebt er das Minenspiel hervor, das von den Augen bestimmt wird:
Denn das Gesicht ist der einzige Teil des Körpers, der so viele Andeutungen und Veränderungen zustande bringen kann, wie es Seelenregungen gibt. Und es gibt auch niemanden, der dasselbe zustande bringen könnte, wenn er die Augen schließt. […] Die Augen sind es, durch deren bald gespannten und bald gelassenen, bald stechenden und bald heiteren Blick wir unsere Seelenregungen zu erkennen geben, wie es zur jeweiligen Art der Rede passt. Der Vortrag ist nämlich gleichsam die Sprache unseres Körpers, und umso mehr muss er mit unserem Geist im Einklang stehen. Die Augen aber hat uns die Natur gegeben, wie dem Pferd oder dem Löwen die Mähne, den Schweif und die Ohren, damit wir unsere Gemütsregungen deutlich ausdrücken können. (Cicero 2007: 421)
Die Körpersprache hat also sowohl in China als auch in der westlichen Welt schon sehr früh Beachtung gefunden. Im Laufe der Zeit ist sie Forschungsgegenstand verschiedener Disziplinen wie Anthropologie, Verhaltensforschung, Psychologie, Soziologie, Linguistik und Semiotik geworden, wobei seit Ende der 1960er Jahre die Forschung in jeder mit der Körpersprache befassten Disziplin förmlich explodiert (vgl. Korte 1993: 1–2, Anm. 3). Populärwissenschaftliche Handbücher über die Körpersprache, die sich immer mehr auf dem Markt finden und u. a. auf eine Steigerung des Beobachtungsvermögens bzw. eine bessere Selbstdarstellung abzielen, oder die vielgesehene amerikanische Fernsehserie Lie to me (2009–2011), in der Lügner anhand der Körpersprache entlarvt werden, zeigen deutlich, dass die Körpersprache auf immer größeres Interesse im Allgemeinen gestoßen ist.
Auch in der Literaturwissenschaft wird der Körpersprache Aufmerksamkeit geschenkt. Das Besondere der literarischen Körpersprache besteht darin, dass man anders als in vielen anderen Disziplinen nicht den Körper selbst ins Auge fassen kann, sondern nur die sprachlich festgelegte Darstellung: zwischen dem Leser bzw. dem Forscher und der Körpersprache liegt immer der gestalterische Eingriff des Schriftstellers (Moser-Verrey 1998: 77). Dieser Eingriff wird von heterogenen Faktoren determiniert. Dazu zählen nicht nur individuelle Faktoren wie der Schreibstil des Schriftstellers, sondern auch Faktoren der kulturellen und sprachlichen Umwelt, welche die literarische Präsentation der Körpersprache zumindest teilweise unabhängig vom Willen des Schriftstellers mitbestimmen. Z. B.:
- – Verschiedenen Schriftstellern stehen verschiedene Formen der Körpersprache zur Verfügung, weil die Körpersprache teilweise kulturbedingt ist. Die Körpersprache wird in der Literatur nicht „autonom“ verwendet, sondern zu einem beträchtlichen Anteil im Rahmen der Erkenntnisse über Körpersprache im Alltag (Korte 1993: 12).
- – Die Auswahl der körpersprachlichen Formen, die in einem literarischen Text dargestellt werden, hängt vom kulturbedingten Perzeptionsvermögen ab (Moser-Verrey 1998: 77–78).
- – Sprachen sind als Präsentationsmittel der Körpersprache unterschiedlich begrenzt. Das zeigt sich beispielsweise darin, dass nicht alle körpersprachlichen Verhaltensformen eine feste sprachliche Übersetzung in allen Sprachen haben.
- – Epochen und Gattungen spielen auch eine Rolle, welche Körperzeichen in welcher Dichte und mit welcher Funktion in einen literarischen Text eingesetzt werden. So behauptet beispielsweise Korte (1993: 7), dass die Erzählprosa in Hinblick auf die Präsentation der Körpersprache potentiell am wenigsten eingeschränkt ist. Außerdem geht aus ihrer Untersuchung zur englischen Erzählprosa hervor, dass Modus und Funktion der literarischen Körpersprache zeitspezifisch sind (vgl. Korte 1993: 185–220).
Diese Faktoren sind besonders ersichtlich, wenn der Leser aus einer anderen Kultur und Zeit kommt oder wenn die literarische Körpersprache in eine andere Sprache übersetzt wird. Genauso wie ein europäischer Reisender in China auf eine für ihn fremde, chinesisch spezifische Verhaltensform trifft, kann ein Leser in der literarischen Textwelt körpersprachlichen Formen begegnen, deren Bedeutung für ihn unklar oder in seiner Kultur anders ist. Meistens hat man jedoch nicht nur mit kulturspezifischen Verhaltensformen zu tun, sondern auch mit konventionellen Darbietungen in Hinsicht auf die Auswahl und die Verbalisierung der Körpersprache, die auf die Sprache, Kultur, Epochen- oder Gattungstradition zurückführen. So kann ein körperliches Phänomen, das eigentlich universal ist, durch eine konventionelle Beschreibung auf einen Leser einer anderen Kultur außergewöhnlich wirken. David E. Pollard, der u. a. chinesische Prosatexte ins Englisch übersetzt, nennt in diesem Zusammenhang die Beschreibung der Schweißausbrüche als Beispiel:
Chinese writers talk of panic causing sweat to exude from the whole head or scalp. This is in fact a quite accurate description – you do indeed sweat all over the scalp in extremis – but Western writers tend to note only the visible outbreak of sweat on the forehead, so in turn Western readers would suspect exaggeration, if the Chinese phrase is translated literally. As the translation of a novel cannot be used as an occasion to instruct the reader in physiology, the translator has to choose between challenging or conforming to the readers preconceptions. (Pollard 2001: 73)
Beim Übersetzen der literarischen Körpersprache kann der Übersetzer also mit einer doppelten Konventionalität konfrontieren: der konventionellen Körpersprache an sich und der konventionellen sprachlichen, literarischen Darbietung. Es ist daher nicht unrecht, wenn Pollard (2001: 77) klagt, dass die literarische Körpersprache dem Übersetzer wahrscheinlich mehr Kopfschmerzen als Vergnügen bereite. Obwohl die deutschen Übersetzer unter diesem Problem nicht weniger leiden als z. B. die englischen, bleibt die Übersetzung der Körpersprache in der Sprachrichtung Chinesisch-Deutsch ein bis heute unerforschtes Thema, wie in Kapitel 1.2 zum Stand der Forschung noch dargestellt wird. Das Hauptziel der vorliegenden Arbeit besteht daher darin, durch eine systematische Beschreibung und Analyse heraufzufinden, wie die Körpersprache in der chinesischen Erzählliteratur ins Deutsche übersetzt wird und Faktoren, die beim chinesisch-deutschen Übersetzen der literarischen Körpersprache Probleme bereiten, systematisch zu erfassen.
Als Untersuchungsbeispiele werden Texte aus der Sammlung Liaozhai zhiyi 聊齋志異 [Seltsame Geschichten aus dem Liao-Studienzimmer] (im Folgenden gekürzt als LZZY) von Pu Songling 蒲松齡 (1640–1715) und ihre deutschen Übersetzungen ausgewählt. Dafür gibt es verschiedene Gründe. In China wird das LZZY, das ca. 500 Texte umfasst, als Höhepunkt der traditionellen Kurzgeschichten geschätzt. Inhaltlich zeichnet sich das LZZY durch Grenzüberschreitungen in die Welt des Übernatürlichen und Fremden aus, welches der Schriftsteller mit der Welt der normalen Menschen harmonisch kombiniert und realistisch darstellt. Dort findet man diverse Beschreibungen der Gesichtsausdrücke, Körperbewegungen, -haltungen usw., die teilweise lebensnah, teilweise phantasievoll sind und sowohl in der Handlung als auch für den künstlerischen Effekt eine wichtige Rolle spielen. Die LZZY-Geschichten sind hauptsächlich in der anspruchsvollen, u. a. durch ihre Prägnanz gekennzeichneten klassischen Schriftsprache wenyan 文言 geschrieben. Wenn behauptet wird, dass die sprachlichen Qualitäten des LZZY kaum in eine westliche Sprache übertragbar seien (z. B. Motsch 2003: 245), wird umso mehr Neugier geweckt, wie verschiedene Übersetzer damit umgegangen sind. Mehrere Texte aus dieser Sammlung wurden seit Anfang des 20. Jahrhunderts mehrmals von verschiedenen Übersetzern ins Deutsche übertragen und eine Gesamtübersetzung liegt vor. Diese zahlreichen Übersetzungen, deren Entstehungszeiten sich auf einen Zeitraum von gut einem Jahrhundert verteilen, bieten eine vorteilhafte Grundlage für einen Übersetzungsvergleich.
Eine systematische Untersuchung der deutschen Übersetzungen der literarischen Körpersprache im LZZY soll auf einer Analyse der Körpersprache im LZZY aufbauen. Die letztere dient nicht nur einer fundierteren Übersetzungsanalyse, sondern sie hat auch an sich einen wissenschaftlichen Wert. Eine systematische Analyse der Körpersprache in der chinesischen Erzählliteratur, ob eine allgemeinere wie Barbara Korte (1993) zur englischen Erzählprosa, oder eine zu einem bestimmten Werk bzw. Schriftsteller wie u. a. Louise Forssell (2009) zu Theodor Storms Novelle Der Schimmelreiter, liegt noch nicht vor. Das zweite Ziel der vorliegenden Arbeit besteht daher darin, die Körpersprache im LZZY anhand eines umfassenden Instrumentariums in ihren Formen und Funktionen zu untersuchen, was einen systematischen Zugang zur Körpersprache in der chinesischen, vor allem der klassischen, Erzählliteratur ermöglichen soll.
Die Fragestellungen dieser Arbeit lassen sich zusammenfassend in einer logischen Reihenfolge wie folgt formulieren und ordnen:
- – Wie wird die Körpersprache im LZZY dargestellt? Welche Funktionen erfüllt die literarische Körpersprache im LZZY? Was sind die formalen und inhaltlichen Träger dieser Funktionen?
- – Was bereitet beim Übersetzen der Körpersprache im LZZY ins Deutsche Probleme?
- – Wie haben die Übersetzer diese Probleme gelöst bzw. zu lösen versucht? Was sind mögliche Erklärungen für Unterschiede in Übersetzungen?
1.2 Stand der Forschung
Wie oben erwähnt, findet die Körpersprache in verschiedenen Disziplinen wissenschaftliche Beachtung. Den Forschungszielen entsprechend sind Forschungsergebnisse aus den Bereichen Literaturwissenschaft und Übersetzungswissenschaft besonders relevant. Doch dürfen Erkenntnisse über die alltägliche Körpersprache nicht übersehen werden. Denn zum einen sind sie hilfreich, um die Körpersprache, den Gegenstand der literarischen Darstellung und Übersetzung, besser zu verstehen, zum anderen sind sie unerlässlich für ein fundiertes begriffliches Instrumentarium.
Die alltägliche Körpersprache ist wiederum Forschungsgegenstand zahlreicher Disziplinen, die sie aus verschiedenen Perspektiven erforschen. Das zeigt sich deutlich in Michael Argyles Buch Bodily Communication, das nach der Veröffentlichung im Jahr 1975 immer wieder neu gedruckt wird und mit dem Titel Körpersprache & Kommunikation. Nonverbaler Ausdruck und soziale Interaktion ins Deutsche übersetzt wurde. „Mr. Social Psychology“ Argyle (Robinson 2003: 5) greift in diesem Buch auch auf Erkenntnisse aus anderen Disziplinen wie Anthropologie, Biologie und Linguistik zurück und geht u. a. auf tierische Kommunikation, kulturbedingte Unterschiede der Körpersprache, Vergleich zwischen Sprache und Körpersprache ein. Er behandelt die verschiedenen nonverbalen Kommunikationskanäle und Funktionen der körperlichen Kommunikation und weist auf die zentrale Rolle der Körpersprache im sozialen Verhalten hin. Eine ähnlich umfassende Einführung in die Körpersprache mit mehr Chinabezug liefert der chinesische Linguist Geng Erling 耿二嶺 (2001) im Buch Yitai wanfang: tiyuxue conghua 儀態萬方 體語學叢話 [Die vielfältigen körperlichen Erscheinungen und Verhaltensformen: gesammelte Schriften über die Körpersprache].
Unter den Arbeiten, die sich auf bestimmte Aspekte der alltäglichen Körpersprache konzentrieren bzw. sie aus einer speziellen Sicht betrachten, sind u. a. die des Linguisten und Semiologen Winfried Nöth und die des Psychologen Paul Ekman zu nennen. Nöth bietet im Kapitel „Nonverbale Kommunikation“ des Werks Handbuch der Semiotik (2000: 293–322) einen Überblick zur Körpersprache aus semiotischer Sicht. Im Buch Emotions Revealed. Understanding Faces and Feelings (dt. Gefühle lesen. Wie Sie Emotionen erkennen und richtig interpretieren 2017, englische Originalausgabe 2003) hat Ekman seine Forschungsergebnisse über emotionale Gesichtsausdrücke ausführlich dargestellt. Bahnbrechend waren seine ethnologischen Studien zur Universalität der Gesichtsausdrücke, die in der Tradition von Charles Darwins Werk The Expression of the Emotions in Man and Animals (1872) stehen.
In der Literaturwissenschaft ist die Relevanz der literarischen Körpersprache bewiesen worden. Eine der umfassendsten Studien zum Thema literarischer Körpersprache liefert die Anglistin Barbara Korte. In ihrem Buch Körpersprache in der Literatur: Theorie und Geschichte am Beispiel englischer Erzählprosa (1993) entwickelt sie auf der Grundlage der modernen Forschungen zur Körpersprache und unter Berücksichtigung literarästhetischer Gesichtspunkte ein Beschreibungsmodell für Körpersprache in der Erzählliteratur. Zu literarästhetischen Gesichtspunkten zählen u. a. Präsentation, Funktion und Wirkungspotenzial der Körpersprache im Erzähltext. Außerdem behandelt sie in diesem Buch Aspekte des historischen Wandels literarischer Körpersprache am Beispiel der englischen Romanliteratur.
Details
- Seiten
- 330
- Erscheinungsjahr
- 2024
- ISBN (PDF)
- 9783631903537
- ISBN (ePUB)
- 9783631916971
- ISBN (Hardcover)
- 9783631903520
- DOI
- 10.3726/b21701
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2024 (September)
- Schlagworte
- Funktionen der Körpersprache Literarische Kommunikation Literaturübersetzen Funktionen der Übersetzung Körpersprache in der Literatur
- Erschienen
- Berlin, Bruxelles, Chennai, Lausanne, New York, Oxford, 2024. 330 S., 3 s/w Abb., 3 Tab.
- Produktsicherheit
- Peter Lang Group AG