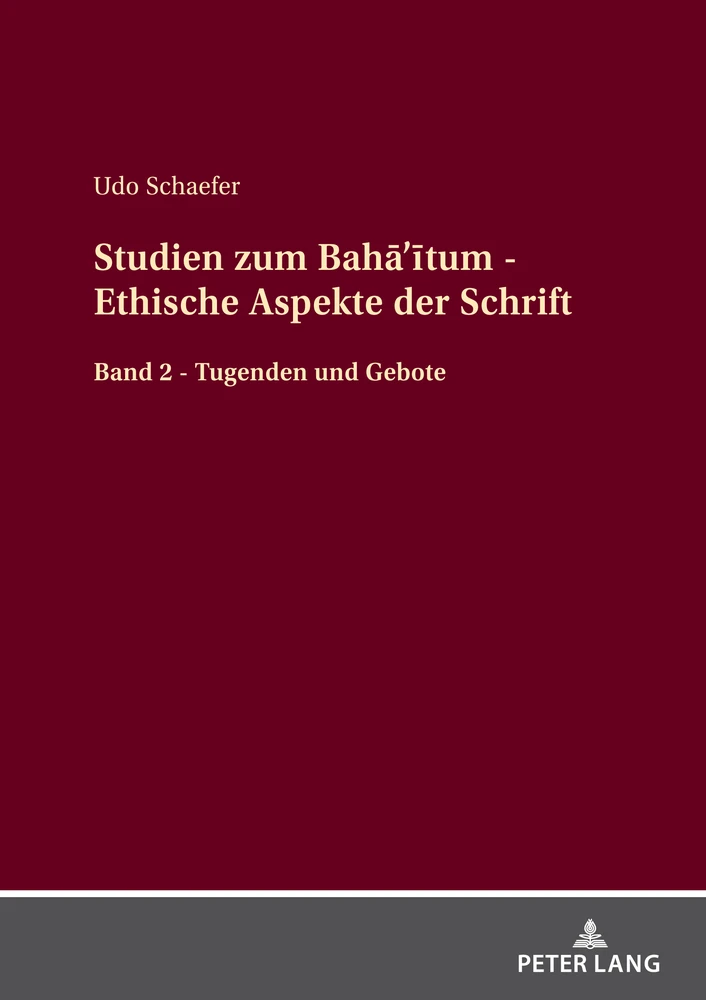Studien zum Bahā’ītum - Ethische Aspekte der Schrift
Band 2 - Tugenden und Gebote
Summary
Excerpt
Table Of Contents
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Inhaltsverzeichnis
- Vorbemerkung
- Vorwort zu Band 2
- Kapitel 11 Strukturen der Moralordnung
- 1. Deontologische und teleologische Strukturen der Bahā’ī Ethik
- 2. Kategorien der Pflichten und Tugenden
- 3. Zum Begriff „Tugend“
- 1. Was ist Tugend?
- 2. Wie entstehen die Tugenden?
- 3. Tugend: Ein Mittel und ein mühselig zu erlangendes Gut
- 4. Über die Gelassenheit des Herzens
- 5. Über Humor und Lachen
- 4. Über den Begriff „Charakter“
- 5. Die Moralordnung
- 6. Die Gebote
- Kapitel 12 Die theozentrischen Tugenden
- 7. Die Liebe Gottes
- 1. Das „erste und größte Gebot“
- 2. Liebe als Freundschaft zwischen Gott und dem Menschen
- 3. Die „Mutter aller Tugenden“
- 8. Die Gottesfurcht
- 9. Geduld und Nachsicht
- 1. Geduld auf dem Pfade Gottes
- 2. Über messianische Ungeduld
- 10. Standhaftigkeit im Glauben Gottes
- 1. Ihr Rang in der Moralordnung
- 2. Prüfungen
- 3. Über Märtyrertum
- 11. Mut im Gottesglauben
- 12. Ergebenheit, Treue
- 13. Unterwerfung, Demut, Hingabe, Ergebung in den Willen Gottes, Dienstbarkeit
- 1. Ergebenheit
- 2. Demut
- 3. Stolz und Hochmut
- 4. Ergebung und Hingabe
- 5. Dienstbarkeit und Lehren des Glaubens
- 14. Gehorsam
- 15. Gottvertrauen
- 16. Dankbarkeit
- 17. Frömmigkeit
- Kapitel 13 Die Tugenden des Pfades
- 18. Selbsterkenntnis
- 19. Loslösung
- 20. Selbstlosigkeit
- 1. Der Kampf gegen das Selbst
- 2. Eigenliebe und Selbsterhaltung
- 3. Kann der Mensch selbstlos sein?
- 4. Selbstsucht und verwandte Laster
- a) Habgier
- b) Geiz
- c) Neid und Eifersucht
- 5. Politische Auswirkungen
- 21. Reinheit und Heiligkeit, Reinlichkeit und Feinheit/Kultiviertheit
- 1. Reinigung ist „die Hälfte des Glaubens“
- 2. Innere Reinheit
- 3. Körperliche Reinlichkeit
- 4. Feinheit, Kultiviertheit
- 5. Die Bewahrung der Gesundheit
- 6. Exkurs: Selbstverstümmelung, Abtreibung, Selbstmord
- 22. Die Tugend des Rechten Maßes
- 1. Einleitende Bemerkungen zur Terminologie
- 2. Die Tugend der Goldenen Mitte
- 3. Das rechte Maß in den heiligen Schriften
- 4. Zorn und Begierde
- a) Zorn
- b) Begierde
- 5. „Panem et Circenses“
- 6. Abhängigkeit
- 7. Der Rausch in Bibel, Qur’ān und im Kanon der buddhistischen Texte
- 8. Das Rechte Maß als politische Kategorie
- 23. Keuschheit
- 1. Das pansexuelle Menschenbild
- 2. Manichäische Züge in der christlichen Lehre
- 3. Keuschheit in biblischen, qur’ānischen und buddhistischen kanonischen Texten
- 4. Keuschheit in der Bahā’ī-Schrift
- 5. Der begehrliche Blick
- 6. Ehe
- 7. Ehebruch, Pädophilie Homosexualität
- 8. Das „Buch Gottes“: Der Maßstab für moralische Entscheidung
- 9. Göttliche Reformation
- 24. Aufrichtigkeit und verwandte Tugenden: Wahrhaftigkeit, Lauterkeit, Ehrlichkeit, Vertrauenswürdigkeit, Treue, Redlichkeit
- 1. Aufrichtigkeit
- 2. Aufrichtigkeit, Rechtschaffenheit
- 3. Ehrlichkeit
- 4. Vertrauenswürdigkeit
- 5. Treue, Ehrlichkeit
- 6. Wahrhaftigkeit in den Heiligen Schriften
- 7. Die Lüge
- 8. Kann Lügen gerechtfertigt sein?
- 9. Heuchelei
- 10. Abschließende Bemerkungen
- Kapitel 14 Die Weltlichen Tugenden
- 25. Treue, Ehrlichkeit, Loyalität
- 26. Demut
- 1. „Eine Sklavenmoral“? Über „falsche Demut“
- 2. Über die Menschenwürde
- 3. Was ist Demut?
- 4. Gesellschaftliche Auswirkungen
- 5. Falsche Demut
- 6. Stolz und Hochmut
- 7. Selbstgerechtigkeit
- 8. Kritik nicht erlaubt?
- 27. Bescheidenheit
- 28. Standhaftigkeit, Tapferkeit, Beständigkeit, Mut, Ausdauer
- 1. Erläuterung der Terminologie
- 2. Kennzeichen von Tapferkeit und Standhaftigkeit
- 29. Geduld und Nachsicht
- 30. Kühnheit
- 31. Großmut, Großherzigkeit
- 32. Fleiß, Eifer: Eine Arbeitsethik
- 1. Ohne Fleiß kein Preis
- 2. Ein historischer Überblick
- 3. Arbeit und Beruf nach der Schrift
- 4. Anstrengung und Entspannung
- 5. Fleiß und Eifer
- 6. Arbeit: In den Rang des Gottesdienstes erhoben
- 33. Respekt, Ehre, Ehrerbietung
- 34. Dankbarkeit
- 35. Gehorsam
- 1. Gesetz und Ordnung
- 2. Gehorsam in der Krise
- 3. Gehorsam gegenüber den Eltern
- 4. Gehorsam gegenüber dem Staat
- 5. Gehorsam gegenüber den Institutionen der Gemeinde
- 6. Grenzen des Gehorsams
- 36. Toleranz
- 1. Toleranz nach der Schrift
- 2. Was ist Toleranz?
- 3. Über Tolerierung
- 4. Religiöser Fanatismus
- 5. Toleranz und die Verkündigung des Glaubens
- 6. Toleranz und rivalisierende Wahrheitsansprüche
- 7. Toleranz innerhalb der Gemeinde
- 37. Höflichkeit, Anstand
- 1. Höflichkeit und Anstand gemäß der Schrift
- 2. Was ist Höflichkeit?
- 3. Die Höflichkeit in der Krise
- 4. Der Rang der Höflichkeit in der Schrift
- 38. Die dianoëtischen Tugenden: Weisheit und Klugheit
- 1. Terminologische Betrachtungen
- 2. Weisheit, Klugheit und Vernunft
- 3. Weisheit als Attribut Gottes
- 4. Weisheit als Tugend
- 5. Unklugheit, Torheit
- 6. Klugheit: Die Kraft des moralischen Urteils
- 7. Klugheit und Beratung
- 8. Voraussehen der Konsequenzen
- 9. Schlauheit
- 10. Der Zweck heiligt nicht die Mittel
- 11. Sorgfältiges Urteil
- 12. Klugheit im Vergleich zu Kasuistik
- 13. Unklugheit
- 14. Die Klugheit in der Sprache
- 15. Kluges Verhalten
- 39. Gerechtigkeit: Allgemeine Betrachtungen
- 1. Einleitende Bemerkungen zur Methodik
- 2. Die Komplexität der Gerechtigkeit
- 3. Der hohe Rang der Gerechtigkeit in Judentum, Christentum, Islam, Bahā’ītum und der Philosophie
- 40. Grundlagen der Gerechtigkeit im abendländischen Kulturkreis: Ein Überblick
- 1. Was ist Gerechtigkeit?
- 2. Die metaphysische Dimension der Gerechtigkeit
- 3. Gerechtigkeit: Ein göttliches Attribut
- 4. Gut zu sein bedeutet, gerecht zu sein
- 5. Gleichheit
- 6. Kategorien der Gerechtigkeit
- 7. Gerechtigkeit: das Fundament des Staates
- 8. Tyrannei und Anarchie
- 9. Regierungsformen
- 10. Gerechtigkeit und Strafrecht
- 11. Die Bürgerpflichten
- 41. Die Gerechtigkeit in der Schrift Bahā’u’llāhs
- 1. Die politische Dimension der Gerechtigkeit
- 2. Die Metaphysik der Gerechtigkeit
- 3. Ethische Werte: Eine Einheit
- 4. Gerechtigkeit: Ein göttliches Attribut
- 5. Jedem das Seine: Lohn und Strafe
- 6. Gleichberechtigung
- 7. Verschiedenheit
- 8. Das Konzept von ‘adl wa inṣāf
- 9. Bahā’u’llāh und der Staat
- 10. Gehorsam gegenüber staatlicher Autorität
- 11. Religion und die Stabilität politischer Ordnung
- 12. Grenzen des Gehorsams
- 13. Gerechtigkeit: Die Quintessenz der Staatskunst
- 14. Der gerechte Herrscher
- 15. Ungerechtigkeit: Ẓulm wa i‘tisāf
- 16. Tyrannei
- 17. Die Erscheinungsformen von ẓulm
- 18. Eine Herrschaft des Rechts
- 19. Unparteilichkeit
- 20. Zur Aktualität der Aussagen Bahā’u’llāhs
- 21. Gerechtigkeit und Strafrecht
- 22. Die Todesstrafe
- 23. Schuld
- 24. Spezielle Fälle der göttlichen Gerechtigkeit
- 25. Die Anwendung von Gewalt
- 42. Rechtsverletzung durch Worte
- 1. Die Beherrschung der Zunge
- 2. Krittelei
- 3. Spott und Hohn
- 4. Ungehörige Rede
- 5. Fluchen
- 6. Schmähung, Verunglimpfung
- 7. Üble Nachrede und Verleumdung
- 8. Klatsch
- 9. Praktische Fragen
- 43. Gerechtigkeit als Tugend
- 1. „Die Gerechtigkeit ist Mir von allem das Meistgeliebte“
- 2. Die Bedeutung der Gerechtigkeit
- 3. Gerechtes Urteil und Unparteilichkeit
- 4. Unabhängige Suche nach Wahrheit
- 5. Beispiele für gerechtes Urteil
- 6. Persönliche Gerechtigkeit im Spiegel göttlicher Gebote
- 7. Gerechtigkeit im Alltag
- 8. Rechtschaffenheit
- 44. Gerechtigkeit und Liebe
- 45. Liebe
- 1. Natürliche Liebe: Das Gesetz der Anziehung
- 2. Sinnliche Liebe
- 3. Die wohlwollende Liebe der Freundschaft
- 4. Nächstenliebe
- 5. Dimensionen der Nächstenliebe
- 6. Schriftaussagen
- 7. Eine exzessive Moral?
- 8. Die Liebe zur Menschheit
- 9. Hass
- 10. Güte und Wohltätigkeit
- 46. Barmherzigkeit, Mitleid, Vergebung, Güte, Milde
- 1. Gottes Barmherzigkeit und Mitgefühl
- 2. Das Mitleid der Gottesboten
- 3. Mitleid: Eine Tugend?
- 4. Barmherzigkeit und Mitleid nach der Schrift
- 5. Vergebung: Ein Ausdruck der Barmherzigkeit
- 6. Güte und Milde
- 47. Großzügigkeit, Freigebigkeit, Wohltätigkeit
- 48. Die Auswirkungen der Liebe: Eintracht, Harmonie, Einigkeit, Ordnung, Versöhnung, Friede
- 1. Innerer Friede
- 2. Friede in der Gesellschaft
- 3. Eintracht, Harmonie und Einheit
- 4. Friede und Ordnung
- 5. Hass und Bosheit und ihre Auswirkungen
- 6. Friedfertigkeit und Versöhnung
- Epilog
- Appendix
- I. Kunst und Moral
- II. Brief des Universalen Hauses der Gerechtigkeit ... vom 11. September 1995
- III. Schreiben des Research Department betr. Fragen der Übersetzung einiger Begriffe ins Deutsche vom 14. August 1996
- BIBLIOGRAPHY
- Namensindex
- Sachindex
Vorbemerkung
Nachdem 2022 der erste Band dieses Werkes erschienen ist, folgt nun Band 2.
Mein Mann hat das Werk in Englisch verfasst, da er durch andere Aufgaben schon viel Material auf diesem Gebiet erarbeitet hatte. Nachdem er 1990 verstorben ist, habe ich es übernommen, dieses Werk ins Deutsche zu übersetzen. Ich habe mich bemüht, seinen hohen Anspruch auf einen gehobenen, klaren Stil zu erfüllen.
Ich hoffe, dass dieses Werk für viele, die an einem tieferen Verständnis der Bahā‘ī-Lehren interessiert sind, hier Erkenntnisse gewinnen können.
Für ihre Unterstützung danke ich meiner Tochter, Yasmin Mellinghoff, und ihrem Mann, Dr. Georg Mellinghoff sowie Herrn Stähli und Frau Madhukar für die angenehme Zusammenarbeit und Dr. Dr. Tajan Tober, der den Kontakt herstellte.
Im Frühjahr 2024
Sigrun Schaefer
Vorwort zu Band 2
Philosophische Grundfragen der Ethik aus theologischer Perspektive des Bahā‘ī-Denkens wurden in Band 1 behandelt. Gegenstand des vorliegenden Bandes sind die in der Offenbarung Bahā’u’llāhs verankerten sittlichen Zentralwerte, die Tugenden – letzte Grundhaltungen, in denen die sittliche Vollkommenheit des Menschen zum Ausdruck kommt. In ihrem Kontext werden auch die konkreten Gebote und Verbote Bahā’u’llāhs und seine Ratschläge, Ermahnungen und Warnungen dargestellt, die den Gläubigen auf den „Geraden Pfad“ der Vollkommenheit leiten sollen.
Bahā’u’llāhs Schrift enthält keine erkennbare Systematik.1 Das Streben der menschlichen Vernunft, alles systematisch zu ordnen, um es zu begreifen, gerät bei seiner Tugendlehre rasch an seine Grenzen, denn es ist nicht möglich, die unüberschaubare Mannigfaltigkeit der Tugenden und Gebote, Ermahnungen zur Tugend und Warnungen in das Prokrustesbett einer kohärenten, systematischen Ordnung zu zwingen. Das Reich der Tugenden läßt sich nicht in ein geschlossenes System bringen, es ist, wie Bollnow betont, „grundsätzlich unübersehbar und unsystematisierbar“2.
Dennoch bieten sich bestimmte Ordnungsgesichtspunkte an, um das Material in eine mehr oder weniger geordnete Form zu bringen. Einige Strukturen – zum Beispiel die Lehre von den vier Kardinaltugenden, die Platon, Aristoteles, Augustinus und Thomas von Aquin in ihren Werken behandelten, war grundlegend von westlichem Denken beeinflusst3 – sind auch im Schrifttum Bahā’u’llāhs zu finden. Die von mir vorgeschlagenen Kategorien von Pflichten und zugeordneten Tugenden sind nicht mehr als ein Versuch, eine gewisse Ordnung aufzuzeigen; doch bleiben vorgeschlagene Ordnungsschemata letztlich immer subjektiv. Man kann die Dinge auch anders sehen und andere Zugänge und Ansätze finden.
Bahā’u’llāh hat die Tugenden in aller Regel nicht definiert, er setzt sie vielmehr als bekannt voraus. Nur bei der Gerechtigkeit werden die inneren Strukturen deutlich. Die vorliegende Arbeit bemüht sich, Tugenden, denen wir in der Schrift begegnen, zu analysieren und ihre Konturen und Inhalte sichtbar zu machen, Zusammenhänge aufzuzeigen, die moralischen Forderungen zu konkretisieren und sie gelegentlich mit dem zeitgenössischen Denken zu kontrastieren, damit solche Texte nicht nur der religiösen Erbauung dienen, sondern auch der rationalen Aufklärung. Bei diesem Bemühen war das, was die großen Denker über die Jahrtausende zur Klärung beigetragen haben und was unverlierbar zum geistigen Erbe der Menschheit gehört, von großer Hilfe. Ich wüßte auch nicht, wie man die Umrisse einer offenbarten Ethik überhaupt darzustellen vermöchte, ohne das fruchtbar zu machen, was Platon, Aristoteles, Augustinus, Thomas von Aquin und Kant zum ethischen Denken beigetragen haben.
Die vorliegende Arbeit, die sich kaum auf Vorarbeiten stützen konnte, bleibt schon deshalb fragmentarisch, weil ich mich, von wenigen Ausnahmen abgesehen, auf die ins Englische übersetzten Quellen beschränken musste. Dieses Material ist gleichwohl sehr umfangreich. Bei der Fülle der Textzeugnisse ist es unvermeidlich, dass die eine oder andere Schriftaussage übersehen oder einzelne Aspekte nicht erkannt wurden. Ein Anspruch auf Vollständigkeit wäre vermessen.
Es geht zunächst einmal darum, die zentralen Prinzipien der Ethik Bahā’u’llāhs zu erörtern. Darum werden besondere Bereiche der Ethik, die mehr an der Peripherie angesiedelt sind wie beispielsweise die sogenannte Bioethik, nur am Rande berührt, weil die Schrift zu diesen Problemen, die erst durch die moderne Forschung aufgetreten sind, schweigt. Rechtliche Parameter durch die unfehlbare, supplementäre Gesetzgebung des Universalen Hauses der Gerechtigkeit, die unweigerlich auch moraltheologische Relevanz hätten, gibt es noch nicht.
Die vorliegende Untersuchung wird aufzeigen, dass Bahā’u’llāhs theonome Ethik in ihrem Kern eine Rückkehr zur Tugendlehre bedeutet, die in allen Hochreligionen ihren festen Platz hat. Die meist apodiktischen Gebote und Verbote der Schrift – die keine kasuistischen Einzelfallregelungen sind, sondern prinzipiell und ethisch-universal gelten – sind zu den Tugenden komplementär. Sie sind keineswegs neu und können es auch nicht sein, denn als Widerspiegelung der Namen und Attribute Gottes sind sie so unwandelbar wie Gott selbst. Nur in ihrer historischen Ausformung, Akzentuierung und Hierarchisierung und in ihrem sprachlichen Gewand unterscheiden sie sich. Dass Bahā’u’llāh auch keineswegs Originalität für die von ihm offenbarten Werte beansprucht, sondern auf die „heiligen Bücher und Schriften“ der Vergangenheit4 verweist, was „einstens offenbart den Propheten“5, wurde schon in Band 1 erörtert.
Es schien mir ratsam, einschlägige heilige Texte anderer Religionen, vor allem solche der jüdisch-christlich-islamischen Tradition, einzubeziehen, gibt es doch keinen besseren Weg, die Einheit der Religionen aufzuzeigen, als die erstaunlichen Gemeinsamkeiten in ihren Lehren sichtbar zu machen. Für den außenstehenden Leser, der sich bemüht, in eine ihm fremde Glaubenswelt einzudringen, ist die Begegnung mit dem, was ihm vertraut ist, hilfreich. Auch für den Bahā’ī ist der Blick in andere heilige Texte nützlich, zum einen, weil er so erkennt, wie groß die Gemeinsamkeiten tatsächlich sind und welche Kontinuität auf diesem Feld herrscht, zum anderen, weil die Kenntnis anderer religiöser Lehren auch zu einem tieferen Verständnis des eigenen Glaubens verhilft.
Ich habe mich an die Termini der arabisch-persischen Originale gehalten. Ohne Dr. Armin Eschraghis Freundschaftsdienst, mir diese Begriffe und ihr Umfeld zugänglich zu machen, wäre das vorliegende Werk auf Sand gebaut. Ihm möchte ich dafür herzlich danken.
Ein Blick in das Inhaltsverzeichnis mag den Leser verwundern: Die Kapitel sind von sehr unterschiedlicher Länge. Kapitel 14 ist wesentlich umfangreicher als alle anderen zusammen, und auch die Erörterung der einzelnen Tugenden reicht von 2 Seiten bis zu 150 Seiten bei wenigen Abschnitten. Mir ist diese Ungereimtheit nicht entgangen, doch sehe ich nicht, wie ich sie hätte vermeiden können. Die verschiedenen Kategorien der Tugenden, die in den Kapiteln 12 bis 14 erörtert werden, sind eben von sehr unterschiedlichem Umfang, und für die Tugenden selbst gilt dies umso mehr: Die Grundzüge von Tugenden wie Frömmigkeit oder Seelengröße lassen sich in einer solchen Einführung auf wenigen Seiten darstellen; die hoch komplexe Gerechtigkeit dagegen nicht.
Um den Textfluss zu erhalten, wurden darüber hinaus eingehende Kommentare, die hier nicht unbedingt nötig sind, die dem interessierten Leser aber wichtige zusätzliche und ergänzende Informationen geben, in die Fußnoten aufgenommen.
Schließlich habe ich meiner lieben Frau Sigrun zu danken, die über die langen Jahre die von mir diktierten Texte und die endlosen Korrekturen auf dem Computer geschrieben und mich von der Recherchearbeit in den Bibliotheken entlastet hat. Allein die Fülle der Zitate, die sie in den jeweiligen deutschen Ausgaben der philosophisch-theologischen Literatur aufzuspüren hatte, war eine Mammutaufgabe – sie war schwierig und extrem zeitaufwendig.
1 Hierzu siehe Ethische Aspekte der Schrift, Bd. 1, Kap. 4, S. 146 ff.
2 Bollnow, Tugenden, S. 24.
3 Der Kirchenvater Ambrosius (340–397 n. Chr.) deutete die vier Paradiesströme (siehe Gen. 2:10) allegorisch auf die Tugenden Klugheit, Maß, Tapferkeit, Gerechtigkeit, die er erstmals „Kardinaltugenden“ nannte. Beim Kirchenvater Hieronymus (347–419 n. Chr.) erschienen die Kardinaltugenden als „Viergespann“, dessen Wagenlenker Christus ist.
4 Siehe Ährenlese 75:2; 131:4; 134:2; Botschaften 11:2; 8:31.
5 Verborgene Worte, arab., Einleitung
Kapitel 11 Strukturen der Moralordnung
… wir betrachten die Tugend nicht, um zu wissen, was sie ist, sondern um tugendhaft zu werden; sonst wäre unsere Arbeit zu nichts nütze.2
1. Deontologische und teleologische Strukturen der Bahā’ī Ethik
Ähnlich wie im Qur’ān3, gibt es in den heiligen Schriften der Bahā’ī ethische Weisungen, Gebote, den Lobpreis der Tugenden, Ermahnungen und Warnungen, die in das Ganze verwoben sind. Eine Prüfung der heiligen Texte offenbart, dass moralische Führung in zwei fundamental unterschiedlichen Strukturen enthalten ist: in Tugenden und Geboten. Auf der einen Seite finden wir in Bahā’u’llāhs Schrift zahlreiche Lobpreisungen der Tugenden oder Hinweise darauf, Ermahnungen, ein Leben der Tugend zu führen, und Warnungen vor einem Leben in Sünde und Laster. Auf der anderen Seite gibt es konkrete moralische Vorschriften und kategorische Gebote, die bestimmte Handlungen anordnen oder verbieten.
Da die Tugenden höchste Werte sind, „ein bedingendes Prius aller Phänomene des moralischen Lebens“4, nach denen wir unser Leben formen sollen, ist die erste Kategorie – die vorherrschende – also auch eine Art Werteethik. Da diese Werte mit den Attributen Gottes identisch sind, haben sie einen objektiven Charakter5, sie sind „dem Subjekte als dem Wertenden gegenüber Absolutheit“6. Sie gelten bedingungslos, und der Garant für ihre Gültigkeit ist der Schöpfer des Reiches der Werte, Gott, der, indem er sich offenbarte, die Menschheit zu diesen Werten versammelt.7
Die Tugenden schreiben nicht konkretes Handeln vor; sie richten sich vielmehr auf grundlegende Haltungen und Charakteranlagen, auf eine Form der Existenz, auf das rechte Sein, aus dem die rechte Handlung resultiert8 oder, wie Pieper es ausdrückt: „Lehre vom Sein der Menschen als dem Quell des Tuns“9. Daher ist Bahā’u’llāhs normative Anthropologie, d. h. seine Lehre über die wahre Natur des Menschen, untrennbar mit den Tugenden verbunden, weil des Menschen Sein (sein „guter Charakter“) die Quelle seines Tuns, seiner Handlungen (seiner „guten Taten“) sind. Insofern als die Tugenden ein télos, d. h. einen Zweck haben, das rechte Sein, kann man die Bahā’ī-Ethik auch teleologisch nennen.
Die zweite Kategorie enthält jene konkreten moralischen Gebote und Verbote10, die die Pflichten begründen, die zu beachten sind, weil sie dem Willen Gottes entspringen. In diesem Sinne ist die Bahā’ī-Ethik normativ und folgt den Kriterien von „erlaubt“, „befohlen“ oder „verboten“. In der Philosophie wird dies als Deontologie bezeichnet.11
Beide Kategorien, die deontologische und die teleologische, begründen die moralischen Pflichten, gemäß derer der Mensch zu handeln hat. Daher wird das moralisch Gute und das moralisch Schlechte entweder durch Tugenden und Laster definiert oder durch das Befolgen der Gebote und Verbote. Diese beiden Formen, die man in den Schriften der meisten Religionen findet, widersprechen sich nicht, sie sind nur unterschiedlich, d. h. sie haben komplementäre ethische Strukturen12, die auf das gleiche Ziel gerichtet sind: menschliche Vollkommenheit, um Gottes Wohlgefallen und himmlische Glückseligkeit zu erlangen. Das Gesetz Gottes, wie es in den Bezeichnungen ḥudūd Allāh13, aḥkām14, awāmir15 und sharī‘ah16 zum Ausdruck kommt, besteht aus dieser moralischen Führung zusammen mit den Rechtsvorschriften (ius divinum) und den rituellen Vorschriften (‘ibādāt). Die beiden letzteren sind nicht Teil des hier diskutierten Gegenstands.
2. Kategorien der Pflichten und Tugenden
Wir gewinnen ein besseres Verständnis der moralischen Normen, wenn wir zunächst die moralischen Pflichten klassifizieren. Solch eine Klassifizierung kann man unter dem Gesichtspunkt des Zwecks der Pflichten vornehmen. Es gibt zweierlei Pflichten: unsere Pflichten gegenüber Gott – hier die theozentrischen Pflichten im engeren Sinn des Wortes, denn am Ende aller moralischen Pflichten stehen die Pflichten des Bundes und sind daher Gott geschuldet –, und unsere Pflichten gegenüber anderen Menschen. Jedoch kann sich zusätzlich die Frage erheben, ob es noch eine dritte Kategorie gibt: die Pflichten, die der Mensch gegenüber sich selbst hat.
Auf den ersten Blick mag das Konzept der Pflicht gegenüber sich selbst widersprüchlich erscheinen. Setzt eine Pflicht nicht wenigstens zwei Subjekte voraus? Immanuel Kant setzte sich mit diesem scheinbaren Widerspruch in seiner Metaphysik der Sitten17 auseinander, wo er erklärt, warum es Sinn ergibt, eine Pflicht sich selbst gegenüber anzuerkennen, „ohne in Widerspruch gegen sich zu geraten“, so als wenn man sagte „Ich bin mir das selbst schuldig“.18 Moralisch hervorragend zu handeln, indem man den Pfad der Selbstvervollkommnung geht, ist eine Pflicht, die der Einzelne gegen sich selbst hat:
Der Mensch ist es sich selbst (als einem Vernunftwesen) schuldig, die Naturanlage und Vermögen, von denen seine Vernunft dereinst Gebrauch machen kann, nicht unbenutzt und gleichsam rosten zu lassen.19
Darüber hinaus kennen wir schon die qur’ānische Formel, „sich selbst Unrecht tun“ (ẓulm an-nafs)20, indem man eine Sünde begeht21, woraus man schließen kann, dass die Pflicht gegenüber sich selbst darin besteht, sich nicht zu verletzen. Dasselbe kann man aus der Definition von ‘Alī ibn Abī Ṭālibs drei Arten der Ungerechtigkeit sehen, wonach es eine Ungerechtigkeit gegenüber sich selbst ist, wenn ein Mensch sich Schaden antut, indem er eine Sünde begeht.22 Nach der Lehre Bahā’u’llāhs hat Gott das Selbst in des Menschen Hand als göttliches „Pfand“ (amāna)23 gegeben. Des Menschen Körper ist „der innere Tempel“24, sein Herz ist Gottes „Thron“25, Gottes „Wohnstatt“26 und „Schatzkammer“27. Des Menschen Auge ist Gottes „Pfand“, sein Ohr ein „Zeichen“ seiner „Großmut“, seine Hand „ein Sinnbild“ der „Güte Gottes“.28
Der Mensch ist, wie Kant befand, sich nicht als Eigentum gegeben:
Der Mensch kann über sich selbst nicht disponieren, weil er keine Sache ist.29
Daher ist es des Menschen Pflicht, seine Gesundheit zu bewahren30, weshalb Selbstverstümmelung31 und Selbstmord32 große Sünden sind.
Die drei Kategorien der Pflichten33 entsprechen den drei Klassen von Tugenden:
- Die Tugenden gegenüber Gott ergeben sich aus dem, was ich die „theozentrischen Tugenden“ nenne; ihr Ziel ist Gott, der sich offenbart hat; ihr Zweck ist es, den Menschen direkt mit Gott in Verbindung zu bringen. Man findet sie nicht in der philosophischen Ethik.
- Die Tugenden jedes einzelnen Menschen gegenüber sich selbst mag man die „Tugenden des Pfades“ nennen, nämlich den „Pfad der Loslösung“ oder den „Pfad der Vervollkommnung“34.
- Des Menschen Pflichten gegenüber anderen Menschen kann man – wie in der katholischen Lehre35 – „weltliche Tugenden“ nennen. Jedoch ist eine klare Zuordnung nicht völlig praktikabel, da eine beträchtliche Zahl von Tugenden zu mehr als einer Kategorie gehören.
Warum ist eine solche Kategorisierung nötig? Meiner Ansicht nach ist dies keineswegs reine intellektuelle Spielerei, denn ohne Hierarchisierung der Tugenden kommt es bei manchen Aussagen Bahā’u’llāhs zu offensichtlichen Widersprüchen. Es ist offenkundig, dass eine solche Hierarchie in der Schrift existiert.36 Zum Beispiel ist nach der Anerkennung der Manifestation Gottes die Standhaftigkeit „die erste, vornehmste den Menschen vorgeschriebene Pflicht“: „Sie ist der König aller Taten“.37
Zugleich heißt es in anderen Passagen, Gerechtigkeit (inṣāf) ist „von allem das Meistgeliebte“38, „die grundlegende menschliche Tugend“39, „das Wesen all dessen, was Wir für dich offenbarten“40. Unter dem Blickwinkel der verschiedenen Kategorien stellt dies keinen Widerspruch dar. Standhaftigkeit hat ihren hohen Rang unter den Tugenden in der Kategorie der „theologischen Tugenden“, wogegen die Gerechtigkeit – in Übereinstimmung mit der philosophischen Tradition (Platon, Aristoteles, Thomas von Aquin) – ihre besondere Stellung unter den „weltlichen Tugenden“ innehat.
3. Zum Begriff „Tugend“
1. Was ist Tugend?
Tugend41 ist ein zentraler Begriff in allen offenbarten ethischen Systemen. Den Begriff findet man in der jüdischen, christlichen und islamischen Ethik und auch in den heiligen Schriften des Buddhismus:
Richte dich auf, sei nicht nachlässig, in rechtem Wandel folge der Lehre, so wirst du glücklich leben, in dieser Welt und in der nächsten.42
In der Bahā’ī-Schrift begegnen wir diesem Begriff häufig. Die Gläubigen werden aufgefordert, „ein Leben der Tugend“43 zu führen und „Wahrzeichen der göttlichen Tugenden unter den Menschen zu sein“44, „ein Himmelslicht am Horizont der Tugend“45. Zwar ist gesagt, dass nur „heilige Worte und reine, treffliche Taten“ in der göttlichen Gegenwart angenommen werden46:
Ehrlichkeit, Tugend, Weisheit und ein heiliger Charakter gereichen dem Menschen zur Ehre, während ihn Unredlichkeit, Schwindel, Unwissenheit und Heuchelei in Erniedrigung stürzen. Bei Meinem Leben! Nicht im Schmuck und Reichtum liegt des Menschen Adel, sondern in tugendsamem Verhalten und wahrem Verständnis.47
Sei … ein Himmelslicht am Horizont der Tugend …48.
Was jedoch genau mit Tugend (faḍīla)49 gemeint ist, ist in der Bahā’ī-Schrift nicht definiert. Die Tugenden sind in unterschiedlichem Kontext aufgezählt und gepriesen, aber mit wenigen Ausnahmen nicht im einzelnen erklärt. Vielmehr scheint dieses Wissen vorausgesetzt zu sein. Bezüglich der „Tugenden und Attribute, die Gott angehören“, bezieht Bahā’u’llāh sich explizit auf die „Heiligen Bücher(n) und Sendbriefe(n)“50, auf die „göttlichen Bücher“, wo sie „genannt und beschrieben“ sind.51
Von besonderer Bedeutung ist der Gedanke, dass Tugenden Widerspiegelungen von „Gottes Attribute[n] und Namen“52 sind. Diese Attribute sollen die „Eigenschaften Gottes im Spiegel der Wirklichkeit des Menschen erstrahlen“ lassen, damit „der gesegnete Vers: ‚Lasset Uns Menschen machen nach Unserem Bild und Gleichnis‘53, verwirklicht wird“54:
Auf die innerste Wirklichkeit jedes erschaffenen Dings hat Er das Licht eines Seiner Namen ergossen; jedes hat Er zum Empfänger der Herrlichkeit einer Seiner Eigenschaften gemacht.55
Das „Ebenbild Gottes“ manifestiert sich im Menschen in dem Grad, in dem er diese Attribute in all seinen Gedanken und Handlungen widerspiegelt56:
Je größer der Eifer ist, der aufgewendet wird, diesen erhabenen, edlen Spiegel zu verfeinern, desto getreuer wird er die Herrlichkeit der Namen und Eigenschaften Gottes widerspiegeln …57
Die göttlichen Namen und Attribute, die seit je der Menschheit durch die Propheten der Vergangenheit offenbart wurden, sind in allen Sendungen identisch, da Gott sich nicht wandelt. Alles andere ist in ständigem Fluss, da „… keine Daseinsform im Zustand der Ruhe verharrt“58. Gott allein „ist und war von Ewigkeit her … unveränderlich“59.
Preis sei Gott, dem Ewigen, der nie vergeht, dem Immerwährenden, der niemals schwach wird, dem Selbstbestehenden, der sich niemals wandelt.60
… In der gesamten Schöpfung ist keine größere Sünde denkbar als die Behauptung, im Reiche der göttlichen Einheit gebe es einen Wandel.61
Daher sind seine Attribute ebenso durch alle Zeiten unwandelbar. Tugenden, die den göttlichen Attributen entsprechen62, sind folglich in allen Religionen identisch, auch wenn die eine oder andere nicht enthüllt wurde. Dies bedeutet, dass die Tugenden der individuellen Ethik zeitlos sind: sie „ändern oder wandeln“ sich nicht63. Die Originalität der Manifestationen im Bereich der Ethik besteht jeweils darin, diese ewigen Werte von den Verkrustungen, Deformationen, Fehldeutungen und der Verlagerung der Bedeutung, die sie erlebt haben, zu reinigen, sie neu zu bestätigen, während gleichzeitig die ursprüngliche Bedeutung und ihr Schwerpunkt beibehalten und sie vor allem mit neuer geistiger Kraft ausgestattet werden. Diese Reinigung und Angleichung an die geistige Entwicklung der Menschheit ist Teil der Erneuerung64, der „göttlichen Reformation“65 der Religion. Ungeachtet der Tatsache, dass die Werte der individuellen Ethik im Wesentlichen dieselben sind, hat jedes Moralsystem seine Besonderheit. Die spezifische Akzentuierung der individuellen Werte innerhalb der Wertehierarchie verleiht jedem ethischen System seinen besonderen Charakter.
Folglich beansprucht Bahā’u’llāh keine Originalität für die von ihm verkündeten Moralwerte. Seine Schrift lässt keinen Zweifel, dass der Pfad der Vervollkommnung, den er offenbart hat, kein neuer Pfad ist, sondern der alte Pfad, der von allen Boten der Vergangenheit verkündet wurde. Die moralischen Ziele und Tugenden, die er auferlegt, sind die „innere Essenz“ dessen, was „einstens offenbart [ward] den Propheten“66. Diese ewigen Werte bilden das Herzstück der „einen und unteilbaren Religion Gottes“67, wie die Propheten sie offenbart haben, des „unveränderlichen Glaubens, ewig in der Vergangenheit, ewig in der Zukunft“68.
Daher überrascht es nicht, dass grundlegende Begriffe sowie die Tugend- und Charakterlehre in Philosophie und Theologie mehr oder weniger dieselben sind. Judentum69, Christentum und Islam übernahmen die ethischen Lehren und Begriffe, die die griechischen Philosophen wie Sokrates, Platon, Aristoteles und die Stoa entwickelt haben.70 Auch der Autor einer buddhistischen Ethik71 bezieht sich auf sie. Die ethischen Abhandlungen von Aristoteles72 hatten einen tiefgreifenden Einfluss auf die christliche Morallehre (besonders auf die von Thomas von Aquin73), sowie auf die islamische Ethik (‘ilm al-akhlāq).74 Während Bahā’u’llāh bestätigte, „das Wesen und die Grundlagen der Philosophie stammen von den Propheten“75, bezeichnete er im besonderen Sokrates, Platon und Aristoteles als Leuchten „des Wissens“.76
Solch eine Anerkennung wäre in einem Werk, das der Bahā’ī-Ethik gewidmet ist, an sich schon Grund genug, auf die universell akzeptierten Begriffe der Tugenden, wie sie Aristoteles entwickelte, ausgiebig Bezug zu nehmen. Doch darüber hinaus haben die Bahā’ī-Schrift und die Schriften ‘Abdu’l-Bahās ganz klar ein Aristotelisches Substratum, wie Ian Kluge77 überzeugend dargelegt hat. In seiner scharfsinnigen Analyse zeigt er, „die Schriften analysieren und stellen die Realität in den Aristotelischen Begriffen“ dar, sie machen „umfangreichen Gebrauch von der Aristotelischen Terminologie“78, wie „Stoff“, „Eigenschaften“ und „Wesen“. Kluge verweist auf die „auffallenden Ähnlichkeiten zwischen Aristoteles und der Bahā’ī-Schrift, die über die theoretische Weisheit philosophischen Wissens hinaus auch das praktische Wissen der Ethik umfasst“79. Beide Systeme haben, wie er beobachtet, gemeinsame „fundamentale Voraussetzungen“; beide sind „wesentlich kompatibel, weil sie auf einer gemeinsamen Basis gebaut sind“80, und beide „stützen eine teleologische Ethik“81. Ich teile Kluges Zusammenfassung von ganzem Herzen:
Man könnte sagen, daß Bahā’u’llāh und ‘Abdu’l-Bahā Aristoteles mit so viel Hochschätzung betrachteten, daß sie seine Philosophie als das beste philosophische Werkzeug übernahmen, um die neue Offenbarung darzustellen.82
Darüber hinaus weist ‘Abdu’l-Bahā auf den Vorteil hin, dass wir viele Dinge, die in der Vergangenheit versucht und geprüft wurden, als Modell übernehmen können.83
Nun wollen wir uns dem Begriff „Tugend“ zuwenden. Nach Aristoteles hat „die Seele einen unvernünftigen und einen vernünftigen Teil“84; Ziel der Moral sei es, den nichtrationalen Teil der Seele85 mit Hilfe der Tugend der Herrschaft der Vernunft zu unterwerfen. In Übereinstimmung damit betont Kant, „sich nicht von seinen Gefühlen und Neigungen… beherrschen zu lassen …, weil ohne daß die Vernunft die Zügel der Regierung in ihre Hände nimmt, jene über den Menschen den Meister spielen“86. Die Tugend erfordert daher vor allem die „Herrschaft über sich selbst“87. So sagt auch ‘Abdu’l-Bahā, „das moralische Leben besteht darin, Herr seiner selbst zu sein“88.
Von Aristoteles wissen wir, dass die Tugenden weder Leidenschaften (Begierde, Ärger, Furcht, Hass, Neid usw.) sind noch natürliche Fähigkeiten, sondern ein „Habitus“89:
… ein lobenswerter Habitus wird aber Tugend genannt.90
Daher wird die Tugend als eine Qualität der Seele bezeichnet, als eine innere und beständige Disposition91, die über einzelne Handlungen hinausgeht. Sie ist ein fortwährender Maßstab für moralisches Handeln, eine grundlegende Haltung, „mit der ein Mensch die richtigen Dinge tun kann, korrekt, einfach und mit Vergnügen“92. Dies gilt auch für jene unvorhergesehenen Handlungen, auf die man in unerwarteten Situationen spontan und ohne Überlegung reagiert.93 Die Tugend macht es dem Menschen möglich, das Gute zu tun und das Schlechte zu meiden, wie Thomas von Aquin feststellt:
Zum Tun des Guten aber werden wir angeleitet durch die tatfordernden Gebote, zum Unterlassen des Bösen durch die Verbote.94
Diese Formel verdeutlicht den Zweck von Tugend und Ethik ganz allgemein. Man findet sie in den heiligen Schriften der Vergangenheit95 wie auch in der Bahā’ī-Schrift:
… denn die Gottesfurcht treibt den Menschen, sich fest an alles Gute zu halten und alles Böse zu meiden.96
Wahrlich, Er befiehlt allen Menschen, was recht ist, und verbietet, was ihre Stufe herabsetzt.97
Darum nennt Aristoteles die Tugenden Dispositionen, die „ein lobenswerter Habitus“ sind.98 Im Katechismus der Katholischen Kirche sind sie definiert als „feste Haltungen, verlässliche Neigungen, beständige Vollkommenheiten des Verstandes und des Willens, die unser Tun regeln, unsere Leidenschaft ordnen und unser Verhalten der Vernunft und dem Glauben entsprechend lenken“99.
2. Wie entstehen die Tugenden?
Der Mensch, den Gott „reich erschaffen“100 hat, und in den er das „Wesen Meines Lichtes“101 gelegt hat, hat eine natürliche ethische Veranlagung für Tugend. Die Tugenden sind aber keine Gabe der Natur, sie müssen durch menschliches Bemühen erworben werden. „Die Tugenden dagegen erlangen wir nach vorausgegangener Tätigkeit, wie dies auch bei den Künsten der Fall ist.“102 Die Tugenden hängen von der Disziplin103 ab und von ständiger Selbstkontrolle. Jede entsteht auf unterschiedliche Weise, je nach den verschiedenen Arten von Tugend. Unter den als „weltliche Tugenden“ bezeichneten können wir zwei Arten erkennen:
- Tugenden, die sich auf die Vernunft beziehen, die dianoëtischen oder intellektuellen Tugenden (areté dianoethiké), wie Weisheit, Intelligenz und Klugheit. Durch solche intellektuellen Tugenden „entsteht und wächst die erstere hauptsächlich durch Belehrung und bedarf deshalb der Erfahrung und der Zeit“104.
- Die Tugendethik (aretaī ethikaī)105 ist „ein lobenswerter Habitus“106; Gewohnheit und bewusstes Bemühen führen schließlich zur Ausformung einer erworbenen Disposition. Aristoteles erhellt diesen Punkt, indem er das Beispiel von Mäßigung und Mut heranzieht:
Durch die Enthaltung von sinnlichen Genüssen werden wir mäßig, und sind wir es geworden, so können wir uns ihrer am besten enthalten. Desgleichen mit dem Mute: indem wir uns gewöhnen, Gefahren zu verachten und zu bestehen, werden wir mutig, und sind wir es geworden, werden wir am leichtesten Gefahren bestehen können.107
Wir verdanken Aristoteles die Einsicht, dass moralische Vortrefflichkeit „mit Vergnügen und Schmerzen“ verbunden ist:
Der Lust wegen tun wir ja das sittlich Schlechte, und der Unlust wegen unterlassen wir das Gute. Darum muß man, wie Platon sagt, von der ersten Kindheit an einigermaßen dazu angeleitet worden sein, über dasjenige Lust und Unlust zu empfinden, worüber man soll. Denn das ist rechte Erziehung.108
Der Gedanke, dass Tugend von frühester Kindheit an geübt und kultiviert werden sollte109, so dass sie eine feste Haltung wird, ein Teil des „Charakters“, ist in völliger Übereinstimmung mit der Bahā’ī-Schrift. Bahā’u’llāh hat verordnet:
Schulen müssen die Kinder zuerst in den Grundsätzen der Religion erziehen, so daß Verheißung und Drohung, wie sie in den Büchern Gottes geschrieben stehen, die Kinder von Verbotenem abhalten und sie mit dem Mantel der Gebote schmücken …110
‘Abdu’l-Bahā betont, dass die moralische Erziehung der Kinder „von frühester Kindheit an“111 beginnen sollte, denn „wenn der Zweig grün und zart ist, wird er in jede vorgegebene Richtung wachsen“112, während es äusserst schwierig ist, „nach der Pubertät den Menschen zu lehren und seinen Charakter zu verbessern“113.
Nur zu einem geringen Ausmaß können Menschen, wenn sie das Erwachsenenalter erreicht haben, durch Überredung oder rationale Argumente tugendhaft werden. Diejenigen, die nur „der Leidenschaft leben“ und nur an ihren Vergnügungen interessiert sind, haben „nicht einmal einen Begriff“ davon, was das sittlich Schöne und die wahre Freude sind, „da sie es nicht gekostet“ haben. Aristoteles bemerkt hierzu114:
Welche Rede sollte nun solche Menschen bekehren? Es ist ja nicht möglich oder doch sehr schwer, durch das Wort alteingewurzelte Gewohnheiten abzustellen.115
Deshalb muss die Seele des Hörers
… wie die zur Aufnahme des Samens bestimmte Erde zuvor durch Gewöhnung kultiviert worden sein, um recht zu lieben und zu hassen. Denn es würde einer auf das warnende Wort nicht hören, ja, es nicht einmal verstehen, wenn er der Leidenschaft nachlebt; und wie ist es dann möglich, ihn durch Worte anderen Sinnes zu machen? Überhaupt kann man sagen, daß gegen die Leidenschaft das Wort nichts ausrichtet, sondern nur die Gewalt. Demnach muß ein der Tugend verwandter Sinn, der das sittlich Schöne liebt und das Häßliche verabscheut, schon in gewisser Weise vorhanden sein.116
Jedoch ist auch die Tugend – „Tugend ist also die moralische Stärke des Willens eines Menschen in Befolgung seiner Pflicht“117 –, nachdem sie erreicht ist, noch zerbrechlich und gefährdet. Daher muss sie ständig erneuert werden, wie Kant sagt:
Die Tugend ist immer im Fortschreiten und hebt doch auch immer von vorne an. – Das erste folgt daraus, weil sie, objektiv betrachtet, ein Ideal und unerreichbar, gleichwohl aber sich ihm beständig zu nähern dennoch Pflicht ist. Das zweite gründet sich, subjektiv, auf der mit Neigungen affizierten Natur des Menschen, unter deren Einfluß die Tugend, mit ihren einmal für allemal genommenen Maximen, niemals sich in Ruhe und Stillstand setzen kann, sondern, wenn sie nicht im Steigen ist, unvermeidlich sinkt.118
Daher ist ständige und bewusste Anstrengung nötig, um die Tugend in die Praxis umzusetzen.119
Die Natur der Tugendethik wurde von Aristoteles analysiert. Tugenden und Laster sind weder Leidenschaften noch Fähigkeiten, sondern vielmehr Dispositionen, „ein Habitus“120. Die Charaktertugend hat es zu tun „mit den Affekten und Handlungen …, bei denen es eben ein Übermaß, einen Mangel und ein Mittleres gibt“121. Übermaß und Mangel sind „eine Form von Scheitern“, dagegen ist die Mitte „das Beste, und das ist die Leistung der Tugend … Mithin ist die Tugend eine Mitte, da es ihr wesentlich ist, nach dem Mittleren zu zielen“122. Mit anderen Worten liegt die Mitte „zwischen zwei Lastern“123, „dem Fehler des Übermaßes und des Mangels“; sie ist „durch die Vernunft bestimmt“124. Daher gibt es für jede Tugend mindestens zwei Laster, denn:
Es ist leicht, das Ziel zu verfehlen, aber schwer, es zu treffen … Nur eine Weise kennt die Tugend, doch viele das Laster.125
Daher sagt Thomas von Aquin, „das Gute kommt nur in einer einzigen Weise vor, das Böse aber vielfältig“126.
3. Tugend: Ein Mittel und ein mühselig zu erlangendes Gut
Aristoteles lässt keinen Zweifel daran, dass Tugend, als Mitte127 definiert, nicht mit Mediokrität gleichgesetzt werden darf:
Deshalb ist die Tugend nach ihrer Substanz und ihrem Wesensbegriff Mitte; insofern sie aber das Beste ist und alles gut ausführt, ist sie Äußerstes und Ende.128
Er betont, dass es keine leichte Aufgabe ist, gut zu sein. Denn in allem ist es nicht einfach, die Mitte zu finden.
Dieser Gedanke findet sich wieder bei Kant. Er nennt Tugend „ideal und unerreichbar“129. Die Mitte ist ein Ziel, das schwer zu erreichen, aber leicht zu verfehlen ist, wie Aristoteles meint:
So kann z. B. nicht ein jeder den Mittelpunkt eines Kreises finden, sondern nur der Wissende. So ist es auch jedermanns Sache und ein Leichtes, zornig zu werden und Geld zu verschenken und zu verzehren. Aber das Geld zu geben, wem man soll und wie viel man soll, und wann und weswegen und wie, das ist nicht jedermanns Sache und nicht leicht.130
Die Tugend wurde bonum arduum (ein „schwieriges Gutes“, etwas, das Anstrengung benötigt) genannt, eine ultimum potentiae131. „Darum ist das Gute auch so selten, so lobenswert und so schön“.132 Der Pfad der Tugend ist steil: Nulla nisi ardua virtus133 – ist ein immer wiederkehrender Gedanke in der klassischen antiken Literatur, zum Beispiel bei Hesiod:
Vor das Gedeihen jedoch haben die ewigen Götter den Schweiß gesetzt. Lang und steil ist der Pfad dorthin und schwer zu gehen am Anfang.134
4. Über die Gelassenheit des Herzens
Der Kampf um die Selbstkontrolle und -disziplin wird nie gewonnen. Viele Gefahren lauern auf dem Weg. Deshalb soll man, wie Kant es ausdrückt, „wackeren und fröhlichen Gemüts (animus strenuus et hilaris)“ sein „in Befolgung ihrer Pflichten“135. Die göttlichen Gebote sollten nicht sklavisch befolgt werden, sondern mit heiterem, ja frohem Herzen, wie es in der Bibel heißt:
… Wenn ihr fastet, sollt ihr nicht sauer sehen wie die Heuchler; denn sie verstellen ihr Angesicht …136
Die Erfahrung zeigt, dass ein „kühner Geist“ sich in einen Sklaven verwandeln kann, in einen Tyrannen der Tugend, so dass die Beachtung der Tugenden den Charakter eines „Frondienstes“ annimmt. Dies ist eine Perversion der Tugend. Kant betont, dass die moralischen Pflichten nicht freudlos, „finster und mürrisch“137 befolgt werden sollten, sondern mit einem „jederzeit fröhlichen Herz“138:
Denn wer sollte wohl mehr Ursache haben, frohen Muts zu sein und nicht darin selbst eine Pflicht finden, sich in eine fröhliche Gemütsstimmung zu versetzen und sie sich habituell zu machen, als der, welcher sich keiner vorsätzlichen Übertretung bewußt und, wegen des Verfalls in eine solche, gesichert ist … Was man aber nicht mit Lust, sondern bloß als Frondienst tut, das hat für den, der hierin seiner Pflicht gehorcht, keinen inneren Wert und wird nicht geliebt, sondern die Gelegenheit ihrer Ausübung so viel möglich geflohen … [wodurch sie] die Tugend selbst verhaßt macht und ihre Anhänger verjagt. Die Zucht (Disziplin), die der Mensch an sich selbst verübt, kann daher nur durch den Frohsinn, der sie begleitet, verdienstlich und exemplarisch werden.139
Kants Urteil ist gut begründet. Die Religionsgeschichte legt hinreichend Zeugnis dafür ab, dass es in allen Religionen eine gnostische Tendenz gibt, die Welt zu verneinen, zu exzessivem Asketentum140, zu einem freudlosen Leben auf Erden141 und zu bigottem Puritanismus, der auf die Kasteiung des Fleisches zielt.142 Im Laufe der Zeit kam es unter dem Einfluss neoplatonischer Spekulationen sogar im Islam zu freudlosem Asketizismus mit einer Geringschätzung aller irdischen Dinge.143
Solche Verzerrungen resultieren aus einem fundamentalen Missverständnis der göttlichen Botschaft, die immer eine „frohe Botschaft“144 war, wie es aus Bibel und Qur’ān deutlich wird:
… die Freude am Herrn ist eure Stärke.145
… zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist, und dir, Gott, auf der Harfe danke, mein Gott.146
Dem Gerechten muß das Licht immer wieder aufgehen und Freude den frommen Herzen.147
Dient dem Herrn mit Freuden; kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken!148
Die Erlösten des Herrn werden wiederkommen und gen Zion kommen mit Jauchzen; ewige Freude wird über ihrem Haupte sein; Freude und Wonne werden sie ergreifen, und Schmerz und Seufzen wird entfliehen.149
Dein Wort ward mir Speise, da ich’s empfing; und dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost …150
Und du wirst des Freude und Wonne haben …151
Und ihr habt auch nun Traurigkeit; aber ich will euch wiedersehen, und euer Herz soll sich freuen, und eure Freude soll niemand von euch nehmen.152
Wir sandten dich mit der Wahrheit als Freudenboten [bashīr].153
Und Gott machte es nur deswegen, damit es eine Frohbotschaft [bushrā] sei und damit eure Herzen dadurch Ruhe finden.154
Nach Paulus ist Freude eine „Frucht des Geistes“155. Thomas von Aquin hat der Freude eine ganze Quaestio über die „geistige Freude, die aus der Liebe Gottes geboren wird“156, gewidmet.
So jemand unter dem Eindruck steht, dass die Bahā’ī-Ethik nichts ist als strikte Pflichterfüllung unter dem „Joch des Gesetzes“, einem Ethos der Freudlosigkeit157, dass das Bahā’ī-Leben ein Leben in „Sack und Asche“158 ist, wird beglückt feststellen, dass Bahā’u’llāh oft über die Bedeutung der Freude spricht. Der Mensch wurde erschaffen für Freude und ewige Glückseligkeit:
Frohlocke vor Herzensfreude …159
Mit der freudigen Botschaft des Lichtes grüße Ich dich: Freue dich!160
Der Geist der Heiligkeit bringt dir die frohe Botschaft der Wiedervereinigung. Warum bist du traurig?161
Bahā’u’llāh nannte seine Offenbarung „Frohe Botschaft“ (Bishārāt)162, „die größte, die froheste Botschaft“163 für die Menschheit. Denjenigen, die sich Gott unterworfen haben und dem Pfad seiner Gebote folgen, versichert Bahā’u’llāh:
An diesem Tag feiert das Reich der Höhe ein großes Fest; denn was verheißen war in den heiligen Schriften, ist nun erfüllt. Heute ist der Tag großen Frohlockens. Jeder sollte, voller Freude und Frohsinn, in Lust und Wonne zum Hofe Seiner Nähe eilen und sich vom Feuer der Ferne befreien.164
Grämt euch nicht, wenn Gott in diesen Tagen und auf diesem Erdenrund Dinge verordnet und verkündet, die euren Wünschen zuwiderlaufen, denn Tage seliger Freude und himmlischen Entzückens stehen euch sicherlich bevor. Welten, heilig und voll geistiger Herrlichkeit, werden vor euren Augen enthüllt werden. Ihr seid von Ihm ausersehen, in dieser Welt und in der kommenden ihre Wohltaten und Freuden zu genießen und einen Anteil ihrer stärkenden Gnade zu empfangen.165
Die künftige Welt ist grundsätzlich eine Welt der „Freude und Fröhlichkeit“ für den Anhänger des „einen, wahren Gottes“. Er wird, „wenn er aus diesem Leben scheidet, unbeschreibliche Freude und Fröhlichkeit empfinden …, die nichts übertreffen kann“166.
Freude ist nicht nur ein göttliches Versprechen für jene, die sich dem Willen Gottes ergeben haben, vielmehr sollte die Freude in allen täglichen Verrichtungen zum Ausdruck kommen. Die Gläubigen sind aufgerufen, sich mit den Anhängern aller Religionen „in strahlender Freude“ (rawḥ wa rayḥān)167 zu vereinigen. Der Mensch sollte nicht griesgrämig und mürrisch in die Welt schauen, sondern „laß dein Antlitz Freude ausstrahlen“168:
… und frohen, lichtstrahlenden Angesichts gesellt euch zu eurem Nächsten.169
Heiterkeit und Gelassenheit sollten die Gläubigen ausstrahlen, in den Worten ‘Abdu’l-Bahās:
… ihren Glauben im täglichen Leben zeigen sollen, so daß die Welt das Licht in ihren Augen strahlen sieht. Ein strahlendes und glückliches Gesicht spornt die Menschen an.170
Mit Herzen, die vom Feuer der Gottesliebe erleuchtet sind, und vom göttlichen Geist genährt, sollt ihr vorwärtsschreiten wie die Jünger vor tausendneunhundert Jahren, um die Herzen der Menschen zu erquicken durch den Ruf der frohen Botschaft, das Licht Gottes auf euren Gesichtern, von allem losgelöst außer Gott… Die Liebe und das Licht des Königreiches sollen durch den Widerschein alle erleuchten, die auf euch schauen.171
Ich möchte, daß ihr glücklich seid…, daß ihr lacht und frohlockt, so daß andere durch euch glücklich werden.172
Die Bedeutung von Freude und Glück erkennt man auch aus ‘Abdu’l-Bahās Bemerkung über unsere Haltung, wenn wir die Botschaft Gottes verkünden. Eine der wichtigsten Voraussetzungen dessen, der lehrt, ist „die Freude, die sich im Antlitz dessen widerspiegelt, der die Lehren darlegt“173.
Die Bahā’ī-Schrift enthält die immer wiederkehrende Ermahnung, die moralischen und rituellen Pflichten „in strahlender Freude“ (rawḥ wa rayḥān) auszuüben:
Dies sind die Gesetze [ḥudūd], die Gott euch gibt, dies sind Seine Gebote [awāmir], die euch auf Seiner Heiligen Tafel gegeben sind. Gehorchet ihnen in Freude und Heiterkeit, denn dies ist das Beste für euch, o daß ihr es doch wüßtet!174
Tatsächlich hängt die göttliche Annahme ganz von dem „Geist der Freude, Zusammengehörigkeit und Zufriedenheit“175 ab, von „höchster Freude und Wonne“176, mit der die Ḥuqūqu’llāh (die „Rechte Gottes“) von den Gläubigen erbracht werden.177 Sogar das Gebot, „die Verse Gottes jeden Morgen und jeden Abend“178 zu rezitieren, ist von der Ermutigung begleitet, diese wichtige Pflicht mit Maß auszuführen179:
Rühmt euch nicht der langen Schriftlektüre und vieler frommer Handlungen bei Tag und Nacht. So jemand einen einzigen Vers in Freude und Heiterkeit liest, ist es besser für ihn, als wenn er ermüdet alle Bücher Gottes liest, des Helfers in Gefahr, des Selbstbestehenden. Lest Gottes Verse in solchem Maße, daß nicht Schwäche und Verzagtheit euch überkommen. Bürdet euren Seelen nicht auf, was sie ermattet und niederdrückt, sondern gebt ihnen, was sie erleichtert und emporhebt, so daß sie sich auf den Flügeln der Verse Gottes aufschwingen zum Dämmerort Seiner offenbaren Zeichen. Dies wird euch Gott näherbringen, wenn ihr es nur begriffet.180
So ist es klar, dass Quelle und Ziel unserer Freude Gott ist. Das Königreich Gottes ist „Gerechtigkeit und Friede und Freude in dem heiligen Geiste“181. Die Herzensfreude stellt sich erst allmählich ein, zusammen mit der Liebe, über deren Wachstum Paulus feststellt:
… Ich meine aber das: Wer da kärglich sät, der wird auch kärglich ernten; und wer da sät im Segen, der wird auch ernten im Segen.182
Aber was sollen wir Freude nennen? Wenn wir, wie es heißt, in einer Welt des „freudlosen Vergnügens“183 leben, so kann die Freude nicht die Art von „Fun“ sein, die aus „schalen Vergnügungen“184 entsteht, auch nicht aus dem überschäumenden Jubel oder dem Ausbruch kollektiver, exzessiver Begeisterung, der ausbricht, wenn ein Ziel erreicht ist, oder die Gruppenekstase, die das Publikum bei Rap- und Rave-Konzerten ergreift.
5. Über Humor und Lachen
Freude, die auch Humor, Lachen und die Fähigkeit zur Selbstironie185 umfasst, ist ein geistiger Zustand, eine Art innerer Friede jener, die sich dem Willen Gottes ergeben haben. Da sie ihren Ursprung im Glauben und der Gottesliebe hat, setzt die Freude des Menschen kreative Kräfte in allen seinen Aktivitäten frei. Dies trifft im besonderen auf die Künste zu. Es ist schwierig, sich freudigere oder erhebendere Musik vorzustellen als die, die „zum Ruhme Gottes und zur Erhebung der Seele“ (ad gloriam Dei et recreationem animae) geschrieben ist, wie Johann Sebastian Bach den Zweck der Musik definierte.186 Wenn das Ziel aller Ethik das Glück ist, dann muss der Pfad der Tugend in einem Geist der Freude und Heiterkeit beschritten werden: oder, wie Kant sagt, „wackeren und fröhlichen Gemüts“187.
Eine andere Dimension des Humors ist die Fähigkeit, heiter zu sein, wenn das Leben schwierig wird. Der Philosoph André Comte-Sponville behandelt den Humor als eine der Tugenden, und er widmet ihm ein fesselndes Kapitel.188 Wir mögen uns fragen, ob Humor eine genuine Tugend ist. Nach Comte- Sponville besteht kein Zweifel daran, dass ein Sinn für Humor, der Liebe zum Leben zum Ausdruck bringt, dessen Kompliziertheit versteht (und darüber hinaus akzeptiert, dass sie manchmal unerfreulich ist)189, zweifellos „eine großartige Eigenschaft, eine wertvolle Eigenschaft“190 ist. Denn in Comte-Sponvilles Worten lässt der Humor die Fähigkeit zur Selbstdistanz und Selbstrelativierung erkennen:
Sie [die Tugend] kann einem edlen Menschen zwar fehlen, doch das würde unsere Achtung für ihn selbst in moralischer Hinsicht ein wenig beeinträchtigen. Ein Heiliger ohne Humor ist ein trauriger Heiliger. Und ein Weiser ohne Humor, ist das überhaupt ein Weiser? … Was wäre die Liebe ohne Freude? Was wäre die Freude ohne Humor?191
Dem Humorlosen mangelt es an Demut, an klarem Verstand, an Leichtigkeit, er ist zu sehr von sich selbst eingenommen, fällt auf sich selbst herein, ist zu streng oder zu aggressiv und läßt es daher fast immer an Großherzigkeit, an Sanftmut, an Barmherzigkeit fehlen. Zuviel Ernsthaftigkeit hat, selbst bei der Tugend, etwas Verdächtiges und Beunruhigendes: Da muß doch irgendeine Illusion oder irgendein Fanatismus mitspielen! Tugend, die von sich selbst überzeugt ist, läßt es an Tugend fehlen.192
Und er stellt richtig fest: „Wenn der Humor sich selbst treu ist, dann führt er vielmehr zur Demut“193. Denn derjenige, der sich mit Humor beurteilen kann, tut das sozusagen von aussen, und hat so eine klarere Sicht auf seine Stärken und Schwächen. In einem bemerkenswerten Abschnitt über „Der lachende Heilige“ schreibt Jack McLean in seinem Buch Under the Divine Lote Tree:
Wahre Heilige haben gelernt, über sich selbst zu lachen, und diese Fähigkeit ist, wie ich denke, eine der tiefsten Wurzeln der Psychologie des Humors. Diese Heiligen sind glücklich, weil sie gelernt haben, über die Dinge zu lachen, die ihnen unter anderen Umständen Peinlichkeiten oder Schmerz bereitet hätten. Man muß selbstsicher sein, um über sich lachen zu können. Der unsichere Mensch fühlt sich durch einen Scherz immer verletzt, wenn jemand sich über ihn oder andere lustig macht, denn er glaubt fälschlicherweise, daß mißbilligendes Lachen Erniedrigung bedeutet … Der lachende Heilige weiß, wie William Sears vor Jahren schrieb, „Gott liebt Lachen“194 … Der lachende Heilige erkennt in diesen drei Worten eine andere Tür zu Selbsttranszendenz und Befreiung.195
‘Abdu’l-Bahā, das wahre Beispiel für alle Bahā’ī-Eigenschaften, war bekannt für seinen „ausgeprägten Sinn für Humor“196, selbst während der Jahre im Gefängnis und in Zeiten von Drangsal:
Freude, so sagte er ihnen [seinen Gästen], ist nicht ein Nebenprodukt von Wohlstand und materiellem Überfluß. Denn sonst hätte Niedergeschlagenheit jede Stunde ihres Lebens in jenen Tagen bestimmt; in Wirklichkeit waren ihre Seelen voller Freude.197
Er sagte, Lachen „ist geistige Entspannung“198:
Mein Haus ist das Heim der Freude und des Frohsinns.199
Daher sind die Tugenden des Menschen seine emotionalen und kognitiven Fähigkeiten und Kräfte, das moralisch Gute zu erlangen. Tugend zu haben bedeutet, dass man nicht Spielball seiner Emotionen und Leidenschaften ist, sondern ihr Herr.
4. Über den Begriff „Charakter“
Charakter, die Übersetzung von akhlāq, ist ein Begriff, der sehr häufig in der Schrift vorkommt. Er kommt vom Griechischen „charāssein“, eingraben, einritzen. Charakter ist das sittliche Gepräge eines Menschen, die Gesamtheit der Wesensart, die in seine Seele (nafs al-naṭiqa) eingeritzt ist. Intelligenz, Temperament und Begabungen werden zu einem großen Teil durch seine Erbanlagen und die Art seiner Sozialisation bestimmt. Der ethische Charakterbegriff ist durch die normgemäße oder normwidrige gewohnheitsmäßige Ausrichtung des Willens bedingt.
Der ideale Charakter ist kein Naturprodukt; er ist, wie die Tugenden, nicht angeboren, sondern erworben: er ist eine konstante lebenslange Herausforderung. Die Charakterbildung ist das eigentliche Ziel jeder Erziehung und Selbsterziehung: sie ist eine ständige, lebenslange Herausforderung. Die Charakterbildung orientiert sich am Idealbild des Menschen – in der Bahā’ī-Ethik am normativen Menschenbild Bahā’u’llāhs.200 Der Charakter entsteht vornehmlich durch die Entwicklung der Gesinnung, des Gewissens, des Willens und weiterer grundlegender Eigenschaften. Charakterbildung ist mehr als nur die Entwicklung einzelner guter Eigenschaften; sie ist ganzheitliche Gestaltung der Persönlichkeit. So zielt die Bahā’ī-Ethik letztlich nicht auf einzelne, herausragende Taten, „gute Werke“, sondern auf eine gute Lebensführung. Charakterbildung beruht auf der Zügelung der Affekte, Triebe und Leidenschaften, auf dem Ansporn zur Willensstärke sowie auf der Beharrlichkeit im richtigen Handeln. Dies macht individuelle psychische Eigenart eines Menschen aus.
Tugenden ermöglichen es dem Menschen, seinen Lastern zu widerstehen, die die menschliche Natur verderben und zerstören. Tugenden zu erwerben bedeutet also, einen starken Charakter zu entwickeln. Der Charakter ist die Summe dieser besonderen Tugenden oder Laster, die den Menschen prägen. Der Lobpreis eines heiligen, rühmlichen und aufrechten Charakters ist ein häufig wiederkehrendes Thema in der Schrift201:
[Schmückt] euch mit dem Schmuck eines guten und lobenswerten Charakters …202
Das Schwert der Tugend und des rechten Tuns ist schärfer als Klingen aus Stahl.203
Ein guter Charakter ist wahrlich der beste Mantel Gottes für die Menschen … Das Licht eines guten Charakters überstrahlt die Sonne und ihren Glanz. Wer ihn erlangt, gilt als Juwel unter den Menschen.204
In den Augen Gottes, Seiner Erwählten und aller Einsichtsvollen ist ein guter Charakter das Erhabenste und Lobenswerteste, was es gibt, jedoch immer unter der Voraussetzung, daß die Quelle seiner Ausstrahlung Vernunft und Erkenntnis sind, und daß er wahre Mäßigung zur Grundlage hat.205
Jedoch ist der Charakter als eine fundamentale Prägung des Menschen immer wieder mit dem Ruf zu moralischem Handeln verbunden.206 Beide sind erforderlich für rechtes Sein und rechtes Tun: „wahre Tugend und makellos reine Werke“207; „reinste Tugend und makellose, heilige Taten“208:
Die Früchte am Baume des Menschen aber sind seit jeher edle Taten und ein vortrefflicher Charakter.209
In dieser Offenbarung sind die Heerscharen, die sie zum Siege führen können, rühmliche Taten und ein aufrechter Charakter. Anführer und Befehlshaber dieser Heerscharen ist seit je die Gottesfurcht …210
Immer wieder werden die Gläubigen ermahnt zu einem „aufrechten, rühmlichen Charakter“211, zu „schickliche(s)m, rühmliche(s)m Verhalten“212, „gerechte[n] Taten“213, „gute[n] Werke[n]“214, „reine(n) und heilige(n) Taten“215, und „ein Leben der Tugend und … edles Betragen“216 an den Tag zu legen:
Die Absicht des einen, wahren Gottes bei Seiner Selbstoffenbarung ist, die ganze Menschheit zu Wahrhaftigkeit und Aufrichtigkeit, zu Frömmigkeit und Vertrauenswürdigkeit, zu Entsagung und Ergebenheit in den Willen Gottes, zu Nachsicht und Güte, zu Ehrlichkeit und Weisheit aufzurufen. Sein Ziel ist es, jeden Menschen in den Mantel eines geheiligten Charakters zu kleiden und ihn mit der Zier heiliger, edler Taten zu schmücken.217
5. Die Moralordnung
Obwohl das Feld der Tugend weit ist, entzieht sich Tugend, wie wiederholt betont wurde218, einer strengen Einteilung; die Tugenden dürfen nicht als reine Ansammlung moralischer Werte angesehen werden. Sie stehen nicht einzeln nebeneinander, sondern stehen in komplexer und unzertrennlicher Beziehung zueinander. Sie bedingen, unterstützen und begrenzen einander219, und es ist die ständige Aufgabe derer, die entsprechend dieser Werte leben, darauf zu achten, dass diese harmonische Ordnung nicht durch verzerrte Betonung gefährdet wird. Wie Platon lehrte, ist eine Balance der Tugenden entscheidend für ein gutes und glückliches Leben.
Die einzelnen Tugenden haben ohne Zweifel einen unterschiedlichen Rang. Manche sind wesentlich, weswegen sie in der Schrift besonders betont sind (wie beispielsweise Standhaftigkeit im Bund, Wahrhaftigkeit, Gerechtigkeit); andere stehen mehr am Rand der hierarchischen Ordnung und sind deshalb nachrangig. Diese Ordnung ist jedoch keineswegs ein geschlossenes System. Bahā’u’llāh hat keine logische Hierarchie offenbart. Seine Aufzählung der Tugenden ist beispielhaft, niemals vollständig, und sie variiert. Die besondere Ehre, die Bahā’u’llāh solchen Tugenden wie „Gerechtigkeit“ (inṣāf) zollt, die er „von allem das Meistgeliebte“220 nannte, „die grundlegende menschliche Tugend“221, das „Wesen all dessen, was Wir für dich offenbarten“222, oder „Höflichkeit“, der er den Titel „die Fürstin der Tugenden“223 verleiht, ist eine besondere Akzentuierung, die nicht verabsolutiert, sondern hermeneutisch interpretiert werden muss. Bahā’u’llāhs Aussagen z. B. zur Gerechtigkeit beziehen sich auf die Kategorie der „weltlichen Tugenden“. Sie bestätigen die philosophische Tradition von Platon, Aristoteles und Thomas von Aquin, die der Gerechtigkeit den Vorrang vor allen anderen (weltlichen)224 Tugenden beimessen. Verabsolutiert man den hohen Lobpreis, den Bahā’u’llāh der Gerechtigkeit zollt, und wendet sie auf die Tugenden in ihrer Gesamtheit an, so gerät man unvermeidlich in Aporien225, weil Tugenden anderer Kategorien gelegentlich ähnlich betont werden, wie zum Beispiel „Standhaftigkeit in Seiner Sache“,226 die nach unserem Schema zu den theozentrischen Tugenden gehört.
Dass die Tugenden hierarchisch geordnet sind, ist in der Schrift eindeutig belegt. Bahā’u’llāh räumt den „höchsten Rang“227 den theozentrischen Tugenden ein, alle anderen „sind zweitrangig, diesen nachgeordnet“228. Dies sollte nicht als rigide, unflexible Regel oder als Maßstab angesehen werden. Vielmehr sind sie Dispositionen des Charakters, der seinen Ausdruck in konkreten Situationen und in einem besonderen Kontext findet, entsprechend der eigenen Vernunft und Kapazität.
6. Die Gebote
1. Wie schon früher ausgeführt wurde229, enthält die Schrift drei verschiedene Arten von Normen: Rechtsnormen, Moralgesetze und Vorschriften, die die Anbetung betreffen. Dies entspricht der klassischen Kategorisierung von Judizialgesetz, Zeremonialgesetz, Moralgesetz230, die zurückgeht auf den jüdischen Philosophen Moses Maimonides. In Bahā’u’llāhs Schrift begegnen wir häufig der Formel „Gesetze und Gebote“231, die offensichtlich die Ganzheit der Normen, die das Buch Gottes enthält, umfasst.232 Es erhebt sich die Frage, zu welcher der drei entsprechenden Kategorien die „Gesetze“ gehören und zu welcher die „Gebote“, und wie die arabischen Begriffe zur Bezeichnung von Normen ‘ibādāt233, sharī‘a234, ḥudūd235, awāmir236, aḥkām237 und sunan238 in die Trias der Kategorien und die doppelte Formel „Gesetze und Gebote“ passen.
Es war mir nicht möglich herauszufinden, ob schon eine terminologische Klarstellung unternommen wurde. Es scheint, dass in Bezug auf die oben erwähnte Trias die „Gesetze“ alle Vorschriften im Sinne von Judizialgesetz sowie auch die Normen von ‘ibādāt (Zeremonialgesetz) enthalten, während die „Gebote die moralischen Vorschriften wie auch die Warnungen und Mahnungen“ umfassen.239
Was die arabischen Begriffe betrifft, die der Formulierung „Gesetze und Gebote“ zugrunde liegen, die Shoghi Effendi genial prägte, war es mir nicht möglich, eine klare Systematik zu erkennen.240
2. Das Schrifttum Bahā’u’llāhs kennt keine Tafeln oder Verzeichnisse, in denen die Gebote und Verbote Gottes aufgezählt sind, also keine Zählung der Gebote wie der Dekalog des Alten Testaments oder der Katalog der 613 Ge- und Verbotsnormen des nachexilischen Judentums241, die alle Normbereiche (Ethik, Kult und Recht) umfassen. Die moralischen Gebote sind im Gegenteil neben Rechts- und Ritualgeboten ohne sichtbare Ordnung in den Text gestreut. Auch dem Kitāb-i-Aqdas, der die meisten normativen Bestimmungen enthält, ist, wie bereits früher ausgeführt242, eine logisch- systematische Ordnung fremd. Dass einzelne Bestimmungen sowohl Gebote des Rechts als auch der Moral sein können, wurde bereits in anderem Zusammenhang erwähnt.243
Dem Verfasser einer Einführung in die Bahā’ī-Ethik stellt sich die methodische Frage, wie er die uneinheitlich gestalteten Gebote und Verbotsnormen darstellen soll, die eine solche Formenvielfalt vorweisen. Eine Möglichkeit wäre ein nach systematischen Gesichtspunkten geordnetes Verzeichnis dieser Normen mit entsprechenden Erläuterungen. Ich ziehe es vor, die Handlungsgebote jeweils im Zusammenhang mit den Werten, den Tugenden, darzustellen244, denen man diese Gebote zuordnen kann. Das zu entscheiden, mag gelegentlich schwierig sein, weil dies keineswegs immer eindeutig ist, und nicht immer findet sich ein Tugendwert, dem ein bestimmtes Handlungsgebot oder -verbot entspricht. Der Leser sollte bedenken, dass eine erschöpfende Abhandlung über die Gebote und die Tugenden nicht beabsichtigt und zumindest derzeit nicht möglich ist.
2 Aristoteles, Nikomachische Ethik 1103b (25)
3 Der Qur’an stellt die einzelnen Tugenden und Laster häufig als Aspekte des menschlichen Verhaltens dar, wobei jedes charakterisiert ist als Gott gefällig oder Gott zuwider. So begegnen wir Aussprüchen wie:
Gott liebt
„die Gutes tun“ (2:195; 3:134, 148; 5:13, 93), „die Gottesfürchtigen“ (3:76; 9:4), „die Standhaften“ (3:146), „die gerecht handeln“ (5:42; 49:9; 60:8), „die auf Gott vertrauen“ (7:89), „die, die sich reinigen“ (2:222; 9:108), „die auf seinem Weg kämpfen“ (61:4), „die Bußfertigen“ (2:222), „die gerecht handeln“ (5:42).
Gott liebt nicht:
„die Ungläubigen“ (3:32; 30:45), die „Schändliches“ tun (3:135; 42:40), „die Übertretungen begehen“ (2:190; 5:8,7:55), die „Unheil“ stiften (2:205; 5:64), „die Unheilstifter“ (28:77), „die sich hochmütig zeigen“ (16:23), „die eingebildet und prahlerisch sind“ (4:36; 31:18; 57:23), „die Verräter“ (8:58), „Betrüger“ (4:107), „keinen undankbaren Treulosen“ (22:38), „daß jemand über das Böse öffentlich redet“ (4:148), „die geizen“ (4:37), die „das Schändliche“ tun (24:19), „die jubeln“ (28:70).
„Gott liebt keinen, der sehr ungläubig und sündig ist“ (2:276).
4 Hartmann, Ethik, S. 148
5 Siehe Schaefer, Ethische Aspekte der Schrift, Bd. 1, Kap. 5, Abschnitt 4
6 Hartmann, Ethik, S. 148
7 Siehe Bahā’u’llāh, Ährenlese 137:4
8 Agere sequitur esse: „Das Handeln folgt dem Sein“ – ein Prinzip der scholastischen Philosophie.
9 Pieper, Viergespann, S. 227
10 Selbst wenn dies nicht so formuliert ist, wie zum Beispiel in dem Vers „aus Scham scheuen Wir Uns, das Thema der Knaben zu behandeln“ (Bahā’u’llāh, Kitābi-Aqdas 107). Hier bezieht Bahā’u’llāh sich auf eine Form der Päderastie (ghilmān), die in Iran und auch in anderen orientalischen Ländern und im alten Griechenland praktiziert wurde. Diese Formulierung drückt Scham für ein solches Verhalten viel deutlicher aus als ein ausdrückliches Verbot.
11 Vom griech. to déon, das, was bindend ist, die Theorie der Pflicht, eine moralische Verpflichtung. Dieser Begriff wurde von Bentham, Deontology or the Science of Morality, 1834, eingeführt.
12 Thomas von Aquin bezieht sich auf diese Strukturen, nachdem er festgestellt hatte, dass es der Inbegriff der Tugend ist, Gutes zu tun und das Übel zu meiden: „Sed ad faciendum bonum inducimur per praescripta affirmativa, ad declinandum a malo per praescripta negativa“ („Zum Tun des Guten aber werden wir angeleitet durch positive Gebote, zum Unterlassen des Bösen durch die Verbote“) (Summa theologica II-II, q. 44, a3).
13 Plural von ḥadd = göttliches Gebot, göttliches Gesetz, göttliche Verfügung; Strafe
14 Plural von ḥukm = Urteil; Entscheidung; Verdikt; Verurteilung; Verdammung, Überzeugung; Rechtsprechung; rechtliche Konsequenz eines Falles; Einsicht, Weisheit; Befehl; Macht; Regierung.
15 Plural von amr = Befehl, Instruktion, Herrschaft; Gesetz, Beschluss, Macht, Autorität
16 heiliges Gesetz; siehe ‘Abdu’l-Bahā, Testament 1:3; 2:8, 15; 3:10
17 Er schreibt: „Man kann diesen Widerspruch auch dadurch ins Licht stellen: dass man zeigt, der Verbindende (auctor obligationis) könne den Verbundenen (subiectum obligationis) jederzeit von der Verbindlichkeit (terminus obligationis) lossprechen; mithin (wenn beide ein und dasselbe Subjekt sind), er sei an eine Pflicht, die er sich auferlegt, gar nicht gebunden: welches einen Widerspruch enthält“ (Kant, Metaphysik der Sitten I, § 1 „Der Begriff einer Pflicht gegen sich selbst, S. 549 [A 63]).
18 Ibid., § 3, S. 550, Fußnote (A 65). Kant sagt, „der erste Grundsatz der Pflicht gegen sich selbst liegt in dem Spruch: lebe der Natur gemäß“ (naturae convenienter vive), d. h. erhalte dich in der Vollkommenheit deiner Natur. Der zweite Satz: „Mache dich vollkommner, als die bloße Natur dich schuf“ (perfice te ut finem) (ibid., S. 552).
19 Metaphysik der Sitten, § 19, S. 580 (A 110, 111)
20 Von ẓalama: unrechttun, unterdrücken, ungerecht sein. Zum Beispiel: „Wer dies tut, der hat sich selbst Unrecht getan“ (ẓalama nafsahu [Qur’ān 2:231]). Zu ẓulm siehe Schaefer, Ethische Aspekte der Schrift, Bd. 1, Kap. 7, Abschnitt 4
21 Siehe Qur’ān 4:110; 3:117; 10:44, etc.; „Fürwahr, ihr habt euch selbst und andere ungerecht behandelt“ (Bahā’u’llāh, „Sūratu’l-Mulūk“, in: [Anspruch und Verkündigung 5:29]). Aristoteles diskutiert das Problem, ob man sich selbst Unrecht tun kann oder nicht (Aristoteles, Nikomachische Ethik 1138aff.).
22 Der Leser sei auf Kap. 14, Abschnitt 41, Fn. 1124 verwiesen.
23 Siehe Bahā’u’llāh, Die Verborgenen Worte, Einleitung; arab. 8; pers. 54; ‘Abdu’l-Bahā, Das Geheimnis göttlicher Kultur, S. 40. Zu amāna siehe Talbi, „Religionsfreiheit, S. 256 ff.
24 Der Bāb, Auswahl 3:23:1
25 Bahā’u’llāh, Ährenlese 93:5
26 Bahā’u’llāh, Die Verborgenen Worte, arab. 59
27 Bahā’u’llāh, Ährenlese 152
28 Ibid.
29 Kant, Vorlesung über Ethik, S. 207
30 siehe unten, Kap. 13, Abschnitt 21,5
31 siehe unten, ibid. Nr. 6
32 Ibid. Siehe auch ibid. Nr. 6
33 Es ist anzumerken, dass diese Klassifikationen mit denen der Halacha und der Scharīa übereinstimmen.
34 Siehe Bahā’u’llāh, Die Verborgenen Worte, Schlussvers; Ährenlese 43:3
35 Die traditionelle katholische Lehre unterscheidet zwischen den „theologischen Tugenden“ und den „weltlichen Tugenden“. Die letzteren umfassen die intellektuellen (dianoëtischen) und die „ethischen Tugenden“. Der Katechismus der Katholischen Kirche unterscheidet zwischen den „theologischen Tugenden“ und den „menschlichen Tugenden“ (siehe Nr. 1803–1845).
36 Siehe Bahā’u’llāh, Ährenlese 134:2
37 Ibid. 134:1
38 Bahā’u’llāh, Die Verborgenen Worte, arab. 2
Details
- Pages
- 766
- ISBN (PDF)
- 9783631909492
- ISBN (ePUB)
- 9783631909508
- DOI
- 10.3726/b21252
- Language
- German
- Publication date
- 2024 (November)
- Keywords
- Bahā’ītum Bahā’ī Religion Schrift
- Published
- Berlin, Bruxelles, Chennai, Lausanne, New York, Oxford, 2024. 766 S.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG