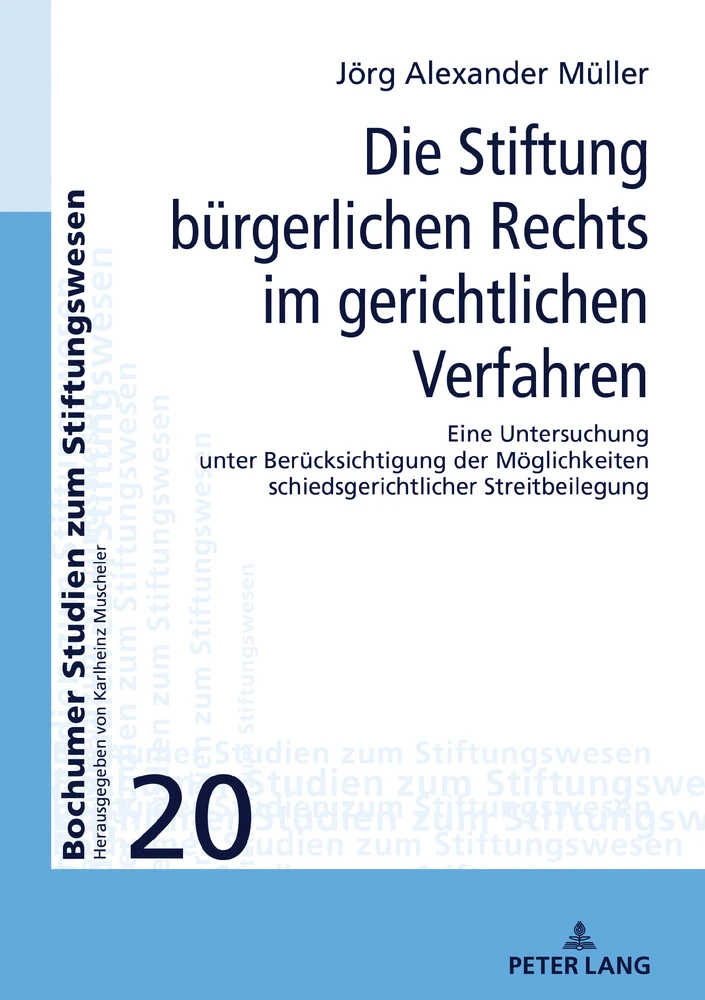Die Stiftung bürgerlichen Rechts im gerichtlichen Verfahren
Eine Untersuchung unter Berücksichtigung der Möglichkeiten schiedsgerichtlicher Streitbeilegung
Summary
Excerpt
Table Of Contents
- Abdeckung
- Titelseite
- Copyright-Seite
- Hingabe
- Inhaltsübersicht
- Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Teil 1: Einleitung
- § 1. Einführung in die Thematik
- § 2. Gang der Untersuchung
- Teil 2: Die Stiftung bürgerlichen Rechts im gerichtlichen Verfahren
- § 1. Allgemeiner Teil: Verfahrensvoraussetzungen und Vorbereitung des gerichtlichen Verfahrens
- A. Stellung im gerichtlichen Verfahren
- I. Partei- und Beteiligtenfähigkeit der Stiftung bürgerlichen Rechts
- 1. Ordentliche Gerichtsbarkeit: Parteifähigkeit
- a) Begriff und Anforderungen gem. § 50 ZPO
- b) Beginn und Ende der Parteifähigkeit
- aa) Vor Anerkennung der Stiftung
- (1) Dogmatischer Anknüpfungspunkt: Vor-Stiftung
- (2) Dogmatischer Anknüpfungspunkt: § 54 Abs. 1 BGB analog
- (3) Dogmatischer Anknüpfungspunkt: Vergleich mit dem nasciturus
- (4) Zwischenergebnis
- bb) Nach Auflösung oder Aufhebung der Stiftung
- c) Zwischenergebnis
- 2. Verwaltungsgerichtsbarkeit: Beteiligtenfähigkeit
- II. Prozessfähigkeit der Stiftung bürgerlichen Rechts
- 1. Ordentliche Gerichtsbarkeit
- a) Begriff und Anforderungen gem. §§ 51, 52 ZPO
- b) Prozessfähigkeit der noch nicht anerkannten und aufgelösten bzw. aufgehobenen Stiftung
- aa) Vor Anerkennung der Stiftung
- bb) Nach Auflösung oder Aufhebung der Stiftung
- c) Zwischenergebnis
- 2. Verwaltungsgerichtsbarkeit
- B. Zuständigkeitsfragen
- I. Bestimmung der Rechtswegzuständigkeit einer stiftungsrechtlichen Streitigkeit
- 1. Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte gem. § 13 GVG
- 2. Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte gem. § 40 Abs. 1 VwGO
- II. Bestimmung der sachlichen Zuständigkeit
- 1. Ordentliche Gerichtsbarkeit
- 2. Verwaltungsgerichtsbarkeit
- III. Bestimmung der örtlichen Zuständigkeit
- 1. Ordentliche Gerichtsbarkeit
- a) Überblick zu den Gerichtsstandsbestimmungen
- aa) Allgemeine Gerichtsstände
- bb) Besondere Gerichtsstände
- cc) Ausschließliche Gerichtsstände
- b) Stiftungsrechtlich relevante Gerichtsstände
- aa) Allgemeiner Gerichtsstand juristischer Personen: § 17 ZPO
- (1) Bestimmung des Sitzes gem. § 17 Abs. 1 ZPO
- (a) Grundsätze
- (b) Möglichkeiten und Grenzen der Rechtssitzfestlegung
- (c) Festlegung von Doppelsitzen
- (d) Zwischenergebnis
- (2) Beginn und Ende der Gerichtsstandsregelung
- (a) Vor Anerkennung der Stiftung
- (b) Nach Auflösung oder Aufhebung der Stiftung
- bb) Besonderer Gerichtsstand der Mitgliedschaft: § 22 ZPO
- (1) Bedeutung und Anwendungsfeld des Gerichtsstands
- (2) Anwendbarkeit auf die Stiftung
- (a) Direkt
- (b) Analog
- (aa) Planwidrige Regelungslücke
- (bb) Vergleichbare Interessenlage
- (c) Zwischenergebnis
- 2. Verwaltungsgerichtsbarkeit
- C. Gewährung von Prozesskostenhilfe an Stiftungen bürgerlichen Rechts
- I. Bewilligungsberechtigung der juristischen Person im System des Prozesskostenhilferechts
- 1. Vorüberlegungen zur Bedeutung und verfassungsrechtlichen Herleitung der Prozesskostenhilfe
- 2. Rechtshistorische Entwicklung der Bewilligungsberechtigung
- a) Civilprozeßordnung vom 30. Januar 1877 (RGBl. I S. 83)
- b) Gesetz, betr. die Ermächtigung des Reichskanzlers zur Bekanntmachung der Texte verschiedener Reichsgesetze vom 17. Mai 1898 (RGBl. I S. 342)
- c) Gesetz zur Änderung des Verfahrens in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten vom 27. Oktober 1933 (RGBl. I S. 780)
- d) Gesetz über die Prozeßkostenhilfe vom 13. Juni 1980 (BGBl. I S. 677)
- 3. Zwischenergebnis
- II. Bewilligungsvoraussetzungen, § 116 Satz 1 Nr. 2, Satz 2 ZPO
- 1. Voraussetzungen des § 116 Satz 1 Nr. 2 ZPO
- a) Keine Kostenaufbringung durch die Stiftung
- aa) Einzusetzende Vermögenswerte
- (1) Einfluss des Vermögenserhaltungsgrundsatzes
- (2) Einfluss des Grundsatzes satzungsgemäßer Mittelverwendung
- bb) Zwischenergebnis
- b) Keine Kostenaufbringung durch die wirtschaftlich Beteiligten
- aa) Zweck der Regelung
- bb) Begriff des wirtschaftlich Beteiligten
- (1) Grundsätze
- (2) Einzelfragen
- (a) Stifter
- (b) Stiftungsvorstand
- (c) Stiftungsaufsicht
- (d) Destinatäre der Stiftung
- (e) Anfallberechtigte
- cc) Zwischenergebnis
- c) Unterlassung der Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung läuft allgemeinen Interessen zuwider
- aa) Zweck der Regelung
- bb) Begriff der allgemeinen Interessen
- (1) Grundsätze
- (2) Einfluss der Gemeinnützigkeit
- (a) Meinungsstand
- (b) Auslegung
- (aa) Wortlaut
- (bb) Systematik
- (cc) Entstehungsgeschichte
- (dd) Sinn und Zweck
- (c) Zwischenergebnis
- 2. Verweis auf die allgemeinen Voraussetzungen des § 114 Abs. 1 Satz 1 a.E., Abs. 2 ZPO in § 116 Satz 2 ZPO
- a) Hinreichende Aussicht auf Erfolg der beabsichtigten Rechtsverfolgung/Rechtsverteidigung
- b) Keine Mutwilligkeit
- c) Zwischenergebnis
- III. Gesamtergebnis
- § 2. Besonderer Teil: Gerichtliche Klärung einzelner Rechtsschutzbegehren im Stiftungsrecht – Klagesituationen und Prozessführungsfragen
- A. Rechtswegzuständigkeit: Ordentliche Gerichtsbarkeit
- I. Klagearten und einstweiliger Rechtsschutz
- 1. Leistungsklagen
- 2. Feststellungsklagen
- 3. Gestaltungsklagen
- 4. Einstweiliger Rechtsschutz
- II. Einzelne Rechtsschutzbegehren
- 1. Inanspruchnahme von Rechtsschutz
- a) Bestehen eines Klagerechts
- b) Prozessführungsbefugnis
- 2. Gerichtliche Verfahren rund um die verfassungsmäßig begründeten Rechte und Pflichten
- a) Streitgegenstand: Geltendmachung eines Anspruchs auf Stiftungsleistung
- aa) Sachbefugnis: Materiell-rechtliche Grundlagen
- bb) Gerichtliche Durchsetzung
- (1) Unmittelbar satzungsmäßig begründete Destinatärsansprüche
- (2) Organschaftlich begründete Destinatärsansprüche
- (3) Vertraglich begründete Destinatärsansprüche
- cc) Gesamtergebnis
- b) Streitgegenstand: Pflichtverletzungen durch den Stiftungsvorstand
- aa) Überblick zum Pflichtenkatalog und möglichen Pflichtverletzungen
- bb) Sachbefugnis zur gerichtlichen Durchsetzung des Stiftungsinteresses
- (1) Grundsatz und Durchsetzungsdefizite
- (2) Gewillkürte Lösungsansätze
- (a) Begründung von Klagerechten in der Satzung
- (aa) Recht des Kuratoriums
- (α) Regelungsmöglichkeiten und -grenzen
- (β) Stiftungsinteresse: Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen
- (αα) Konzeption des Klagerechts und Konsequenzen für die gerichtliche Durchsetzung
- (aaa) § 112 AktG analog
- (bbb) § 30 Satz 2 BGB analog
- (ccc) Stellungnahme
- (ββ) Klagegegner
- (γ) Stiftungsinteresse: Geltendmachung von Unterlassungsansprüchen
- (αα) Konzeption des Klagerechts und Konsequenzen für die gerichtliche Durchsetzung
- (ααα) Innen- und Außenbereich juristischer Personen
- (βββ) Rechtsverhältnisse im Innenbereich der Stiftung
- (αααα) Grundsätzliche Überlegungen
- (ββββ) Strukturmerkmale des subjektiven Rechts und Übertragbarkeit auf den Innenbereich der Stiftung
- (γγγγ) Stellungnahme
- (ββ) Klagegegner
- (γγ) Zwischenergebnis
- (bb) Recht der Destinatäre
- (α) Regelungsmöglichkeiten und -grenzen
- (αα) Ansätze zur unmittelbaren Herleitung von Klagerechten
- (ββ) Ansätze zur mittelbaren Herleitung von Klagerechten
- (β) Konzeption des Klagerechts und Konsequenzen für die gerichtliche Durchsetzung
- (αα) Gewillkürte Prozessstandschaft
- (ββ) Vertretung der Stiftung
- (γγ) Stellungnahme
- (γ) Zwischenergebnis
- (cc) Recht des Stifters
- (b) Zwischenergebnis zu den satzungsmäßigen Klagerechten
- (3) Gesetzliche Lösungsansätze
- (a) Anwendung der actio pro socio im Stiftungsrecht
- (aa) Grundsätze und Anwendungsbereich der actio pro socio
- (bb) Möglichkeiten und Grenzen der Herleitung einer actio pro fundatione für einzelne Stiftungsbeteiligte
- (cc) Überlegungen de lege ferenda
- (b) Bestellung von Vorstandsmitgliedern als Notmaßnahme
- (aa) Bisherige Rechtslage und Rechtslage seit dem 1. Juli 2023
- (bb) Gemeinsame Voraussetzung der Notmaßnahme: Fehlen von Vorstandsmitgliedern
- (α) Auslegung
- (β) Zwischenergebnis
- (cc) Gesamtergebnis
- (c) Anknüpfung an das Institut der Stiftungsaufsichtsbeschwerde
- (aa) Dogmatische Grundlagen der Stiftungsaufsichtsbeschwerde im schweizerischen Recht
- (bb) Herleitung von Klagerechten Stiftungsinteressierter im Wege der rechtsfortbildenden Anerkennung einer Stiftungsaufsichtsbeschwerde
- cc) Gesamtergebnis
- 3. Gerichtliches Verfahren um die Rechtmäßigkeit organschaftlicher Satzungsänderungsbeschlüsse
- a) Wirksamkeitsvoraussetzungen für Satzungsänderungen
- b) Prozessführungsfragen
- aa) Grundsätzliche Überlegungen
- bb) Satzungsmäßige Klagemöglichkeiten
- (1) Gerichtliches Vorgehen der Stiftung
- (2) Gerichtliches Vorgehen des Stifters
- (3) Gerichtliches Vorgehen der Organmitglieder
- (a) Formal-mitwirkungsrechtliche Begründung
- (b) Änderungsinhaltliche Begründung
- (c) Begründung aufgrund rein organmitgliedschaftlicher Stellung
- (4) Gerichtliches Vorgehen der Destinatäre
- (a) Leistungsrechtliche Begründung
- (b) Organmitgliedschaftliche Begründung
- (5) Gerichtliches Vorgehen der Anfallberechtigten
- c) Gesamtergebnis
- B. Rechtswegzuständigkeit: Verwaltungsgerichtsbarkeit
- I. Verwaltungsprozessuale Klagearten und einstweiliger Rechtsschutz
- 1. Anfechtungsklagen
- 2. Verpflichtungs- und allgemeine Leistungsklagen
- 3. Feststellungsklagen
- 4. Fortsetzungsfeststellungsklagen
- 5. Vorläufiger Rechtsschutz
- II. Einzelne Rechtsschutzbegehren
- 1. Verwaltungsprozessuale Inanspruchnahme von Rechtsschutz
- a) Bestehen einer Klagebefugnis
- b) Beklagter stiftungsrechtlicher Verwaltungsprozesse
- 2. Gerichtliche Verfahren um die staatliche Anerkennung der Stiftung bürgerlichen Rechts
- a) Statthafte Klageart
- b) Klagebefugnisse
- 3. Gerichtliche Verfahren um aufsichtliche Maßnahmen in der laufenden Stiftungstätigkeit
- a) Streitgegenstand: Genehmigung von Satzungsänderungs-, insbesondere von Zweckänderungsbeschlüssen
- aa) Grundlagen und statthafte Klageart
- bb) Klagebefugnisse
- (1) Stiftung
- (2) Stifter und Erben
- (3) Organmitglieder
- (4) Destinatäre, Anfallberechtigte und außenstehende Dritte
- cc) Gesamtergebnis
- b) Streitgegenstand: Aufhebung der Stiftung
- aa) Voraussetzungen für die behördliche Aufhebung einer Stiftung und statthafte Klageart
- bb) Konsequenzen für die Klagebefugnis bei existenzvernichtenden Maßnahmen der Stiftungsaufsicht
- cc) Stellungnahme
- dd) Gesamtergebnis
- Teil 3: Außergerichtliche Verfahren zur Streitbeilegung: Schiedsgerichtliche Klärung stiftungsrechtlicher Streitigkeiten
- § 1. Allgemeines zu schiedsrichterlichen Verfahren
- § 2. Schiedsverfügung als Anknüpfungspunkt schiedsgerichtlicher Einsetzung im Stiftungsrecht
- A. Gesetzliche Grundlagen: Form, Inhalt und Wirkungen einer Stiftungsschiedsverfügung
- B. Möglichkeiten und Grenzen der Bindungswirkung einer Stiftungsschiedsverfügung
- I. Personale Reichweite
- II. Gegenständliche Reichweite
- 1. Innerorganisatorische und außenrechtliche Streitigkeiten
- 2. Rechtsstreitigkeiten mit der Stiftungsbehörde
- Teil 4: Zusammenfassung der Ergebnisse
- Literaturverzeichnis
Teil 1: Einleitung
§ 1. Einführung in die Thematik
„Gerichtsentscheidungen zu stiftungsrechtlichen Fragen sind selten. (…) Streitfragen im Stiftungsrecht werden (…) kaum durch höchstrichterliche Entscheidungen geklärt.“1
Mit dieser im Zuge der Novellierung des Stiftungsrechts von der dazu eingesetzten Bund-Länder-Arbeitsgruppe gemachten Feststellung wird ein Problemfeld adressiert, das im Gesellschaftsrecht seit einiger Zeit unter dem Begriff „corporate litigation“ vermehrt Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen ist.2 Mit dieser Terminologie wird, ausgehend von materiell-rechtlichen Fragen, die Darstellung typischer gesellschaftsrechtlicher Streitigkeiten im prozessualen und außer-, vornehmlich schiedsgerichtlichen Gewand bezeichnet. Dabei werden vor allem praxisrelevante Fragen, etwa zu Prozessrechtsverhältnissen und zur Prozessführung selbst, in den Blick genommen.
Die der vorliegenden Arbeit „Die Stiftung bürgerlichen Rechts im gerichtlichen Verfahren. Eine Untersuchung unter Berücksichtigung der Möglichkeiten schiedsgerichtlicher Streitbeilegung“ zugrundeliegende Themenstellung sucht diesem Ansatz Rechnung zu tragen, dem im Stiftungsrecht aus zweierlei Gründen besondere Relevanz zukommt: Zum einen tritt neben die im Bereich der „litigation“ typische Verknüpfung von materiellem Recht und Verfahrensrecht im Stiftungsrecht das Zusammenspiel der privatrechtlichen Stiftungsvorschriften des BGB mit den öffentlich-rechtlichen Vorschriften der Landesstiftungsgesetze als Ausprägung der rechtlichen Mehrgesichtigkeit des Stiftungswesens.3 Zum anderen ist speziell die Ausgestaltung der gerichtlichen Rechtsschutzmöglichkeiten bei stiftungsrechtlichen Streitigkeiten angesichts der Struktureigenheiten der Stiftung bürgerlichen Rechts4 als Prozessrechtssubjekt von Interesse. Anhaltspunkte dafür bietet zunächst die Definition in § 80 Abs. 1 Satz 1 BGB5, wonach es sich bei der rechtsfähigen Stiftung um eine mit einem Vermögen zur dauernden und nachhaltigen Erfüllung eines vom Stifter vorgegebenen Zwecks ausgestattete, mitgliederlose juristische Person handelt. Zwar besitzt sie ebenso wie andere juristische Personen6 eigene Rechtspersönlichkeit und erlangt Handlungs- und Willensfähigkeit durch ihre Organe. Es handelt sich bei der juristischen Person „Stiftung“ jedoch nicht um eine Personenvereinigung im Sinne einer verbandsmäßig, d.h. körperschaftlich strukturierten Organisation oder Gesellschaft.7 Trotz der übereinstimmenden Ausrichtung auf einen bestimmten Zweck ist die Stiftung, anders als die Gesellschaft oder eine Körperschaft mit den Merkmalen des Mitgliederbestands, der Möglichkeit des Mitgliederwechsels und des Bestimmungsrechts der Mitglieder, gerade durch ihre Mitgliederlosigkeit gekennzeichnet.8 So mangelt es auch an einem zur Mitgliederversammlung, Gesellschafterversammlung oder Hauptversammlung äquivalenten Willensbildungsorgan der Stiftung, weil ihre Tätigkeit einzig vom Primat des historischen Stifterwillens bestimmt wird, wie er in Stiftungsgeschäft und Stiftungssatzung Ausdruck gefunden hat.9 Entsprechend kann es grundsätzlich keine mitgliederbestimmte, autonome Willensbildung geben, sondern die Aufgabe der Stiftungsorgane, zuvorderst des Stiftungsvorstands als gesetzlich vorgesehenem Pflichtorgan (§ 84 Abs. 1 Satz 1 BGB [§§ 86 Satz 1 a.F., 26 Abs. 1 Satz 1 BGB]) zur Vertretung (§ 84 Abs. 2 Satz 1 BGB [§§ 86 Satz 1 a.F., 26 Abs. 1 Satz 2 Hs. 1 BGB]) und grundsätzlich (arg. e § 84 Abs. 1 Satz 2, Abs. 3 BGB) zur umfassenden Geschäftsführung der Stiftung,10 beschränkt sich auf eine Konkretisierung und auftragsgemäße Erfüllung des zum Ausdruck gekommenen Stifterwillens.11 Dasselbe gilt für ein vom Stifter satzungsmäßig vorgesehenes Fakultativorgan mit Kontroll-, Beratungs- oder Repräsentationsfunktion.12 Da sich die Stiftung mit ihrer Anerkennung von der Person des Stifters emanzipiert und nur noch sich selbst gehört, ist sie ab diesem Zeitpunkt als verselbständigte Vermögensmasse ohne Mitglieder, Gesellschafter oder wirtschaftlich interessierte Eigentümer13 in einer besonderen Gefährdungslage hinsichtlich der Überlagerung der Stiftungstätigkeit durch stiftungsfremde Sonderinteressen. In diese Lücke stößt die als Rechtsaufsicht konzipierte Stiftungsaufsicht, deren Aufgabe es ist sicherzustellen, dass die Verwaltung der Stiftung durch die Stiftungsorgane im Einklang mit dem Stifterwillen sowie den sonstigen satzungs- und gesetzmäßigen Anordnungen vollzogen wird.14 Gleichwohl kann es an den Schnittstellen der Kontrolle durch stiftungsinterne und stiftungsexterne Gremien sowie der Stiftungsaufsicht zu Kontroll- und Durchsetzungsdefiziten zulasten der Stiftung kommen.15 Dabei ist nicht nur an Interessenkollisionen legitimer stiftungsrechtlicher Positionen mit den bereits genannten stiftungsfremden Sonderinteressen von Stiftungsbeteiligten zu denken, sondern ebenso an Streitigkeiten in Bezug auf unterschiedliche, wenngleich beiderseitig genuine Stiftungsinteressen.16 Eine an die „corporate litigation“ angelehnte „foundation litigation“17 muss daher nicht nur Antwort auf die Frage geben, wie die Rechtsschutzmöglichkeiten für die einzelnen Beteiligten im Stiftungsrecht hinsichtlich einer prozessualen Geltendmachung der ihnen innerorganisatorisch zukommenden, materiell-rechtlichen Positionen ausgestaltet sind. Sie muss ebenso Lösungsansätze für eventuelle Rechtsschutzschwächen, die durch die vorstehend skizzierten Struktureigenheiten der Stiftung begründet werden, und deren Kompensation zum Schutz der Stiftung im Blick haben.
Ziel der vorliegenden Arbeit ist es daher, die daraus erwachsenden Konsequenzen für die Beschreitung des Rechtswegs und die gerichtliche Durchsetzbarkeit von Rechten zu beleuchten. Insbesondere soll untersucht werden, wie sich die strukturellen Besonderheiten der Stiftung bürgerlichen Rechts als Rechtsform prozessual abbilden lassen, in welchen Bereichen Lücken bestehen und wie diese im Sinne der Stiftung und der Durchsetzung des Stifterwillens geschlossen werden könnten. Da es infolge des zur Verfügung stehenden Umfangs dieser Bearbeitung nicht möglich ist, jede denkbare prozessuale Konstellation abzubilden, sollen die streitigen Rechtspositionen zwischen den verschiedenen stiftungsrechtlichen Beteiligten anhand typisierter Konfliktfelder im Stiftungsrecht herausgearbeitet werden.18
§ 2. Gang der Untersuchung
Im Einzelnen stellt sich der Bearbeitungsgang wie folgt dar:
Teil 2 ist zunächst der Untersuchung der Stiftung bürgerlichen Rechts im gerichtlichen Verfahren gewidmet. Dabei folgt die Bearbeitung nicht etwa einer zwischen Zulässigkeit und Begründetheit verschiedener Klagen differenzierenden Darstellung. Vielmehr wird mit einem Klammerprinzip gearbeitet. Gedanke dieser Herangehensweise ist, diejenigen Verfahrensfragen, die sich regelmäßig bei der Beschreitung des Rechtsweges stellen, zu bündeln und in einem „Allgemeinen Teil“ voranzustellen. Dabei soll der unter § 1. hervorgehobenen, rechtsformbedingten Verflechtung privat- und öffentlich-rechtlicher Regelungsmaterien prozessual dadurch Rechnung getragen werden, dass innerhalb der einzelnen Verfahrensvoraussetzungen zwischen der ordentlichen Gerichtsbarkeit und der Verwaltungsgerichtsbarkeit differenziert wird.
Der erste Komplex widmet sich der Stellung im gerichtlichen Verfahren. Zu untersuchen sind dabei vor allem Partei- und Beteiligtenfähigkeit sowie Prozessfähigkeit der Stiftung bürgerlichen Rechts. Das schließt Überlegungen hinsichtlich des Beginns und Endes der Partei- bzw. Beteiligten- und Prozessfähigkeit mit ein, unter Berücksichtigung der Frage, ob für den prozessualen Bereich eine Vor-Stiftung anzuerkennen ist. Dies ist durch eingehende Untersuchung der gesetzlichen Bestimmungen und eventuelle analoge Anwendung geeigneter Regelungen aus dem Gesellschaftsrecht zu ermitteln.
Weiterhin sollen im „Allgemeinen Teil“ Zuständigkeitsfragen erörtert werden. In Anbetracht des Spagats des Stiftungsrechts zwischen Zivilrecht einerseits und dem öffentlichen Recht andererseits19 stehen zu Beginn Überlegungen zur Bestimmung der Rechtswegzuständigkeit einer stiftungsrechtlichen Streitigkeit. Für beide Gerichtsbarkeiten ist ferner die sachliche Zuständigkeit zu untersuchen, im Rahmen der ordentlichen Gerichtsbarkeit vor allem die Bestimmung des Streitwertes einzelner Streitgegenstände. Es schließen sich Ausführungen zur örtlichen Zuständigkeit an. Hier sind für Streitigkeiten vor den ordentlichen Gerichten die Gerichtsstandsregelungen der ZPO heranzuziehen. Im Anschluss an einige allgemeinere Ausführungen sind die stiftungsrechtlich relevanten Gerichtsstände zu untersuchen: Zunächst soll § 17 ZPO als allgemeiner Gerichtsstand juristischer Personen beleuchtet werden. Anzusprechende Problemfelder betreffen die Möglichkeiten und Grenzen, einen vom Verwaltungssitz abweichenden statutarischen Sitz festzulegen oder einen Doppelsitz zu bestimmen. Weitere zu untersuchende Gerichtsstände sind § 21 ZPO (Besonderer Gerichtsstand der Niederlassung) und § 22 ZPO (Besonderer Gerichtsstand der Mitgliedschaft), letzterer hinsichtlich seiner Anwendbarkeit auf die Stiftung bürgerlichen Rechts.
Schließlich wird – unter Darstellung stiftungsrechtlicher Prinzipien, wie dem Vermögenserhaltungsgrundsatz – beleuchtet, ob eine Stiftung bürgerlichen Rechts Prozesskostenhilfe in Anspruch nehmen kann. Ergänzt wird der „Allgemeine Teil“ um Hinweise zu den Voraussetzungen der Klageerhebung und Besonderheiten, die an dieser Stelle für die Stiftung bürgerlichen Rechts zu beachten sind.
Im „Besonderen Teil“ geht es, der unter § 1. geschilderten Einschränkung folgend, um die gerichtliche Klärung einzelner, besonders konfliktträchtiger Rechtsschutzbegehren. Die Darstellung widmet sich geordnet nach den Rechtswegzuständigkeiten klassischen, typisierten Streitigkeiten zwischen stiftungsrechtlich Beteiligten. Untersucht und herausgearbeitet werden nach einleitenden Worten zum prozessualen Anknüpfungsmoment (Streitgegenstand) die jeweils tangierten, streitigen (subjektiven) Rechtspositionen, die im Rahmen der Stiftungstätigkeit und Stiftungspraxis betroffen sein können. Ausgehend von den materiell-rechtlichen Voraussetzungen wird die für die prozessuale Durchsetzung von Rechten elementare Frage beleuchtet, ob ein entsprechendes Klagerecht besteht, das im Namen des Klägers gerichtlich geltend gemacht werden kann, respektive, ob eine Verletzung in eigenen subjektiv-öffentlichen Rechten möglich ist. Im Rahmen dieser Untersuchung wird der eingangs aufgeworfenen Frage nachzugehen sein, inwieweit bei der Durchsetzung stiftungsrechtlicher Positionen Lücken bestehen, sowie ob und mit welchen Mitteln des materiellen Rechts bzw. des Prozessrechts bestehende Kontroll- und Durchsetzungsdefizite zur Stärkung des Rechtsschutzes für die Stiftung ausgeglichen werden können, etwa in Form eines Notvertretungsrechts oder der Möglichkeit einer prozessstandschaftlichen Geltendmachung von Rechten der Stiftung. In diesem Kontext soll zusätzlich geklärt werden, ob die teilweise geforderte Übertragung im Ausland anerkannter Rechtsbehelfe, etwa die im schweizerischen Stiftungsrecht aus Bestimmungen des ZGB hergeleitete Stiftungsaufsichtsbeschwerde, auf das deutsche Recht notwendig und zulässig ist. Besonderes Augenmerk wird auf die Bedeutung des Stifterwillens für stiftungsrechtliche Auseinandersetzungen gelegt, insbesondere, inwiefern der Stifter in Stiftungsgeschäft und Stiftungssatzung rechtsverbindliche Anordnungen treffen kann, die auf verfahrensrechtlicher Ebene durchschlagen.
Weitergehende Verfahrensfragen innerhalb der diskutierten Streitgegenstände beschäftigen sich mit der Durchführung des gerichtlichen Verfahrens und dem einstweiligen Rechtsschutz. Auch die Möglichkeiten der Beteiligung (stiftungsinteressierter) Dritter am Rechtsstreit werden ausführlich untersucht.
Der Bearbeitungsgang rückt schließlich die außergerichtliche Streitbeilegung in Form der echten Schiedsgerichtsbarkeit in den Mittelpunkt.20 Im Anschluss an eine allgemeine Darstellung zu schiedsgerichtlichen Verfahren (§§ 1025 ff. ZPO) soll hinsichtlich deren Geeignetheit für stiftungsspezifische Streitigkeiten untersucht werden, welche Möglichkeiten bzw. Chancen des Rechtsschutzes die schiedsgerichtliche Klärung für die Stiftungsbeteiligten zulässigerweise bietet. Hier ist insbesondere die Regelung des § 1066 ZPO in den Blick zu nehmen.
1 Anlage zum Zweiten Bericht der Bund-Länder-Arbeitsgruppe „Stiftungsrecht“ vom 27. Februar 2018, 17.
2 S. nur beispielhaft aus dem aktuellen Schrifttum Mehrbrey, Hd-Buch Ges. Streitigkeiten; MHdB GesR VII (Gesellschaftsrechtliche Streitigkeiten); Servatius, Corporate Litigation; Waclawik, Prozessführung im Gesellschaftsrecht.
3 Dazu sowie zur Entwicklung des Stiftungsrechts auf Bundes- und Landesebene ausführlich Andrick, in: Werner/Saenger/Fischer, Die Stiftung, § 2 Rn. 1 ff.; ferner Schiffer/Pruns, in: NK-BGB, Vor §§ 80 ff. Rn. 27 f.; Weitemeyer, in: MüKo-BGB, § 80 Rn. 1, mit dem Hinweis auf die für das Zivilrecht einzigartige Verbindung von Bundes- und Landesrecht.
4 Sofern nicht anders angegeben, beschränken sich die nachfolgenden Ausführungen auf die rechtsfähige, als gemeinnützig gem. AO anerkannte Stiftung bürgerlichen Rechts i.S.d. §§ 80 ff. BGB in Form der Ewigkeitsstiftung.
5 Die Bearbeitung legt die mit der bundesrechtlichen Vereinheitlichung des Stiftungszivilrechts zum 1. Juli 2023 in Kraft getretene Rechtslage (Gesetz zur Vereinheitlichung des Stiftungsrechts und zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes vom 16. Juli 2021, BGBl. I S. 2947) zugrunde. Auf die vor der Reform geltende Rechtslage wird nur insofern eingegangen, als dies für die Untersuchung der einzelnen Fragestellungen sachdienlich erscheint.
6 Neben dem Grundtyp der juristischen Person, dem rechtsfähigen Verein (§§ 21–53, 55–79 BGB), sind das die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (§§ 1 ff. GmbHG), die Aktiengesellschaft (§§ 1 ff. AktG), die Kommanditgesellschaft auf Aktien (§§ 278–290 AktG), die eingetragene Genossenschaft (§§ 1 ff. GenG) und der Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit (§§ 7, 15–53 VAG). – Zur Rechtsfähigkeit als Fähigkeit von juristischen Personen, Träger von Rechten und Pflichten zu sein, s. nur Enneccerus/Nipperdey, BGB AT, 618, 623, 625 f.
7 BVerwGE 106, 177, 181 = NJW 1998, 2545; Backert, in: BeckOK-BGB, § 80 Rn. 3; Ellenberger, in: Grüneberg, BGB, Vor § 80 Rn. 9; Gollan, Vorstandshaftung, 8; Hof, in: Stiftungsrecht in Europa, 309; Muscheler, in: Andrick/Muscheler/Uffmann, Stiftungsrecht, § 80 BGB Rn. 13; G. Roth, in: MHdB GesR VII, § 96 Rn. 3; Schlüter/Stolte, Stiftungsrecht, Kap. 1 Rn. 40; Weitemeyer, in: MüKo-BGB, § 80 Rn. 1; O. Werner, in: Werner/Saenger/Fischer, Die Stiftung, § 1 Rn. 14.
8 Backert, in: BeckOK-BGB, § 80 Rn. 3; Burgard, ZStV 2015, 1, 3; Gollan, Vorstandshaftung, 8, nach der bei der Stiftung eine Verselbständigung von Vermögen stattfindet, während der rechtsfähige Verein, die GmbH oder die AG einen verselbständigten Personenverband darstellen; G. Roth, in: MHdB GesR VII, § 96 Rn. 3; Schlüter/Stolte, Stiftungsrecht, Kap. 1 Rn. 40; Sieger/Bank, NZG 2010, 641, 642; Stumpf, SchiedsVZ 2009, 266 Fn. 3, wonach die Stiftung ihre Personifizierung nicht aus einem Verbund von Personen, sondern aus einem zweckgebundenen Vermögen bezieht; Weitemeyer, in: MüKo-BGB, § 80 Rn. 1; O. Werner, in: Werner/Saenger/Fischer, Die Stiftung, § 1 Rn. 14.
9 Grundlegend BVerfGE 46, 73, 85 = NJW 1978, 581; zudem Backert, in: BeckOK-BGB, § 80 Rn. 3; G. Roth, in: MHdB GesR VII, § 96 Rn. 3; Schiffer/Pruns, in: NK-BGB, § 80 Rn. 3 ff.; Schiffer/Pruns/Schürmann, Reform des Stiftungsrechts, § 6 Rn.5; O. Werner, in: Werner/Saenger/Fischer, Die Stiftung, § 1 Rn. 14.
10 Zur Kritik an der systematischen Verknüpfung der Vertretereigenschaft mit der Geschäftsführungsbefugnis in § 84 Abs. 1 BGB zu Recht Burgard, in: Burgard, Stiftungsrecht, § 84 BGB Rn. 1, weil maßgeblich für die Eigenschaft als gesetzlicher Vorstand der Stiftung die Stellung ihres gesetzlichen Vertreters ist.
11 G. Roth, in: MHdB GesR VII, § 99 Rn. 1.
12 Für dieses Organ soll in den folgenden Ausführungen der Begriff des Kuratoriums zugrunde gelegt werden; zu weiteren Begriffen, wie Stiftungsrat, Verwaltungsrat oder erweiterter Vorstand, s. nur Schlüter/Stolte, Stiftungsrecht, Kap. 2 Rn. 67; Wernicke, ZEV 2003, 301, 302.
13 Gollan, ErbR 2020, 700; Kraus, npoR 2024, 63; Markworth, NZG 2021, 100, 103; Reuter, in: NPLY 2002, 157, 167 f.; G. Roth, in: MHdB GesR VII, § 96 Rn. 6; Schlüter/Stolte, Stiftungsrecht, Kap. 1 Rn. 40; Schwarz, BB 2001, 2381, 2386; Uffmann, ZIP 2021, 1251, 1254; Weitemeyer, ZGR 2019, 238, 241 ff.
14 Zur Aufgabe und Funktion der Stiftungsaufsicht, s. Winkler, in: Werner/Saenger/Fischer, Die Stiftung, § 27 Rn. 4 ff.
15 Die korrespondierenden Konfliktfelder werden in den einzelnen Verfahrenskonstellationen unter Teil 2.§ 2. näher beleuchtet.
16 G. Roth, in: MHdB GesR VII, § 96 Rn. 4.
17 Zu diesem Begriff und seiner Bedeutung G. Roth, in: MHdB GesR VII, § 96 Rn. 17.
18 Dabei beschränkt sich die Darstellung auf die (praxisrelevanteren) Rechtsstreitigkeiten vor den ordentlichen Gerichten und den Verwaltungsgerichten. Ebenfalls denkbare arbeitsgerichtliche Prozesse (z.B. in der Konstellation einer Stiftung als Arbeitgeberin) sowie Streitigkeiten vor den Finanzgerichten (etwa in gerichtlichen Verfahren um die Anerkennung einer Stiftung als gemeinnützig i.S.d. §§ 51 ff. AO) bleiben somit ausgeklammert.
19 Andrick, in: Stiftungen in Deutschland und Europa, 281, 283.
20 Mit dem exemplarischen Fokus auf die Einsetzung eines Schiedsgerichts wird dem Umstand Rechnung getragen, dass es den Rahmen der vorliegenden Bearbeitung überschreiten würde, sämtliche Methoden alternativer Streitbeilegung darzustellen, zu denen weiterhin etwa das Schlichtungsverfahren und das Mediationsverfahren zu zählen sind.
Details
- Pages
- 396
- Publication Year
- 2025
- ISBN (PDF)
- 9783631932834
- ISBN (ePUB)
- 9783631932841
- ISBN (Hardcover)
- 9783631932803
- DOI
- 10.3726/b22640
- Language
- German
- Publication date
- 2025 (April)
- Keywords
- Prozessführung Rechtsschutz Schiedsgericht juristische Person Gemeinnützigkeitsrecht öffentliches Recht Zivilrecht Stiftungswesen Stiftungsrecht
- Published
- Berlin, Bruxelles, Chennai, Lausanne, New York, Oxford, 2025. 396 p.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG