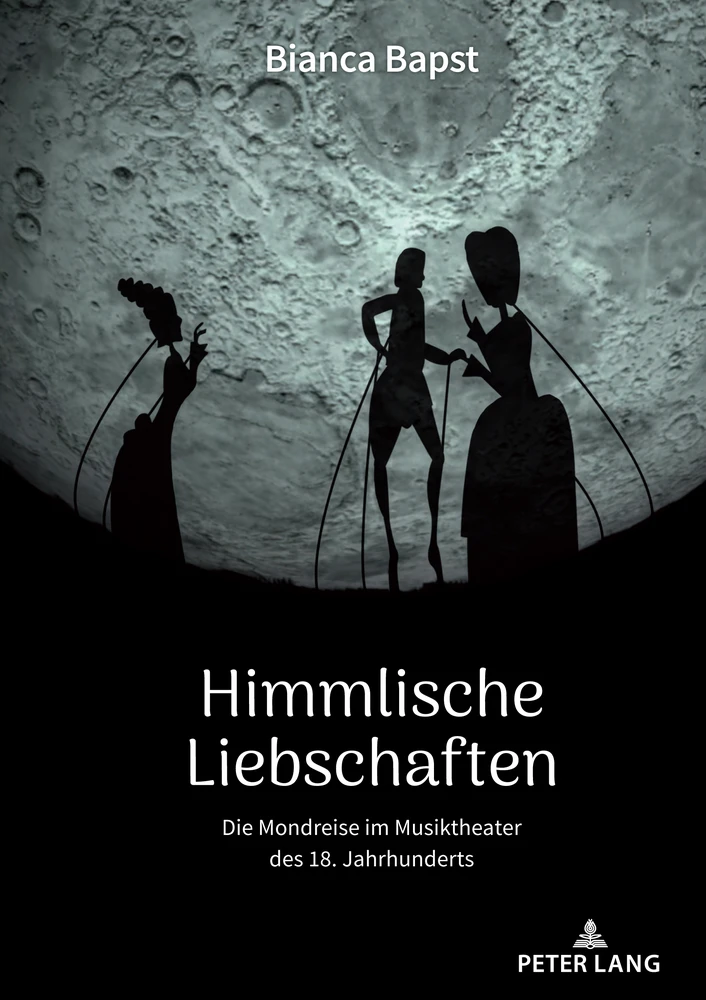Himmlische Liebschaften
Die Mondreise im Musiktheater des 18. Jahrhunderts
Summary
Excerpt
Table Of Contents
- Cover
- Titel
- Copyright
- Danksagung
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Inhalt
- 1: MONDBEGEGNUNGEN
- 1.1. DIE LIEBE UND DER MOND
- 1.2. VIELE MONDE IM MUSIKTHEATER?
- 1.3. FORSCHUNGSSTAND
- 1.4. QUELLENLAGE
- 2: ALLEIN IM UNIVERSUM?
- 2.1. ZUR IDEENLAGE: EINE WELT VS. VIELE WELTEN
- 2.2. LITERARISCHE MONDREISEN ALS IMAGINÄRE RAUMERKUNDUNGEN
- 2.3. ABSEITS DER REALITÄT: DIE BEDEUTUNG IMAGINÄRER MONDWELTEN UND DER BEGRIFF DER GEGENWELT
- 3: REISEN ZUM MOND IM MUSIKTHEATER
- 3.1. SYMBOLIK UND WERKE
- 3.2. DIE ERSTE MONDLANDUNG: EIN 400 JAHRE ALTES THEATERSPEKTAKEL
- 3.3. POPULÄR: DIE MONDREISE IN DER ITALIENISCHEN STEGREIFKOMÖDIE
- 3.4. EXKURS: DER MOND UND SEINE BEZIEHUNG ZUR HARMONIE DES HIMMELS
- 3.5. STUMMER MOND, DU KLINGST SO SCHÖN
- 4: MONDREISEN IM MUSIKTHEATER DES 18. JAHRHUNDERTS IM KONTEXT VON ENTSTEHUNG BIS REZEPTION
- 4.1. IL MONDO DELLA LUNA. DIE WELT AUF DEM MOND VON CARLO GOLDONI (1750)
- 4.1.1. Ein Libretto, viele Opern
- 4.1.2. Text- und Musikquellen
- 4.1.3. Zur Werkgenese: Eine Mondreise im Kontext der Adelsrepublik Venedig
- 4.1.4. Carlo Goldoni und sein Landsmann Baldassare Galuppi
- 4.1.5. Rollen und Erstbesetzung
- 4.1.6. Handlung
- 4.1.7. Szenen und Musiknummern
- 4.1.8. Goldonis Vorbilder und sein Ideal der Einfachheit
- 4.1.9. Wirkung und Rezeption
- 4.2. LA LUNA ABITATA. DER BEWOHNTE MOND VON GIAMBATTISTA LORENZI (1768)
- 4.2.1. Zur Werkgenese: Eine Mondreise im Kontext der Residenzstadt Neapel
- 4.2.2. Text- und Musikquellen
- 4.2.3. Rollen und Besetzung
- 4.2.4. Handlung
- 4.2.5. Szenen und Musiknummern
- 4.2.6. Wenn Habsburg heiratet!
- 4.3. IL REGNO DELLA LUNA. DAS MONDREICH [VON GIUSEPPE PARINI] (1770)
- 4.3.1. Zur Werkgenese: Eine Mondreise im Kontext des Herzogtums Mailand
- 4.3.2. Text und Musikquellen
- 4.3.3. Rollen und Erstbesetzung
- 4.3.4. Handlung
- 4.3.5. Szenen und Musiknummern
- 4.3.6. Die Erben des Kolumbus
- 4.4. NICODÈME DANS LA LUNE. NIKODEMUS AUF DEM MOND VON COUSIN-JACQUES (1790)
- 4.4.1. Zur Werkgenese: Eine Mondreise im Kontext der Französischen Revolution
- 4.4.2. Text- und Musikquellen
- 4.4.3. Rollen und Erstbesetzung(en)
- 4.4.4. Handlung
- 4.4.5. Szenen und Musiknummern
- 4.4.6. Pioniere der Luftfahrt am Ende des Ancien Régime
- 4.5. VIER REISEN, VIER MONDE?
- 5: TÖnender MOnd
- 5.1. Den Mond hören und verstehen
- 5.2. Erhörtes Paradies
- 5.2.1. Die Welt auf dem Mond als pastorale Traumlandschaft
- 5.2.2. Baldassare Galuppis himmlischer Reigen
- 5.2.3. Sinfonische Mondträume bei Piccinni, Haydn und Paisiello
- 5.2.4. Zusammenfassung
- 5.3. Die (über-)menschliche Seite des Mondes
- 5.3.1. Mondmonarch(inn)en
- 5.3.2. Unstete Cintia
- 5.3.3. Starke Astolfina
- 5.3.4. Zusammenfassung
- 5.4. Unerhörte Sehnsüchte
- 5.4.1. Man(n) ist, was Man(n) ist
- 5.4.2. Verticchio – vom Feigling zum Helden?
- 5.4.3. Nikodemus – vom Nichtsnutz zum Teufelskerl?
- 5.4.4. Zusammenfassung
- 6: Zum Schluss
- 6.1. Fazit: Gibt es eine Mondmusik?
- 6.2. Ende gut, alles gut
- Anhang
- I. Abkürzungen
- II. Bibliothekssigel
- III. Personenverzeichnis
- IV. Abbildungen, Tabellen, Schemata, Notenbeispiele
- V. Materialsammlung
- V.1. Werke für das Musiktheater von Carlo Goldoni
- V.2. Werke für das Musiktheater von Giambattista Lorenzi
- V.3. Alle Il mondo della luna-Opern im Detail
- VI. Quellenverzeichnis
- VI.1. Il mondo della luna
- VI.1.1. Musikhandschriften
- VI.1.2. Libretti
- VI.2. La luna abitata
- VI.2.1. Musikhandschriften
- VI.2.2. Libretti
- VI.3. Il regno della luna
- VI.3.1. Musikhandschriften
- VI.3.2. Libretti
- VI.4. Nicodème dans la lune
- VI.4.1. Musikhandschriften
- VI.4.2. Libretti
- VI.5. Sonstige Musikhandschriften und Libretti
- VI.5.1. Endymion-Mythos (Auswahl)
- VI.5.2. Astronomie bzw. Astrologie
- VI.5.3. Sonstige Werke
- VII. Bibliografie
- VII.1. Noteneditionen von Mondreise-Opern des 18. Jahrhunderts
- VII.2. Noteneditionen sonstiger Werke
- VII.3. Primäre Literatur
- VII.3.1. Die Mondreise in Dramen des 17. und 18. Jahrhunderts (Auswahl)
- VII.3.2. Mondreisen in der Literatur (Auswahl)
- VII.3.3. Philosophisch-wissenschaftliche Himmelsbetrachtungen (Auswahl)
- VII.3.4. Sonstige Schriften
- VII.4. Sekundäre Literatur
- VII.4.1. Schriften über den Mond (Auswahl)
- VII.4.2. Musikwissenschaftliche Schriften
- VII.4.3. Sonstige geisteswissenschaftliche Schriften
1 Mondbegegnungen
1.1. Die Liebe und der Mond
Es sind Mysterien, über die man sich viele Geschichten zu erzählen weiß: die Liebe und der Mond. Während die Liebe gerne als Urquell des gesamten Kosmos gesehen wird, dabei geprägt von der Vorstellung, dass sie alles gleichmäßig durchströme und in Harmonie vereine, sagt man dem Mond einen besonderen Einfluss auf das Gefühlsleben der Menschen nach. In vielen Mythologien erscheint er als Göttin, die über die Liebe wacht und Leben spendet. In antiken kosmologischen Vorstellungen sind Liebe und Mond schließlich eng verwoben, denn dadurch, dass er als nächstgelegener Himmelskörper zur Erde mit bloßem Auge zu erkennen war, rückte er immer wieder ins Zentrum der Spekulationen über den Aufbau des Universums. Dabei wurde er Teil sowohl von mystischen Jenseitsvorstellungen als auch von philosophischen Lehrmeinungen über anderes Leben im Universum. Speziell in den philosophischen Lehrmeinungen über den Aufbau des Kosmos spielte die Idee eines harmonischen Weltganzen als eine abstrakte Vorstellung von Liebe eine große Rolle, eines Welteneinklangs bezeichnet als ‚Sphärenharmonie‘, die Allem, den Gestirnen wie Erde und Mond, Mann und Frau, Pflanzen und Tieren usw. innewohne, jedoch mit dem irdischen Ohr nicht zu hören sei. Nur demjenigen, der einen philosophischen Erkenntnisweg eingeschlagen habe – zum Beispiel im Sinne der platonischen Liebe, wenn der Liebende, also der Philosoph, fähig sei, seinen erotischen Drang vom einzelnen schönen Körper auf umfassendere, allgemeinere und damit lohnendere Objekte zu lenken – würde sich diese sogenannte ‚Harmonia aphanes‘ (verborgene Harmonie) durch das innere Ohr offenbaren. Es ist folglich eine Musik, die der Mensch innerlich erlebt und die sich ihm als eine Erfahrung einer überirdischen, göttlichen Macht präsentiert.
Musiktheoretiker, Musiker und Komponisten versuchten im Laufe der Geschichte immer wieder das Wesen der Sphärenharmonie zu ergründen und sie in real klingende Musik zu übersetzen. Insbesondere die Vorstellung, dass sie würdevoller als alle irdische Musik sei, war dabei bedeutsam. Ein kompositorisches Ergebnis war beispielsweise die Huldigung eines Fürstenpaares im metaphorischen Sinne: L’armonia delle sfere (Die Harmonie der Sphären) von Cristofano Malvezzi heißt das erste Intermedium von insgesamt sechs, die für die Komödie La pellegrina des Dichters Girolamo Bargagli entstanden sind und zu Ehren der Hochzeit von Ferdinando I. de Medici mit Christine von Lothringen am 2. Mai 1589 im Uffizientheater in Florenz aufgeführt wurden. Verarbeitet ist darin das Motiv der Sphärenharmonie nach dem kosmologischen Jenseitsbericht am Ende von Platons Politeia (Der Staat). Darin erscheinen Sirenen als Erzeugerinnen von Tönen, die sich zu einer einzig(artig)en Harmonie fügen. Jede Sirene steht dabei für einen Planetenkreis, die bei Platon noch als ineinander geschachtelte Ringe als Weltkreis gedacht waren. Nach antiker Vorstellung stellten die Sirenen Mischwesen mit einer besonderen Affinität zur Musik dar, die teils wie Mädchen, teils wie Vögel aussahen und mit den Musen verschwistert waren. Meistens diente ihr wortlos schöner Klang dazu, die Verstorbenen ins Jenseits zu überführen. Dieser Klang wurde wie die Sphärenharmonie von göttlicher Abkunft interpretiert und stand der wortgebundenen irdischen Gesangskunst von Orpheus gegenüber, der wie die Sirenen ein Wanderer zwischen den Welten war, nur dass er die Verstorbenen ins Leben zurückholte. Homers Odyssee zeigt ferner einen anderen Zweig des Sirenenmythos auf.
In Cristofano Malvezzis Intermedium steigen die Sirenen gemeinsam mit der Sphärenharmonie, die personifiziert erscheint, vom Himmel herab, um das Brautpaar zu ehren und zu preisen. Bei dieser ersten, musikalisch groß inszenierten ‚himmlischen Medici-Hochzeit‘ sollte es natürlich nicht bleiben, denn im Musiktheater des 18. Jahrhunderts verbinden sich Liebe und Himmel bzw. himmlisches Dasein gewissermaßen im Mond. In diesem Zeitalter ist die Mondreise eine wahre Herzensangelegenheit, wo sich die Liebenden suchen und es ums Heiraten geht – oder zumindest darum, den Wunschpartner bzw. die Wunschpartnerin zu finden. Es sind Geschichten, die im Kontext dieses nicht irdischen, sondern überirdischen Schauplatzes folglich von himmlischen Liebschaften erzählen.
1.2. Viele Monde im Musiktheater?
Jeder Blick zum Mond ist mit einer Erfahrung verbunden. Diese kann individuell stattfinden oder kollektiv geprägt sein. So kam es, dass manche ihn zur Gottheit machten, manche zum Studienobjekt und manche zur Projektionsfläche für etwas, das sie sich sehnsüchtig wünschten. Etliche Bilder und Mythen berichten von diesen sehr unterschiedlichen Wahrnehmungen und geben dem Mond eine vielschichtige Symbolik. Verbindet sich nun Musik mit dem Mond, beispielsweise durch einen poetischen Text oder vielleicht nur durch eine Überschrift, ist die Musik mit mindestens einer Bedeutung aus der Deutungsvielfalt des Mondes assoziiert. Oft begegnet der Mond als Stimmungsmacher, als Ausdruck des Nächtlichen oder nächtlicher Daseinszustände wie im Abendlied Der Mond ist aufgegangen von Johann Abraham Peter Schulz aus dem Jahr 17901, in Johannes Brahms’ erster Klaviersonate, deren zweiter Satz inspiriert ist von den Zeilen eines alten Minnelieds mit dem Titel Verstohlen geht der Mond auf2 oder idealtypisch verwirklicht in Robert Schumanns Mondnacht nach einem Gedicht von Joseph von Eichendorff3. Liegt der Musik eine Handlung zugrunde, wie im Musiktheater, tritt der Mond in deren Dienst. Meist rückt er dabei in den Hintergrund, er verschwindet ins Nebensächliche und erscheint beiläufig wie etwa in der berühmten Anbetungsarie Casta Diva (Keusche Göttin) der Norma4, im mysteriösen Mondchor Perché tarda la luna (Warum verspätet sich der Mond) in Turandot5 oder im Lied an den Mond der Titelheldin Rusalka6. Mondestrunken wie Rusalka gibt sich im Schein des Vollmondes auch Lady Sarashina7 – die Titelheldin einer Oper von Péter Eötvös aus dem Jahr 2008 –, während sich Madame Butterfly8 im Rausch der Liebe eher wie eine Mondgöttin fühlt.
Viele Mythen ranken sich um die Mondgöttin. Der bedeutsamste ist der Endymion-Mythos aus der griechisch-römischen Mythologie, der die tragische Liebesgeschichte zwischen ihr und dem sterblichen Hirtenprinzen Endymion erzählt. Damit die Liebenden länger als ein Menschenleben vereint bleiben können, versetzt der oberste aller Götter, Zeus, den Hirtenprinzen in einen ewigen Schlaf, aus dem ihn nur seine Geliebte, die Mondgöttin, wecken kann. Typisch für den antiken Mythos sind seine pastoralen Bilder, die Endymion und die Mondgöttin stets im Einklang mit der Natur zeigen. Dies mag das abgebildete antike Fresko (Abb. 1) demonstrieren, das zu den Ausgrabungen in Pompeji gehört und eines der bedeutsamsten Motive aus dem Mythos aufgreift. Dargestellt ist die Episode, wenn die Mondgöttin des Nachts vom Himmel herabsteigt, um sich mit Endymion zu vereinigen. In der Malerei ist es bis weit ins 18. Jahrhundert hinein ein vielzitiertes Motiv.

Abbildung 1: Der Hirtenprinz Endymion und die Mondgöttin Selene. Antikes Fresko aus Pompeji.
Pompeji VI, 9, 6–7 Casa dei Dioscuri, triclinium (38) | mit freundlicher Genehmigung des Ministero della Cultura – Museo archeologico nazionale di Napoli | Inv. Nr. 9240, Fotografie © Giorgio Albano.
Im Musiktheater fand der Mythos spätestens im 17. Jahrhundert mit Werken wie Diana schernita9 von Giacinto Cornacchioli (1629), La Calisto10 von Francesco Cavalli (1651), L’Endimione11 von Giuseppe Tricarioco (1655), Endimione12 von Giovanni Bononcini (1706), Endymion13 von François Collin de Blamont (1731) und vor allem durch das vielvertonte Libretto von Pietro Metastasio namens L’Endimione14 aus dem Jahr 1721 seine Verbreitung. Andere Begegnungen mit dem Mond in menschlicher Gestalt gab es im Musiktheater erst im 20. Jahrhundert wieder, beispielsweise als der Komponist Wolfgang Fortner 1957 eine Tragödie des spanischen Autors Federico García Lorca zu einem Werk für das Musiktheater machte: Bluthochzeit15 zeigt den Mond personifiziert als surrealen Agenten des Todes, in dessen Beisein sich ein schrecklicher Mord ereignet. Surreales enthält auch das japanische Märchen der Mondprinzessin Kaguya in Taketori Monogatari, das der Oper From the Towers of the Moon16 des amerikanischen Komponisten Robert Moran aus dem Jahr 1992 zugrunde liegt. Als Findelkind von einem japanischen Bambussammler gefunden, wächst Kaguya auf der Erde zu einer strahlend schönen Frau heran. Ihre Schönheit zieht zahlreiche Verehrer an, darunter auch den Kaiser. Jedem der Freier stellt Kaguya zur Probe eine Aufgabe. Niemand aber kann das Rätsel lösen und so muss Kaguya am Ende jungfräulich zum Mond zurückkehren.
Ähnliche Motive von Tod und Geburt klingen in der bleichen Figur des Pierrots in Arnold Schönbergs Melodram Pierrot lunaire17 von 1912 an. Pierrot ist die französische Verkleinerungsform von Pierre und hat sich aus dem Pedrolino, einer Bühnenfigur der Commedia dell’arte, entwickelt. Er schmachtet nach Colombina, die ihm aber meist die quirlige Figur des Harlekin vorzieht. Nach dem Verschwinden der Commedia dell’arte fand Pierrot im Typus des melancholischen und traurigen Clowns seine Fortsetzung. Unsterblich machte ihn im 19. Jahrhundert der französische Pantomime Jean-Gaspard Deburau, der Pierrot zu einem schweigend leidenden, mondsüchtigen Verliebten machte. 1884 veröffentlichte Albert Giraud den Gedichtzyklus Pierrot lunaire, den Otto Erich Hartleben um 1892 frei ins Deutsche übersetzte. Der deutschen Übertragung entnahm als erster 1904 der Komponist Otto Vrieslander 46 Dichtungen für einen Liederzyklus18, dann als zweiter Arnold Schönberg 21 Dichtungen für sein op. 21, die er in drei Gruppen zu jeweils sieben Liedern ordnete. Das Besondere am Pierrot lunaire ist seine ‚kontinuierliche handlungstragende Mondmetaphorik‘, welche das Werk kategorisch von den vielen zuvor zitierten, beiläufigen Mondbegegnungen im Musiktheater unterscheidet. Sie stellt im Gegensatz dazu die ganze Essenz der Handlung dar und ist deshalb unentbehrlich.
Vergleichbares vollzieht sich in Carl Orffs Oper Der Mond19 von 1939, die auf dem gleichnamigen Märchen der Gebrüder Grimm basiert. Es erzählt davon, wie einst vier Burschen aus einem Land ohne Mond auf Wanderschaft gehen und in einem anderen Land einen Mond finden, den sie stehlen. Als die Vier dann im Alter sterben, nimmt jeder ein Viertel des Mondes mit ins Grab. Auf diese Weise gelangt er ins Reich der Toten, wo er – wieder zu einem Ganzen vereint – so hell scheint, dass er die Verstorbenen aus ihrem Totenschlaf erweckt. Bald geht es im Reich der Toten ähnlich laut zu wie im Reich der Lebenden, was Petrus, der über die Toten wacht, natürlich gar nicht gefällt. Er holt den Mond aus dem Totenreich, sorgt so für Ruhe und hängt ihn dorthin, wo wir ihn heute alle aufgehoben wissen, nämlich in den Himmel.
Meistens basieren ‚handlungstragende Monde‘, so wie sie uns in Schönbergs Pierrot lunaire oder in Orffs Der Mond begegnen, auf literarischen Vorlagen. Einmal ins Musiktheater übertragen, erscheinen sie dann auch selten ein zweites Mal. Es handelt sich um Raritäten und um keine beliebten Opernstoffe. Die einzige und besondere Ausnahme davon stellt die Mondreise dar. Sie ist ein Sujet, das ähnlich dem Mythos der dichterischen Bearbeitung offensteht und deshalb mehrfach unterschiedlich im Musiktheater erscheint. Zu Grunde liegt der Mondreise eine ganz eigene Mondmetaphorik, die sich aus dem Naturempfinden der alten Zeit ableitet und nur bedingt etwas mit Science-Fiction zu tun hat. Vielmehr geht es um die Ordnung der Welt, wie sie seit der Antike in Philosophie, Wissenschaft und Mythologie diskutiert wurde. Bedeutsam für die Mondreise sind besonders die neue Astronomie und die kopernikanische Wende, deren Hauptvertreter bis heute Nikolaus Kopernikus, Galileo Galilei und Johannes Kepler sind.
Darüber hinaus hat jede Mondreise individuelle Bezugspunkte, nicht nur in der Literatur, im Volks- und im Aberglauben, sondern auch in Geschichte und Gesellschaft. Diese individuellen Bezugspunkte geben jeder Mondreise eine zeitliche und/oder räumliche Bestimmung, die zur Folge hat, dass sich Sinn und Zweck einer jeden Mondreise jeweils nur begrenzt vermitteln können. Besonders der technische Fortschritt sorgt dafür, dass Mondfahrten schnell altern, weil er unaufhörlich das Gesicht des Mondes und die Methoden verändert, die eine Reise zum Mond plausibel machen sollen: Trugen einst Vögel oder Segelschiffe den Menschen zum Mond, waren es später Heißluftballone oder Raketen.
Zentral für die Symbolik der Mondreise ist bis zum ersten echten bemannten Mondflug im Apollo-Programm der 1960er Jahre die Tatsache, dass der Mond unerreichbar fern am Himmel schien. Er befand sich außerhalb des menschlichen Erfahrungshorizonts – ein Umstand, der ihn lange Zeit zu einem ganz besonderen, wenn nicht sogar einzigartigen Schauplatz in der Literatur und im Theater machte. Flog jemand zum Mond, dann verließ er die bekannte, irdische Welt, um in eine unbekannte, überirdische einzudringen, über deren Existenz und Beschaffenheit nur spekuliert werden konnte. Diese Spekulationen waren teils religiös, teils wissenschaftlich konnotiert und reichten, wie bereits angesprochen, von Ideen, die den Mond entweder zu einem Ort oder einer Station im Jenseits machten, bis hin zu der Annahme, dass der Mond auch eine andere Welt sein könnte, die genauso Leben schenkend war wie die Erde. Letzteres stellt für uns heute nichts Ungewöhnliches mehr dar, weil die Suche nach anderem Leben im Universum längst zur seriösen Wissenschaft geworden ist. In einer stark von Gott und Kirche geprägten Lebenswirklichkeit der Menschen aber war dies anders, weil sich darin Zweifel an der Einzigartigkeit der Erde und damit am gesamten göttlichen Schöpfungsakt äußerten. Folglich war die Gegenüberstellung von Erde und Mond im Sinne zweier Welten wie in der Mondreise nicht zu jeder Zeit ganz unproblematisch.
Stellt sich die Frage, was die Musik in Bezug auf eine solch außergewöhnliche Symbolik imstande ist zu leisten. Vermag sie es überhaupt, etwas zu schildern, das wie der Mond über den menschlichen Erfahrungshorizont hinausreicht, womöglich sogar so, dass sich Erde und Mond in der Gegenüberstellung musikalisch für den Rezipienten im Musiktheater unterscheiden könnten? Gibt es eine Musik, die allein für den Mond steht, eine sogenannte ‚Mondmusik‘? Aufgrund der vielschichtigen Symbolik des Mondes beschränkt sich die vorliegende Arbeit aber nicht nur auf einfache illustrierende musikalische Wortausdeutungen, die meistens so sehr beliebig sind, dass sie in jeden anderen Kontext ihre Verwendung finden können, sondern sie sucht vielmehr auch nach speziellen Ausdrucksmöglichkeiten, die ganz allein für den Mond reserviert sind. Die Symbolik des Mondes dient dabei als Hinweis außermusikalischer Art. Eine Option wäre zum Beispiel das Aufgreifen der Harmonie der Sphären wie in Cristofano Malvezzis Intermedium L’armonia delle sfere (Die Harmonie der Sphären), wodurch die Bedeutung und die Aussage der Musik sehr tiefgründig gestaltet wären. Die Idee, dass der gesamte Kosmos harmonisch geordnet und von Musik durchdrungen sei, war lange Zeit eine vollkommene und unveränderliche wissenschaftliche Konstante, die die Erforschung der Welt stets begleitete. Ein Beispiel gibt Johannes Kepler, der in seinem 1619 erschienen Hauptwerk Harmonice mundi (Weltharmonik) nicht nur an die von Pythagoras entwickelte Vorstellung einer Sphärenharmonie anknüpft, sondern auch von einer Übereinstimmung zwischen musikalischen Intervallen und bestimmten Verhältnissen der Winkelgeschwindigkeiten im Planetensystem ausgeht. Noch bis weit ins 18. Jahrhundert hinein beschäftigte die Sphärenharmonie die Gelehrtenwelt, darunter Musiktheoretiker, ebenso Musiker und Komponisten. Folglich existieren nach Malvezzis Intermedium noch einige weitere Versuche, die Sphärenharmonie auf dem Gebiet der dramatischen Musik in real klingende Musik zu übertragen, zum Beispiel im Aufzug Die sieben Tugenden, Planeten, Töne oder Stimmen20 von Sigmund Theophil Staden von 1645 oder in der Serentata Il sogno di Scipione21 von Wolfgang Amadeus Mozart von 1772, in der die historische Figur des Scipio Aemilianus aus Ciceros Somnium Scipionis im Traum die seltene Gelegenheit erhält, die Sphärenmusik zu hören.
1.3. Forschungsstand
Im Bereich des Musiktheaters ist die Mondreise bislang kaum erforscht. Nach wenigen werkspezifischen Arbeiten, die Genese und Bedeutung der Mondreise im Musiktheater bestenfalls nur streifen, ist die vorliegende Studie die erste ausführliche Publikation zum Thema, mit einem Werkverzeichnis und mit Erläuterungen zur Entwicklung des Sujets im Theater. Da viele der gelisteten Werke lange Zeit in Vergessenheit geraten waren, konzentriert sich ein Großteil der Forschungsliteratur auf die populären Werke, wie die Oper Il mondo della luna22 (Die Welt auf dem Mond) oder Arnold Schönbergs Melodram Pierrot lunaire23. Eine Besonderheit stellt die Studie Italian Opera in the age of the American Revolution (Italienische Oper im Zeitalter der Amerikanischen Revolution) von Pierpaolo Polzonetti dar. Sie enthält Abschnitte zur Mondreise, worin der Mond im Musiktheater des 18. Jahrhunderts von einem transatlantischen Standpunkt aus als Symbol für Amerika bewertet wird.24 Zuspruch erhält Polzonetti von anderen englischsprachigen, transatlantischen Musikwissenschaftlern wie dem Australier Lawrence Mays, der 2017 eine bis dahin wenig bekannte Mondreise-Oper, die Opera buffa Il regno della luna (Das Mondreich), kritisch ediert vorgelegt hat.25 Polzonetti zufolge war die Amerikanische Revolution von richtungsweisender Bedeutung für die europäische Opernkultur. Vielfach hätten Komponisten die revolutionären Ideen, die aus der Neuen Welt ins alte Europa strömten, in ihren Werken verarbeitet. Ihre Rezeption zeige sich nicht nur anhand von Werken mit einem direktem Amerika-Bezug, sprich Amerika ist Schauplatz der Handlung, sondern auch anhand eines so schwer zugänglichen Ortes wie dem Mond, und zwar als eine Anspielung auf die Entdeckung Amerikas. Dieser Interpretation mag grundsätzlich nicht widersprochen werden, insbesondere weil sie anhand der Beispiele schlüssig klingt und viele beziehungsreiche Denkanstöße gibt.26 Jedoch ist sie nicht pauschal auf jede Mondreise im Musiktheater des 18. Jahrhunderts anwendbar, da es auch noch andere historische Bezugssysteme gibt, die im Einzelfall bedeutsamer sind.
1.4. Quellenlage
Die Betrachtung der Mondreise im Musiktheater basiert auf einer sehr umfangreichen Recherche, die eine große Anzahl an Quellen höchst unterschiedlicher Art, darunter Musikhandschriften, Noteneditionen, Textbücher, Briefe, zeitgenössische Schriften usw., und in höchst unterschiedlichen Erhaltungszuständen ergab – unmöglich, sie hier alle im Detail zu nennen. Stattdessen kann die komplette Materialsammlung im Quellenverzeichnis und in der Bibliografie – zu finden im Anhang ab Seite 345 – eingesehen und nachvollzogen werden. Fast alle der dort aufgeführten Quellen waren zugänglich, entweder durch das digitale Angebot von Bibliotheken und Archiven weltweit, via Datenbanken im World Wide Web oder auf Bestellung bei der jeweiligen Einrichtung.
Grundsätzlich lässt sich das recherchierte Quellenmaterial in zwei Rubriken unterscheiden. Die erste Rubrik sichert den Werkbestand, sie gibt Auskunft über Titel, Kontext und Rezeption der Werke. Zu ihr gehören:
- erstens, eine kleine Anzahl an kritischen Noteneditionen unterschiedlichster Qualität;
- zweitens, etliche Musikhandschriften, die so manches Werk mit einer gewissen Unschärfe zeichnen, weil aufgrund verschiedener Aufführungen mehrere Musikhandschriften für ein einziges Werk existieren, die einander nicht identisch sind;
- drittens, unzählige Textbücher, die in der Regel zum Verkauf im Rahmen einer Aufführung gedacht waren;
- viertens, sekundäres Schriftgut, welches aufgrund seines Alters mittlerweile selbst eine Quelle darstellt;
- fünftens, Register verschiedenster Art
- und sechstens, diverse Lexika.
Nicht jede der sechs genannten Quellensorten ist zuverlässig. Mit Vorsicht sind zum Beispiel alte Register und Lexika zu behandeln, da sie eine Reihe von Irrtümern enthalten können. Ein Beispiel gibt das französische Opernnachschlagewerk von Felix Clément und Pierre Larousse, erschienen Ende des 19. Jahrhunderts. Darin werden einzelne Werke nicht nur den falschen Komponisten zugeschrieben, sondern die Autoren sind auch wenig exakt bei der Angabe der Aufführungsorte und - jahre.27
Die zweite Rubrik umfasst schließlich Quellen, welche die historische Umgebung der jeweiligen Werke nachzeichnen. Gemeint ist damit zeitgenössisches Schriftgut, das entweder in direkter oder indirekter Verbindung mit den Titeln steht, wie beispielsweise Briefe oder (auto-)biografische Aufzeichnungen. Darüber hinaus zählen dazu auch solche Schriften, die den geistigen Hintergrund abbilden, wie philosophisch-wissenschaftliche Himmelsbetrachtungen, diverse Mondmythen usw.
1 Vgl. Abendlied Der Mond ist aufgegangen, in: Schulz: Lieder im Volkston, 1790, S. 52.
2 Vgl. Brahms: Sonate C-Dur für das Pianoforte op. 1, [1854], S. 13–16.
3 Vgl. Schumann: Mondnacht, in: Robert Schumanns sämtliche Werke, hrsg. v. Clara Schumann, Serie XIII, Bd. 9: Liederkreis. Zwölf Gesänge von Joseph v. Eichendorff op. 39, 1885, S. 10 f.
4 Vgl. Casta Diva (Akt I, Szene 4) in: Norma, tragedia lirica v. Vincenzo Bellini, Libr. v. Felice Romani, UA: Mailand 1831.
5 Vgl. Perché tarda la luna (Akt I, Szene 5) in: Turandot, dramma lirico v. Giac. Puccini, Libr. v. Giu. Adami u. Renato Simoni n. Carlo Gozzi u. Fried. Schiller, UA: Mailand 1926.
6 Vgl. Lied an den Mond (Akt I, Szene 1) in: Rusalka, lyrisches Märchen v. Antonín Dvořák, Libr. v. Jaroslav Kvapil n. Fried. de La Motte Fouqués Undine, UA: Prag 1901.
7 Vgl. Szene 5 in: Lady Sarashina, Oper in neun Szenen v. Péter Eötvös, Libr. v. Mari Mezei, UA: Lyon 2008.
8 Vgl. Somiglio alla dea della luna (Akt I) in: Madame Butterfly, tragedia giapponese v. Giac. Puccini, Libr. v. Giu. Giacosa u. Luigi Illica n. David Belasco, UA: Mailand 1904.
9 Diana schernita, favola boscareccia, posta in musica da Giacinto Corna[c]chioli d’Ascoli, posta in versi dal sig. Giac. Fran. Parisani d’Ascoli, rappres. in casa dell’ illustriss. sig. Gio. Rodolfo baron de Hohenrechberg, Roma: Gio. Battista Robletti 1629.
10 La Calisto, dram[m]a per musica di Gio. Faustini, favola decima [M.: Fran. Cavalli], Venezia: [per il Giuliani / Giac. Batti] 1651.
11 L’Endimione, dram[m]a del Dott. Almerico Passarelli, posta in musica dal signor Giu. Tricarico, mastro di capella nell’accademia dell spirito Santo di Ferrara […], Ferrara: Fran. Suzzi 1655.
12 Endimione, favola per musica nel giorno del gloriosissimo nome […] dell’imperatirice Amalia Willelmina, per comando […] di Giuseppe I. imperator de’ Romani […], poesia del sig. Fran. de Lemene, musica del sig. Gio. Bononcini […], Vienna: appresso gli Heredi Coseroviani 1706.
13 Endymion, pastorale héroïque, paroles de Fontenelle, mise en musique par Mr Collin de Blamont, représ. par la 1e fois par l’académie Royale de musique le 15e jour de juin 1731, Paris: J. B. Christophe Ballard 1731.
14 Vgl. Neville: Art. Metastasio [Trapassi], Pietro, in: Grove Music Online, URL: <https://doi-org.ubproxy.ub.uni-heidelberg.de/10.1093/gmo/9781561592630.article.53181> (Stand: 24. Feb. 2022).
Details
- Pages
- 388
- Publication Year
- 2024
- ISBN (PDF)
- 9783631911440
- ISBN (ePUB)
- 9783631911457
- ISBN (Hardcover)
- 9783631911433
- DOI
- 10.3726/b21359
- Language
- German
- Publication date
- 2025 (February)
- Keywords
- Mondreise Oper 18. Jahrhundert Musiktheater Mondreise im Musiktheater
- Published
- Berlin, Bruxelles, Chennai, Lausanne, New York, Oxford, 2024. 388 S., 25 farb. Abb., 45 s/w Abb., 18 Tab.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG