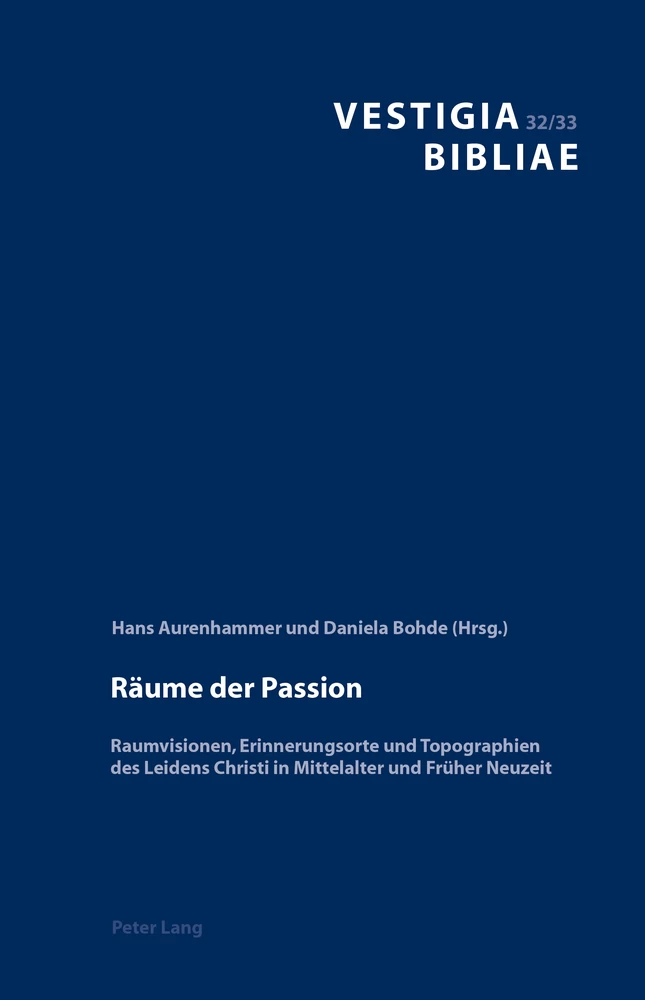Räume der Passion
Raumvisionen, Erinnerungsorte und Topographien des Leidens Christi in Mittelalter und Früher Neuzeit
Summary
Excerpt
Table Of Contents
- Cover
- Titel
- Copyright
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Inhaltsverzeichnis
- Die Räume der Passion – eine übersehene Dimension?
- 1. ‚Loca sancta‘
- Golgatha – Etablierung, Transfer und Transformation. Der Kreuzigungsort im frühen Christentum und im Mittelalter
- Abbildungsnachweis
- The Rock of Golgotha in Jerusalem and Western Imagination
- The Rock of Golgotha in the eye of the believer
- The Rock, the rupture and the hole: synecdochal relations
- The Rock of Golgotha and the clefts of the rock
- Illustration credits
- Körper und Karte – Historizität, Topographie und Vermessung medialer Wissensräume der Passion in der Frühen Neuzeit bei Christiaan van Adrichem und anderen
- Geographia sacra: Kartographie und Kreuzweg
- Der heilige Körrper und seine wissenschaftliche Konstruktion
- Geglaubtes Wissen – wissender Glaube
- Abbildungsnachweis
- 2. Re-Inszenierungen
- Ereignisraum Jerusalem. Zur Konstituierung eines Sakralraumes vor den Mauern der Stadt Nürnberg
- Einleitung
- Der Weg zum Heiligen Grab
- Die eigene Stadt wird zum Ereignisraum Jerusalem
- Neues durch Wiederholung und Illusion trotz besseren Wissens
- Abbildungsnachweis
- Bildskeptische Nachbildungsmodi der Passionstopographie Christi im Spätmittelalter: der Görlitzer Kalvarienberg
- Abbildungsnachweis
- Golgatha, Now and Then: Image and Sacrificial Topography in Late Medieval and Early Modern Europe
- Illustration credits
- 3. Schauspiel, Liturgie, Prozession
- Theatralität und Bild im spätmittelalterlichen Passionsspiel. Zum Verhältnis von Gewaltdarstellung und compassio
- 1. Forschungspositionen zur Gewaltdarstellung und Theatralität
- 2. Die Inszenierung der Täter-Opfer-Interaktion
- 3. Die Ausstellung des Leidens
- 4. Fazit
- Abbildungsnachweis
- Räume der Passion im spätmittelalterlichen Basel. Eine Lektüre des Ceremoniale Basiliensis Episcopatus
- I
- II
- III
- IV
- Abbildungsnachweis
- Der bildmediale Parcours durch den Passionsraum: Immersive und operative Praktiken in dem Pariser Holzschnitt der Grande Passion und in Memlings Turiner Passion
- I. Der Aufstieg zum christlichen Tugendberg: La Grande Passion
- II. Raum als operatives An-Ordnungsprinzip der Orte
- III. Die Turiner Passion, Jerusalem und der Raum der Brügger Heiligblutprozession
- IV. Raumkunst – Mittelalterliche Bildpraktiken und zeitgenörssische Computerspiele
- 4. Das Buch als Andachtsraum
- The Passion in Paradise: Liturgical Devotions for Holy Week at Helfta and Paradies bei Soest
- Inner Space in the Legatus divinae pietatis
- Passion Piety at Paradies bei Soest
- Illustration credits
- Räume des Mitleidens. Text-Bild-Beziehungen in einem spätmittelalterlichen Mariengebetbuch (Frankfurt, UB, Ms. germ. oct. 45)
- 1. Passion und Compassio
- 2. Gebet zu den Sieben Schmerzen
- 3. Stabat mater
- 4. Gebet zu den Zwörlf Schmerzen
- 5. Gebete zum Mitleiden und sechs Wehrufe Marias
- 6. Gebete zum Mitleiden und zehn Wehrufe Marias
- 7. Räume des Mitleidens
- Abbildungsnachweis
- 5. Bildräume der Imagination
- Schräge Blicke, innere Landschaften: Räume der Kreuzigung Christi bei Jacopo Bellini, Giovanni Bellini und Antonello da Messina
- Perspektivierung und Kontingenz: Zeichnungen von Jacopo Bellini
- Ver-Rückungen: Carlo Crivelli und Giovanni Boccati
- Figuren der Reflexion: Giovanni Bellinis Kreuzigung im Museo Correr
- Landschaft als Raum der Meditation: Antonello da Messina
- Abbildungsnachweis
- Blickräume – Der Raum des Betrachters in Passionsdarstellungen von Schongauer, Baldung und Altdorfer
- Abbildungsnachweis
- 6. Bilder im Raum
- Im Raum des Bildes. Die ‚fehlenden‘ Passionsszenen in der Karlsteiner Heilig-Kreuz-Kapelle
- Karl IV. und die Reliquien
- Die Heilig-Kreuz-Kapelle
- Bild und Raum der Passion
- Der Raum des Visuellen
- Der Raum des Bildes
- Der Raum des Betrachters
- Abbildungsnachweis
- Violent Spaces and Spatial Violence: Pordenone’s Passion frescoes at Cremona Cathedral
- Illustration credits
- Die Autorinnen und Autoren des Bandes
| 1 →
Die Räume der Passion – eine übersehene Dimension?
Die Passion Christi zählt fraglos zu den prägenden Narrativen der europäischen Kultur. Die Steigerung des Leidens bis hin zum Kreuzestod und die anschließende Umkehrung durch Auferstehung und triumphale Himmelfahrt boten nicht nur ein nachhaltiges Modell für die Interdependenz von Leid und Erlösung, sondern genauso ein Konzept zeitlicher Entwicklung: Lebenszeit, Tod und die Überwindung von Zeitlichkeit werden in der Passionsgeschichte paradigmatisch verknüpft. Anders als diese evidente Zeitstruktur rückte die spezifisch räumliche Dimension der Passion Christi erst in den letzten Jahren in den Fokus. Die aktuelle Diskussion in den Sozial- und Kulturwissenschaften hat die vermeintliche Selbstverständlichkeit der Kategorie ‚Raum‘ auf produktive Weise in Frage gestellt. Entsprechend macht die neuere Kartographie-Forschung deutlich, dass Karten nicht einfach einen präexistenten Raum verbildlichen, sondern ‚Raum‘ überhaupt erst schaffen. Raum ist hier nicht ohne seine mediale Gestalt zu denken.1 Wie unterschiedlich Raum erfahren und gedacht werden kann, zeigt auch die interdisziplinäre Erforschung ← 1 | 2 → von Wallfahrten, Prozessionen und anderen paraliturgischen Raumpraktiken.2 Dass Raum hier nicht nur als materieller, etwa architektonisch geformter Containerraum und als sozial wie kulturell kodierter Handlungsraum erscheint, sondern gleichermaßen als imaginärer Raum, das wird besonders drastisch an der geistigen Pilgerschaft deutlich. Ihre Pilgerreisen kommen nie im fernen Palästina an, sondern finden in der Ortskirche statt oder während der Lektüre des Pilgerreiseführers, mithin im Raum der Imagination. Diese raumhistorischen und -theoretischen Forschungen gaben für die in diesem Band diskutierte Frage nach den ‚Räumen der Passion‘ wichtige Impulse.
Ein Großteil der hier versammelten Texte basiert auf einer Tagung, die vom 8.–10. Juli 2011 an der Frankfurter Johann Wolfgang Goethe-Universität stattfand. Unser Interesse galt damals und gilt auch in dem vorliegenden Band historischen Raumkonzepten und -semantiken, die sich im Kontext der Passionsfrömmigkeit herausbilden: Wie inszeniert man die Orte der Passion Christi im Heiligen Land, wie imaginiert man sie sich aus der Ferne, was für Räume schafft man, um der Passion zu gedenken? Die Themenfolge setzt dabei in der konstantinischen Ära ein und geht bis in die Zeit um 1600. Erfasst werden kann so die Inszenierung oder Schaffung der loca sancta seit der christlichen Spätantike, aber auch die beispiellose Intensivierung der Passionsmemoria im Spätmittelalter und ihre Neuakzentuierung im Zeitalter der Konfessionalisierung. Die Beiträge thematisieren Topographien und räumliche Inszenierungen, geistliche Spiele, sakrale Prozessionen und Hinrichtungsrituale, Architekturen und Skulpturen, Reliquien und ihre Behältnisse, Wandgemälde und Buchillustrationen, Kapellenausstattungen und Tafelbilder sowie Karten. Eine gleichmäßige Ausleuchtung des Zeitraums in allen seinen Medien war jedoch nicht unser Ziel. Auch bei der geographischen Verteilung haben sich bestimmte Schwerpunkte ergeben: Der deutsche Sprachraum überwiegt. Die meisten Beiträge behandeln die Geschichte der bildenden Kunst und der Architektur; dem interdisziplinären Zuschnitt des Projekts entsprechend treten dazu aber auch Autorinnen und Autoren aus den Literatur- und Theaterwissenschaften sowie der Geschichte.
Alle Passionsschilderungen – seien sie sprachlicher oder visueller Art – entwerfen einen Raum. Die Stationen Christi in Jerusalem werden schon im ← 2 | 3 → biblischen Bericht genau verzeichnet: Einzug in die Stadt, Beten am Ölberg, die Gefangennahme im Garten Gethsemane, die Verhöre und Misshandlungen in den Palästen von Hannas, Kaiphas und Pilatus sowie schließlich die Kreuzigung auf Golgatha.3 Diese Topographie der Passion, die man durch Kultstätten wie die Grabeskirche beständig veränderte, wurde zum Ziel der Jerusalem-Wallfahrten. Doch darüber hinaus wurde sie zum Vorbild für Prozessionen, Kreuzwege und Kalvarienberge an anderen Orten. Das einmalige Jerusalem multiplizierte sich. Die europäischen Landschaften bevölkerten sich aber nicht nur mit zahllosen Multiples der loca sancta, sondern es entstanden gleichzeitig hybride Räume, Räume, die einerseits ein fränkischer Straßenzug sein konnten, andererseits die Via dolorosa, einerseits eine piemontesische Hügellandschaft, andererseits die kompletten Heiligen Stätten.4
Diese hybriden Räume stehen im Zentrum unseres Interesses. Eine Voraussetzung ihrer Mehrfachkodierung ist die Imaginationsleistung der Raumnutzer. Diese müssen die ihnen aus dem Alltag ganz anders bekannten Topographien oder Architekturen mit der Passionsgeschichte verknüpfen und dann als das Haus des Pilatus oder das Heilige Grab identifizieren. Wie schon Richard Krautheimer aufgezeigt hat, ist dafür nicht unbedingt eine formale Ähnlichkeit der Bauten notwendig.5 Maßverhältnisse können eine Rolle spielen, aber auch die Bebilderung sowie die rituelle Inszenierung mit entsprechenden visuellen oder akustischen Markierungen. Wenn die Besucher dieser Orte ihr religiöses Wissen aktivieren oder sich vom Dargebotenen affizieren lassen, reagieren sie ähnlich auf sie wie auf Bilder und Skulpturen, bei denen die identifizierende und ergänzende Imagination der Betrachterinnen und Betrachter notwendig ist. Devotionale und ästhetische Herangehensweisen verschränken sich. Eine doppelte Kodierung kennzeichnet auch die in den Bildwerken dargestellten Orte und Räume: So ist beispielsweise auf der Tuchertafel von 1485 die Stadt im Hintergrund der Kreuzigung gleichzeitig als Jerusalem wie als Bamberg lesbar. Diese Überblendung der beiden Städte wird nicht dadurch in Frage gestellt, dass der Auftraggeber selbst die terra sancta besuchte, wie seine auf dem Gemälde angebrachten Abzeichen dokumentieren. Womöglich führte die Reise ihm weniger die Differenz zwischen Jerusalem und der fränkischen Stadt vor Augen als ihre strukturelle Entsprechung. Eine solche doppelte Kodierung von ← 3 | 4 → Orten bot den Künstlern Möglichkeiten, ein reiches Vokabular für Realitätsebenen und Bedeutungsdimensionen zu entwickeln.
Die Räume der Passionsbilder wandeln sich in dem in diesem Band untersuchten Zeitraum erheblich. Aus Hintergrundsfolien werden distinkte Innen- und Außenräume, Beziehungen der Figuren werden als räumliche erkennbar. Räume können gerichtet sein, so dass die Handlung an den Betrachterinnen und Betrachtern vorbeizieht oder auf sie ausgerichtet ist.6 Die Zentralperspektive erweitert die Möglichkeiten, die Betrachter zu involvieren: Sie können in eine dramatische Nähe zur Marter Christi gerückt werden oder in weite Ferne. Ausschluss und Teilhabe am Heilsgeschehen werden so zu einer Frage des Raumes. Nicht nur die Position des Bildpersonals wird durch die Ordnung des Raumes fixiert, sondern auch der Betrachterstandpunkt: am Fuß des Kreuzes, in der Gruppe der Feinde oder Freunde Christi oder in einem eigenen abgetrennten Betrachterraum. So entstehen erneut hybride Räume, nun im Übergang zwischen Bildraum und Betrachterraum. Der Bildraum kann wie bei Pordenones Fresken in Cremona in den Betrachterraum vorstoßen oder die Betrachter können in den Bildraum gezogen werden wie bei manchen venezianischen oder altdeutschen Passionsbildern. Dies entspricht zwar der bekannten Aufforderung der Passionstraktate des 14. Jahrhunderts, sich imaginär an den Ort der Passion zu versetzen, doch in der Malerei und Graphik entwickelten sich neue spezifisch bildliche Strategien.
Der Raumbezug von Passionsbildern ist eng mit ihrer Medialität und ihrer physischen Existenz verbunden. Lebensgroße Fresken und Skulpturen integrieren den Betrachter ganz anders in ihren Raum als Miniaturen in einer Handschrift, über die man sich beugt. Der Raum einer Kapelle ist physisch zu betreten, der eines Tafelbildes nur imaginär. Der vielleicht wesentlichste Raum, in dem die Passion visualisiert und aktualisiert wird, ist der ‚innere‘ Raum der Betrachterinnen und Betrachter, ihre Imagination, die wiederum durch die äußeren Bilder geprägt ist. Die Autoren der Frömmigkeitsliteratur werden nicht müde, ihre Leser aufzufordern, auf die Passion mit ihren innerlichen ‚Augen des Herzens‘ zu schauen und dem leidenden Christus einen Platz in ihrem Herz einzuräumen.7
Das Heilige Land, der Realraum der Passion, ist neben den Evangelien das wichtigste Zeugnis dafür, dass und wie die Passion stattgefunden hat. Trotz oder wegen dieses Authentizitätsanspruchs wurden die Heiligen Stätten ← 4 | 5 → mehrfach überformt und für die Pilger, die sie aufsuchen, inszeniert. BRUNO REUDENBACH stellt in unserem Band die zentrale Frage, wieso es überhaupt zur Ausbildung der loca sancta kam, wenn der Christengott doch ursprünglich nicht an bestimmten Orten verehrt werden, sondern in den Herzen wohnen soll. Antike Vorstellungen vom locus religiosus erfüllen hier neue Funktionen, einerseits die der Identifizierung, Authentifizierung und Markierung, andererseits der Anbindung an biblische und außerbiblische Erzählungen. Der Ortskult in Jerusalem ließ sich, wie Reudenbach zeigt, durch Orts- und Kreuzreliquien an ferne Orte transferieren.
YAMIT RACHMAN-SCHRIRE untersucht in ihrer Studie, wie der wichtigste Ort der Passion, der Fels Golgatha, von der natürlichen Landschaft getrennt und in die Architektur der Grabeskirche integriert, zum Kultort wurde. Weniger der Stein selbst als seine Einkerbungen und Löcher standen dabei im Zentrum der zunehmend körperbezogenen Riten der Pilger: also nicht das Präsente, sondern das Abwesende, das sich nur als Spur zeigt. Rachman-Schrire macht plausibel, dass hier Bernhard von Clairvaux‘ allegorische Ausdeutung der Stigmata Christi als Felsgeklüft auf den Golgatha-Fels rückübertragen wurde.
BIRGIT ULRIKE MÜNCH thematisiert wie Reudenbach die Rekonstruktion der biblischen Topographie der Passion in Jerusalem, nun aber vor dem Hintergrund der protowissenschaftlichen historisch-archäologischen Bibelforschung ab der Mitte des 16.Jahrhunderts und im Spiegel neuer Medien wie der graphisch reproduzierten Jerusalem-Karten, die oft in Bibeldrucke eingebunden waren und als Ersatz für Wallfahrten in das Heilige Land dienen konnten. Am Beispiel u. a. der Karten des Christian van Adrichem stellt Münch die Frage, ob das neue Interesse an den ‚wahren‘ Orten der Passion auf katholischer bzw. protestantischer Seite differente Schwerpunktsetzungen unterscheiden lässt. Mit dieser Epochenproblematik der Konfessionalisierung schließt der zeitliche Rahmen der in diesem Band versammelten Beiträge.
An einem konkreten und besonders komplexen Beispiel stellt JOHANN SCHULZ vor, wie eine Stadt zu Jerusalem wird. Er zeigt, dass die Evokation der Jerusalemer Passionsorte beim Nürnberger Kreuzweg, der in einer Heiliggrabkapelle endet, die Bürger mit der Verlegung des Friedhofs vor die Stadtmauern versöhnen sollte. Bezeichnenderweise setzte sich in den Darstellungen von Jerusalem, die nach den Berichten von Nürnberger Jerusalempilgern angefertigt wurden, erst um diese Zeit die bibel-historisch korrekte Topographie mit dem außerhalb der Stadt situierten Grab Christi durch. Die bis dato gültige Überblendung des biblischen mit dem zeitgenössischen Jerusalem des 15. Jahrhunderts wird aber nicht einfach korrigiert, sondern durch eine neue Überblendung abgelöst, die des Weges der Nürnberger zum Friedhof mit der via dolorosa Christi zum Kalvarienberg. ← 5 | 6 →
Eine andere Form der Transferierung der loca sancta in das Abendland thematisiert CHRISTIAN FREIGANG am Beispiel der Architektur‘kopie‘ des Görlitzer Kalvarienbergs. Er legt dar, dass die in ihrer topographischen Situation nachmessbar präzise angeordneten Nachbauten nicht unter ein einheitliches Mimesis-Konzept subsumiert werden können. Die affektiv- persuasive Vergegenwärtigung in der Grablegungsskulptur unterscheidet sich von der historisch-reflexiv gebrochenen Evokation des Passionsgeschehens in der Kreuzkapelle. In ihr wird auf die Präsenz des Körpers Christi verzichtet und die Kreuzigung nur in ‚realen‘, durch die Evangelienberichte verbürgten Spuren erinnert. Eine solche vorreformatorische Bilderskepsis prägt auch die geradezu protoarchäologisch exakte Rekonstruktion der Grabädikula, die auf jede narrative Illustration verzichtet.
Eine besonders krasse Überblendung von biblischem und zeitgenössischem Passionsort deckt ACHIM TIMMERMANN an der rituellen Inszenierung öffentlicher Hinrichtungen im 14.-16. Jahrhundert auf. Die Vollstreckung des Todesurteils erscheint als ein grausame Wirklichkeit gewordenes Passionsspiel, der ‚Arme Sünder‘ wird zum Bild Christi, der Galgenberg vor den Mauern der spätmittelalterlichen Stadt verschmilzt mit Golgatha. Timmermanns besonderes Augenmerk gilt den unterschiedlichen Funktionsweisen der im Rahmen dieser Praktiken benützten Passionsbilder. ‚Armensünderkreuze‘ und Bildstöcke machten das Spektakel der Hinrichtung für die Zuschauer moralisierend deutbar. Die tragbaren Kruzifixe oder tavolette, die dem Verurteilten unmittelbar vor die Augen gehalten wurden, sollten ihn auf ein ‚gutes Sterben‘ vorbereiten.
Die exzessiven Gewaltdarstellungen in Passionsspielen sind der Ausgangspunkt von MARGRETH EGIDIS Überlegungen. In ihnen differenziert sie zwei unterschiedliche Darstellungslogiken und Formen der Performativität. Die Inszenierungen der Misshandlungen Christi sind von der Täterperspektive geprägt, wobei sich die Handlung getrennt vom Raum des Betrachters abspielt. Bei der bildhaften Ausstellung des Leidens werden hingegen die Betrachter direkt adressiert. Im Vergleich mit Vesperbildern und ähnlichen Skulpturen spricht Egidi hier von ‚bühnenmäßigen Andachtsbildern‘, die den Spielfluss unterbrechen und die compassio anregen. Im inneren Raum der Imagination gleicht sich der Betrachter an den Leidenden an. Die direkte Adressierung führt zu einer Verschmelzung von Raum der Bühne und Raum der Zuschauer.
Gestützt auf ein Ceremoniale des frühen 16. Jahrhunderts, vollzieht ANJA RATHMANN-LUTZ am Beispiel des Baseler Münsters nach, wie durch die von Palmsonntag bis Ostern dauernden (para-)liturgischen Feiern Räume konstruiert und transformiert wurden, in einer synästhetischen Inszenierung, die mit der Wahl des Schauplatzes, der Bewegung der Akteure, mit Licht und Klang – aber auch deren Absenz – arbeitet. In Kirchenraum und ← 6 | 7 → Münstervorplatz wurden die historischen Orte der biblischen Erzählung aktualisierend imaginiert, gleichzeitig aber auch die aus Pilgerberichten bekannten zeitgenössischen Prozessionen in Jerusalem erinnert. Dieser liturgische ‚Passionsraum‘ überschnitt sich auf vielfältige Weise mit dem städtischen Raum und seinen politisch-historischen Dimensionen.
Wie performative Aktualisierungen der Passion im Stadtraum auch für die bildliche Darstellungen fruchtbar wurden, verdeutlicht HEIKE SCHLIE, die sich mit den die einzelnen Erzählsequenzen simultan darstellenden Passionspanoramen des späten 15. Jahrhunderts beschäftigt. Sie zeigt auf, welch unterschiedliche bildmediale Möglichkeiten hier erprobt wurden. Durch die Anordnung in der Bildfläche wird ein vielszeniger Pariser Passionsholzschnitt entgegen der Erzähllogik in einen allegorischen Tugendberg verwandelt. Im Vorbild des Holzschnitts wiederum, Memlings berühmter Turiner Passion, wird im Parcours der Episoden der fiktive Stadtraum von Jerusalem mit dem durch die Heilig-Blut-Prozession innerhalb der realen Stadt Brügge konstituierten performativen Sakralraum überblendet. Schlies Analyse zeigt, wie der relationale, durch die Verknüpfungen von Orten konstituierte Raumbegriff der neueren Raumsoziologie für die Kunstwissenschaft fruchtbar gemacht werden kann, indem spezifisch ästhetische Dispositive berücksichtigt werden.
JEFFREY HAMBURGER erkundet mit seinem Beitrag den inneren Raum des Herzens als den zentralen Schauplatz der Passionsandacht. Diesen verborgenen Raum beleuchtet er durch ein auf äußerst ungewöhnliche Weise illustriertes Graduale aus dem westfälischen Nonnenkloster Paradies. In seiner Analyse zeigt Hamburger die liturgische Struktur der zahllosen kleinen Illustrationen auf. Dabei hebt er auf die Durchdringung der verschiedenen Räume ab, der dargestellten wie der symbolisierten. Die Nonnen, die das Choralbuch für ihren eigenen Gebrauch herstellten, schrieben sich selbst mit kleinen Selbstdarstellungen in das Buch und damit in die Heilsgeschichte ein: Das Paradies als Zielort der Andacht und das Kloster der Nonnen überlagern sich.
Am Beispiel einer um 1503 entstandenen südostdeutschen Handschrift, die fast ausschließlich deutsche Mariengebete enthält und bisher kaum beachtet wurde, fokussiert ANDREAS KRAß die zentrale Rolle der compassio Mariens in der spätmittelalterlichen Passionsfrömmigkeit. Kraß unterzieht die illustrierten Gebetstexte über die Schmerzen Marias und ihre Klagen angesichts des leidenden Sohnes einem auf die strukturellen Prinzipien von Bild und Text und deren buchinterne Relationen abhebenden ‚close reading‘. Er arbeitet heraus, wie die Gebete mit den kolorierten Federzeichnungen interagieren und einen imaginären, inneren Raum der Andacht eröffnen, in den die betenden Leserinnen und Leser eintreten können.
HANS AURENHAMMER verfolgt in seinem Beitrag, wie in der venezianischen Frührenaissance die neue Subjektivierung des Blicks durch die ← 7 | 8 → Perspektive bzw. die Entdeckung des natürlichen Umraums zu Transformationen des Bildraums der Kreuzigung Christi führten, die von der konventionellen Ikonographie abwichen. Die in Jacopo Bellinis Zeichnungen verfremdend auf das Passionsgeschehen geworfenen ungewöhnlichen ‚schrägen Blicke‘ involvieren den Betrachter, gleichzeitig wird die Kontingenz und Subjektivität seines Blickens auf Christus reflektiert und damit moralisiert. Bei Giovanni Bellini und Antonello da Messina hingegen verwandelt sich durch die Weitung der Hintergrundsszenerie und die Suspension jeglicher dramatischen Erzählung der Raum der Passion in eine ‚innere Landschaft‘ der Meditation.
DANIELA BOHDE thematisiert das Verhältnis von Raumdarstellung, Blickbeziehungen und Betrachterinvolvierung in deutschen Graphiken aus der Zeit um 1500. Sie untersucht anhand von Kalvarienszenen, wie die Bildfiguren auf Christus schauen und wie dieser den Blicken der Betrachterinnen und Betrachter präsentiert wird. Dabei konstatiert sie eine Veränderung im Verhältnis von Bildraum und Betrachterraum: Ist Christus vor 1500 meist frontal präsentiert, so dass die Betrachter ihn sich einprägen können, ist er dagegen in Darstellungen des frühen 16. Jahrhunderts häufig den Blicken partiell entzogen, ja kehrt den Betrachtern den Rücken zu, so dass sie ihn ergänzen müssen. Der Imaginationsprozess bekommt so eine neue Richtung: Es geht nun weniger darum, sich das Bild Christi im Herzen einzuprägen, als das internalisierte Bild nach außen zu projizieren.
Details
- Pages
- VIII, 484
- Publication Year
- 2015
- ISBN (Hardcover)
- 9783034315357
- ISBN (PDF)
- 9783035107241
- ISBN (MOBI)
- 9783035195644
- ISBN (ePUB)
- 9783035195651
- DOI
- 10.3726/978-3-0351-0724-1
- Language
- German
- Publication date
- 2015 (January)
- Keywords
- Passion Christi Leiden des Erlösers Heiliges Land
- Published
- Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt am Main, New York, Oxford, Wien, 2015. VIII, 484 S.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG