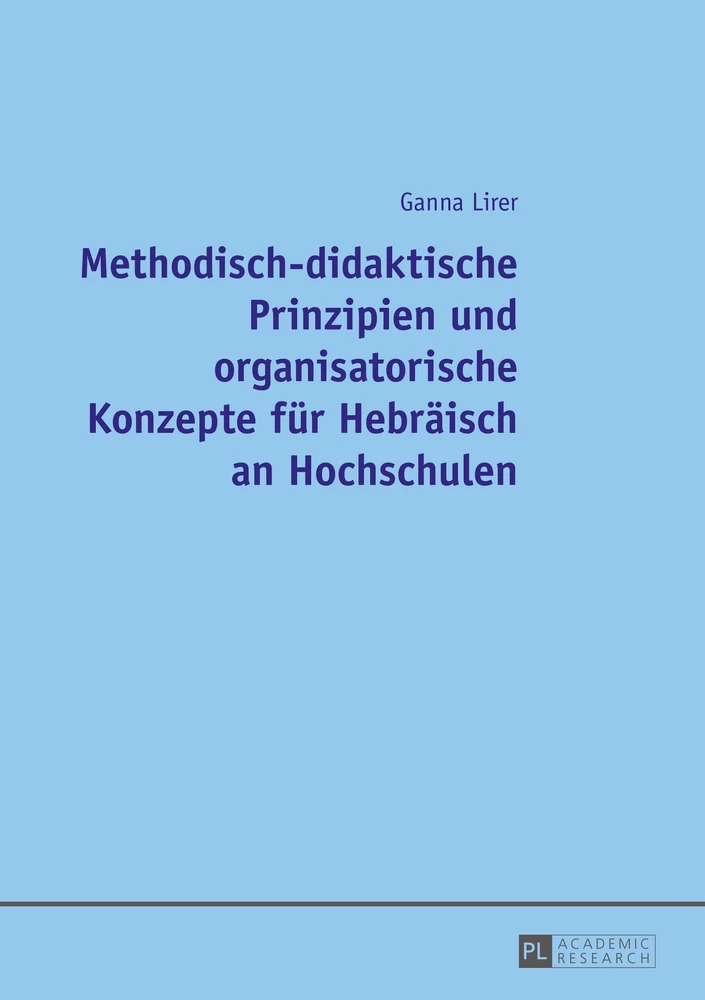Methodisch-didaktische Prinzipien und organisatorische Konzepte für Hebräisch an Hochschulen
Summary
Excerpt
Table Of Contents
- Cover
- Title
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- This eBook can be cited
- Contents
- Einleitung
- 1.Adressaten und Verwendungszwecke
- 1.1 Hebräischunterricht an der Universität
- 1.2 Wozu lernt man Hebräisch an der Universität?
- 1.3 Wie verändern sich Motivation und Einstellungen im Laufe der Zeit?
- 2.Die unterrichtsmethodischen Prinzipien
- 2.1 Die Kompetenzorientierung
- 2.1.1 Was beinhaltet der Begriff „Kompetenz“?
- 2.1.2 Kompetenzorientierung als Standard des gemeinsamen europäischen Referenzrahmens (GeRs)
- 2.1.2.1 Der gemeinsame europäische Referenzrahmen: Verwendungszwecke
- 2.1.2.2 Die Merkmale des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens
- 2.1.2.3 Die Deskriptoren des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens
- 2.1.2.4 Die Skalen des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens (siehe Anhang 3: Schema: Verständnis von Skalen und die Deskriptoren durch Veranschaulichung. S. 128)
- 2.1.2.5 Die Bestimmung des Referenzniveaus mithilfe des GeR und die inhaltliche Kohärenz
- 2.1.2.6 Die Bedeutung des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für die Lernprogramm: Lernebene-Bewertungsmaßstab- Ergebnis
- 2.1.2.7 Das Schwierigkeitsniveaus des GeRs in Bezug auf dem Begriff „inhaltliche Kohärenz“
- 2.1.2.8 Die Einschätzung von hebräischen Texten auf der Grundlage des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens
- 2.2 Die Outputorientierung
- 2.2.1 Outputorientierung als Prinzip
- 2.2.2 Die Aneignung des Sprachkönnens im Modernhebräisch
- 2.3 Handlungsorientierung
- 2.3.1 Handlungsorientierung als ein integriertes Konzept
- 2.4 Die Aufgabenorientierung
- 2.4.1 Unterrichtliche Lernaufgaben: offene Aufgabenstellungen
- 2.4.2 Testaufgaben: geschlossene Aufgabenstellung
- 2.5 Übungen in modernhebräischer Sprachpraxis
- 2.5.1 Grammatikübungen
- 2.5.2 Satzmusterübungen
- 2.6 Die interkulturelle Orientierung
- 2.7 Die Induktivität
- 2.8 Das entdeckende Lernen im Licht des Konstruktivismus
- 2.9 Die Prinzipien von verbalen und nonverbalen Semantisierungen
- 2.9.1 Das Visualisierungsverfahren als Art der Semantisierung
- 2.9.1.1 Das assoziationspsychologische Konzept
- 2.9.1.2 Die visuelle Mitteln
- 2.9.1.3 Die Darbietung und Festigung des Lehrstoffes (siehe Anhang 4: Semantisierung mithilfe des Visualisierungsverfahrens. S. 126)
- 2.9.1.4 Die Anschaulichkeit und Situationsbezug als Basis des Semantisierungsverfahrens
- 2.9.1.5 Die Internationalismen
- 2.9.1.6 Die Begriffsdefinitionen
- 2.9.1.7 Der Einsatz von semantischen Paaren
- 2.10 Die Situativität: Situationsbezug und Kontextualisierung
- 2.11 Die Lernerorientierung
- 2.11.1 Der Faktor Alter beim Fremdsprachenlernen
- 2.11.2 Die Lernerautonomie als Prinzip
- 2.12 Die Lernerorientierung in Bezug auf die Entwicklung von Lesekompetenz
- 2.12.1 Die Worterkennung
- 2.12.2 Die Satzerschließung
- 2.12.3 Die Texterschließung
- 2.12.4 Das strategische Lesen
- 2.12.5 Das Lesen nach dem Prinzip des Konstruktivismus
- 2.12.6 Probleme und Grenze des fremdsprachlichen Leseverstehens
- 2.12.7 Die Rolle der top -down und bottom- up Prozessen bei der Textverarbeitung
- 2.12.7.1 Lesen als Dekodierung/ Bottom- up- Prozesse bei der Textverarbeitung
- 2.12.7.2 Lesen als Hypothesenbildung/ Top-down- Prozesse bei der Textverarbeitung
- 2.12.8 Die Inferenzbildung
- 2.12.8.1 Die Inferenzbildung auf der Grundlage der top-down Prozessen
- 2.12.8.2 Die Inferenzbildung im Licht der schematheoretischen Konzepte
- 2.12.8.3 Der Aufbau von mentalem Modell als das Ergebnis der Kohärenz- und Inferenzbildung
- 2.12.8.4 Drei Etappen des Leseverstehens: Hypothesen-, Kohärenz- und Inferenzbildung
- 2.13 Die Auswahl und Einsatz von unterrichtsmethodischen Prinzipien im Hebräischunterricht
- 2.13.1 Die Erarbeitung von unterrichtsmethodischem Konzept
- 2.13.2 Die Integration von Prinzipien in den Hebräischunterricht
- 2.13.2.1 Das Bewusstheitsprinzip im Kognitivierungsverfahren: Die bewusste Einsicht in die Sprachstruktur
- 2.13.2.2 Das Situativitätsprinzip und die thematische Gliederung des Lehrbuches
- 2.13.2.3 Das Kontextualisierungsprinzip
- 2.13.2.4 Die Aneignung und Erweiterung des Vokabulars
- 2.13.2.5 Der Sprechfertigkeitserwerb
- 2.13.2.6 Lesenorientierung und Leserorientierung: Lesen heißt Verstehen
- 2.14 Die Unterrichtsstruktur, Unterrichtsphasen und Unterrichtsplanung
- 2.14.1 Die Unterrichtsstruktur
- 2.14.1.1 Das Input
- 2.14.1.1.1 Das Inputorientierungsprinzip und Lehrbücherauswahl
- 2.14.1.2 Die Intake
- 2.14.1.2.1 Die Intake beim Lesen
- 2.14.1.3 Der Output
- 2.14.1.3.1 Das Outputorientierungsprinzip und Lehrbücherauswahl
- 2.14.2 Die Unterrichtsphasen
- 2.14.3 Die Unterrichtsplanung
- 2.15 Die Integration von Prinzipien: Probleme und Defizite
- Fazit
- Literaturverzeichnis:
- Literaturquelle:
- Anhangverzeichnis:
← 14 | 15 → Einleitung
Um eine Sprache zugänglich, systematisch und strukturiert zu unterrichten, stützt sich ein Lehrer auf Prinzipien, die auf der Grundlage der Unterrichtsmethodik entwickelt wurden.
„Im Hinblick auf die Ziele des Fremdsprachenunterrichts hat es in den letzten Jahren in vielen Ländern grundlegende Veränderungen und Neuorientierungen gegeben. Dabei ist ein wichtiger Einflussfaktor die didaktisch-methodische Fachdiskussion, die sich zunehmend von globalen und starren vermittlungsmethodischen Konzepten entfernt und sich eher an so genannten didaktisch-methodischen Prinzipien orientiert“. (K. Ende/ R. Grotjahn/ K. Kleppin/ I. Mohr, 2013:8) [1].
Auf diese Weise bestimmen die unterrichtsmethodischen Prinzipien ein ergebnisgerichtetes, zweckgebundenes und planvolles Vorgehen bei der Wissensvermittlung. Als Ergebnis der Fremdsprachenvermittlung werden das in ausreichendem Maße erlangte Sprachkönnen und das Sprachwissen der Lernenden angesehen.Als planvolles Vorgehen wird der Zuwachs des Wissens in der durch die Planung bestimmten Reihenfolge bezeichnet.
Die unterrichtsmethodischen Prinzipien bestimmen die Lehr- und Lernverfahren und dienen als Leitfaden für das unterrichtspraktische Handeln des Lehrers mit dem Ziel, die Inhalte konzeptuell strukturiert und zugänglich zu vermitteln. Die lern-, inhalts- und handlungsorientierten Prinzipien fördern den Lernprozess. Das Wissen muss vom Lehrer zugänglich vorgestellt und erläutert sowie von den Lernenden behalten werden. In der vorliegenden Arbeit werden die folgenden sieben unterrichtsmethodischen Prinzipien des Fremdsprachenunterrichts am Beispiel des Modernhebräischunterrichts (Iwrit) betrachtet:
Lernerorientierung, Kompetenzorientierung, Handlungsorientierung, Aufgabenorientierung, Inhaltsorientierung, Interaktionsorientierung, Interkulturelle Orientierung. Zu jedem Prinzip erfolgt eine Beschreibung bzw. Benennung von Einsatzmöglichkeiten im Hebräischunterricht. Jedes Prinzip kann von Lehrenden anders umgesetzt werden. „Der handelnde Lehrer wird hier sozusagen zum Forscher in eigener Sache – in einem Forschungsprozess, der unter aktiver Mitwirkung aller Beteiligten zugleich Wissen vertiefen und Praxis verändern will“. (siehe auch Altrichter, Posch, 1994 in: A. Vielau, 1997:10-11) [2]. Häufig nutzt der Lehrer in einem Kurs mehrere Unterrichtsprinzipien nebeneinander, indem er aus mehreren Prinzipien eine eigene Methodik erarbeitet.
← 15 | 16 → „Methodik… ist eine primär praxisorientierte Handlungswissenschaft, die nicht nur von Empirie und exaktem Wissen, sondern auch vom Experiment, von praktischer Erfahrung und subjektiver Phantasie, Feldbeobachtung und verstehender Interpretation lebt – zumindest dort, wo schlüssigere Erkenntnisquellen (noch) fehlen“. (A. Vielau, 1997:10) [3].
Methodisch-didaktische Prinzipien bilden die wissenschaftliche Basis für die Unterrichtsplanung. Das heißt: Das konkrete Lernziel des Unterrichts findet eine Übereinstimmung mit einem bestimmten Prinzip. So liegt beispielsweise dem Lernziel „Fehleranalyse bzw. Fehlerkorrektur“ das Prinzip der Bewusstheit zugrunde. Auf diese Weise üben die Prinzipien auf die Orientierungen bei der Unterrichtorganisation in dem Lernprozess aus Einfluss.
← 16 | 17 → 1. Adressaten und Verwendungszwecke
1.1 Hebräischunterricht an der Universität
An der Universität lernen Menschen unterschiedlichen Alters, unterschiedlicher Nationalitäten und Muttersprache Hebräisch. Für das Modernhebräisch steht als finales Ziel der aktive Sprachgebrauch im Fokus. Aus diesem Grund wird der Kurs auf die für den aktiven Sprachgebrauch erforderlichen Fertigkeiten ausgerichtet.
In der ersten Phase wird Hebräisch als Fremdsprache von Studierenden außerhalb des Ziellandes gelernt. Der Lernprozess ist anhand eines Lehrplans gesteuert.
„Der Lehrplan regelt Art und Umfang des Input,…er regelt die Abfolge der Lernaktivitäten, die den Intake des Lernstoffs bewirken sollen; und er legt spezifische Erfolgskriterien fest, an denen der Output der Lernenden gemessen und der Bezug zu den Lehrzielen hergestellt wird“. (A. Vielau, 1997:75-76) [4].
Es geht nicht um einen ungesteuerten Erwerb einer Sprache (wie im Kindesalter), sondern um bewusstes, zielgerichtetes Lernen mithilfe eines Lehrers und Lehrbüchern.
„Ein Lehrbuch vermittelt den grammatischen Stoff in schrittweisem Aufbau…. Der klaren Isolierung und dem konsequenten Aufbau der grammatischen Erscheinungen gilt das Bemühen eines Lehrbuchs bis zur umfassenden Kenntnis des Systems“. (D. Vetter/ J. Walther, 1973:12) [5].
Die geeignetsten Lehrbücher werden von israelischen Universitäten für Studierende, die Hebräisch als Fremdsprache lernen, herausgeben.
Die Adressaten dieses Kurses sind vor allem die Studenten des Faches „Jüdische Studien“. Grundsätzlich kann er aber für Studenten aller geisteswissenschaftlichen Fachrichtungen interessant sein. Die Mehrzahl der Studierenden hat keine Vorkenntnisse in den semitischen Sprachen. Deswegen orientiert sich der Kurs „Modernes Hebräisch“ an den Anfängern, die Interesse an der Sprache, Kultur und Literatur des Landes Israel haben.
Der Sprachkurs „Modernes Hebräisch“ dauert zwei Semester (je 2 SWS). Das Ziel dieses Kurses ist es, zur mündlichen und schriftlichen Kommunikation in Hebräisch zu befähigen. Deswegen erwerben die Studierende Kenntnisse im mündlichen und schriftlichen Bereich. Dafür muss man sich ein Grundvokabular (die ca. 2000 geläufigsten Wörter) aneignen. Dieser Wortschatz ermöglicht es den Lernenden, in Alltagssituationen innerhalb des Landes der Zielsprache ← 17 | 18 → zurechtzukommen. In der ersten Phase im Rahmen des dreijährigen Bachelor-Studiums erlernen Studierende in dem ersten Lehrjahr die hebräische Sprache bis Niveau A2 (א) (alef), in dem zweiten – bis Niveau B1 (ב) (bet) und in dem dritten – bis Niveau B2 (ג) (gimel).
In der zweiten Phase im Rahmen des zweijährigen Masterstudiums erlernen Studierende während des Auslandsemesters die Sprache innerhalb des Ziellandes. In zahlreichen Programmen von Universitäten (z.B. von den Universitäten in Jerusalem, Tel-Aviv und Beer-Scheva) können die Studierenden ihre Sprachkenntnisse vertiefen und weiterentwickeln. Auf diese Weise wird Hebräisch in der Konversation mit Muttersprachlern im Zielland verwendet bzw. verbessert.
1.2 Wozu lernt man Hebräisch an der Universität?
(siehe Anhang 2: Leitfaden für Gruppengespräch mit Studierenden der Universität Düsseldorf, die Hebräisch als Fremdsprache lernen. S. 123)
Was motiviert Studierende dazu, Hebräisch zu lernen, obwohl die hebräische Sprache eine nicht so populäre und in Deutschland eine wenig verbreitete Fremdsprache ist? Diese Frage ist bedeutsam für Lehrer, die die hebräische Sprache in der Hochschule unterrichten.
Details
- Pages
- 202
- Publication Year
- 2015
- ISBN (Softcover)
- 9783631658796
- ISBN (PDF)
- 9783653051971
- ISBN (MOBI)
- 9783653970135
- ISBN (ePUB)
- 9783653970142
- DOI
- 10.3726/978-3-653-05197-1
- Language
- German
- Publication date
- 2015 (January)
- Keywords
- Fremdsprachenunterricht Sprachdidaktik Unterrichtsplanung Unterrichtsprinzipien Unterrichtsdidaktik
- Published
- Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2015. 202 S., 4 Tab., 5 Graf.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG