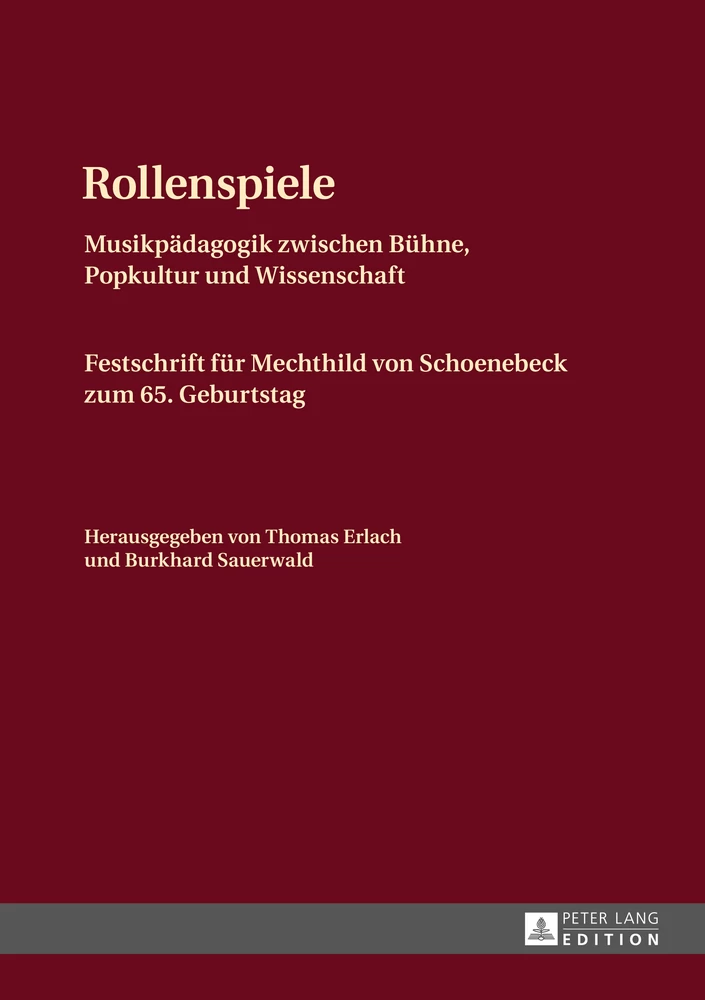Rollenspiele
Musikpädagogik zwischen Bühne, Popkultur und Wissenschaft- Festschrift für Mechthild von Schoenebeck zum 65. Geburtstag
Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titel
- Copyright
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Musik und Bühne
- Mehr als nur ein „Schlaues Füchslein“. Anmerkungen zu Leoš Janáčeks Oper mit dem irreführenden deutschen Titel: Werner Abegg
- Quellen
- Musikalien
- Bildtonträger
- Literatur
- Multimediales Wunderland. Lewis Carrolls Alice und das Musiktheater: Dietrich Helms
- 1. Multimediales Wunderland
- 2. Wunderland Musiktheater
- Quellen
- Musikalien
- Literatur
- „Aber die Ehe ist ein heiliger Stand.“ Das (musik)didaktische Potenzial des Rosenkavalier-Films von 1926: Thomas Erlach
- 1. Idee und Zielsetzung des Beitrags
- 2. Rosenkavalier und Musikdidaktik – Anbahnung einer Begegnung
- 3. Zur Entstehung des Rosenkavalier-Films – eine historische Rekonstruktion
- 4. Sachanalyse: Einstellungsprotokoll einer Szenenfolge
- Auswertung des Einstellungsprotokolls im Hinblick auf as Verhältnis von Bildhandlung und Musik
- 5. Didaktische Analyse und Anregungen für den Musikunterricht
- 5.1 Fachübergreifender Zugang: Brautwerberituale früher und heute – Vorbereitende Übungen
- 5.1.1 Zusammentragen von Sitten und Gebräuchen verschiedener Zeiten und Kulturen rund um die Brautwerbung
- 5.1.2 Empathische Darstellungsformen aus subjektiver Sicht
- 5.1.3 Szenisches Spiel
- 5.2 Begegnung der Schülerinnen und Schüler mit dem Rosenkavalier-Film
- 5.3 Gegenüberstellung von Film- und Bühnenfassung des Rosenkavalier
- 5.4 Mögliches Ergebnis eines Vergleichs
- Quellen
- Primärquellen Musikalien
- Bildtonträger
- Originaldokumente der Autoren
- Sekundärquellen Literatur
- Einige Bemerkungen zu Mozarts Oper Le nozze di Figaro: Eva-Maria Houben
- Ouvertüre 1: „Keine Zeit!“ – ein möglicher Zugang
- Ouvertüre 2: Was ist neu möglich? – eine grundlegende Fragestellung
- Tanz 1: „Simplizität“ als Konstruktionsprinzip
- Tanz 2: Choreographie des Lebens
- Tanz 3: Verdichtung durch Aussparung
- Tanz 4: Hören als eine Art Denken – und umgekehrt
- Finale: Zur Notwendigkeit historischer „Positionsbestimmung“
- Quellen
- Literatur
- Koanga von Frederick Delius – eine afroamerikanische Oper: Hans-Joachim Erwe
- Wovon handelt Koanga? Eine knappe Inhaltsangabe
- Wie gelangte Koanga nach Elberfeld?
- Wie wurde Koanga in Elberfeld aufgenommen (I)?
- Wie kam Delius auf die Plantage? Oder: Woher kannte Delius afroamerikanische Musik?
- Welche Einflüsse afroamerikanischer Musik finden sich in Koanga?
- Wie wurde Koanga in Elberfeld aufgenommen (II)?
- Muss die Geschichte der afroamerikanischen Oper umgeschrieben werden? Oder: Exzellenz statt Präzedenz
- Quellen
- Musikalien
- Tonträger
- Literatur
- Singende Kinder auf der Theaterbühne. Zur Entwicklung des Kindermusiktheaters von Cesar Bresgen bis heute: Gunter Reiß
- Quellen
- Musikalien
- Literatur
- Hans Werner Henzes Sechs Stücke für junge Pianisten aus der Kinderoper „Pollicino“. Intensivkurs Musiktheater und Einführung in die moderne Musik: Klaus Oehl
- I. Die Kinderoper
- II. Ablegerwerke aus der Kinderoper für Klavier
- Pollicinos Arien und die ersten beiden Klavierstücke
- Der Menschenfresser: Die Klavierstücke III–V
- III. Lieto fine: Eine Geburtstagsgabe zum 65. und die Feier der Freundschaft
- Quellen
- Musikalien
- Literatur
- Musikpädagogik als Wissenschaft
- Von Carl Dahlhaus zu Umberto Eco. Kontingenz in der Musikanalyse: Martin Geck
- Quellen
- Literatur
- Die Bedeutung des Spiels in der Musikpädagogik: Christoph Richter
- I
- II
- III
- Fazit
- Quellen
- Literatur
- „Quest-ce que la musique?“ Das erste Musiklehrbuch des Pariser Conservatoire: Michael Stegemann
- I
- II
- III
- Quellen
- Literatur
- ‚Chormeister‘ oder ‚Chorführer‘? Der Wandel des Chorleiterideals im bürgerlichen Männergesang der Weimarer Republik: Helmke Jan Keden
- Quellen
- Literatur
- Musikunterricht und Inklusion: Irmgard Merkt
- Inklusion
- Strukturen: Schulsystem und Lehrerbildung
- Lehrerausbildung und Musik
- Lehrerausbildung, Musik und Sonderpädagogik
- Musikunterricht an der Förderschule
- Musikunterricht und Inklusion
- Barrieren im Kopf
- Musikdidaktik und Inklusion
- Quellen
- Gesetzestext
- Literatur
- Internetquellen
- Rampenfieber und Lampenfieber. Zur Psychologie der Angst auf der Bühne: Günther Rötter
- Zur Geschichte des Begriffs ‚Lampenfieber‘
- Psychologische Theorien
- Der Zusammenhang zwischen Lampenfieber und Leistung
- Quellen
- Literatur
- Gedanken zu einer Didaktik des voraussetzungslosen Musikunterrichts in der Sekundarstufe: Reinhard Fehling
- Vorbemerkung
- 1. Auftrag und Bedürfnis
- 2. Pädagogik und Ästhetik
- 3. Bildung und Wissen
- 4. Gesellschaftlichkeit und Individualität
- 5. Wissenschaftlichkeit und Subjektivität
- 6. Veranstaltung und Ereignis
- 7. Rezeption und Produktion
- 8. Konzeption und Fragment
- Ein verspätetes Vorwort: Antworten und Fragen
- Quellen
- Literatur
- Auditive Aufmerksamkeit und Analyse. Zur experimentellen Erkundung der Hörwelt auf den Spuren von Carl Stumpf und Edmund Husserl: Andreas Georg Stascheit
- Passivität in der Aktivität – Husserl über „die schlichte Erfassung und Betrachtung“
- Der Ton als Gegenstand von Ausweisung, Rechtfertigung und Begründung
- Quellen
- Literatur
- Das Ohr ist rund, damit das Hören die Richtung wechseln kann. Ideen zu einer übergreifenden Interpretationsforschung: Alexander Gurdon
- Einleitung – Werk und Interpretation
- Notierbarkeit des Unnotierbaren
- Interpretation als Wissenschaft
- Interpretation als Werk
- Drei Diskurse zur Interpretationsanalyse
- Der Authentizitäts-Diskurs
- Der Traditions-Diskurs
- Der Autonomie-Diskurs
- Zusammenführung – eine Kugelgestalt der Interpretation?
- Quellen
- Literatur
- Das Internet als Musikmedium Jugendlicher im Kontext sozialisatorischer Fragestellungen: Winfried Pape
- JIM-Studie 2012 (Jugend, Information, [Multi-] Media)
- Klangraum Internet 2012
- Bemerkungen zur Musikalischen Sozialisation
- Internet und Musikalische Sozialisation
- Quellen
- Literatur
- Alles nur Theater? Perspektiven einer ‚Musikpädagogik des Performativen‘: Martina Krause-Benz
- 1) Performativität – das Performative
- 2) Schulischer Musikunterricht als ‚Theater‘?
- Theatralik und Ereignishaftigkeit in performativen Praxen
- Schulischer Musikunterricht als ‚Theateraufführung‘?
- a) leibliche Ko-Präsenz im Musikunterricht
- b) der musikunterrichtliche Rahmen
- c) Ereignishaftigkeit des Musikunterrichts
- 3. Konsequenzen für den schulischen Musikunterricht
- Quellen
- Literatur
- Internetquelle
- Die Diskussion über den Hörkanon an deutschen Schulen. Verbindliche Unterrichtsinhalte oder überflüssige Bevormundung?: Ines Lücking
- 1. Die aktuelle Debatte
- 2. Ein Hörkanon muss her – Pro und Contra
- 3. Das Grundsatzpapier der Konrad-Adenauer-Stiftung
- 4. Die Antwort der Gegenseite: Das Grundsatzpapier in der Diskussion
- 5. Gegenargumentation oder Kompromiss?
- 6. Ein Hörkanon muss her – Fazit
- Quellen
- Literatur
- Musik und Popularität
- Karl Hoffmanns Dokumentation Des Teutschen Volkes feuriger Dank- und Ehrentempel (1815) als Quelle zur Historiographie des chorischen Singens: Friedhelm Brusniak
- I
- II
- III
- Quellen
- Liedersammlungen und Notendrucke
- Literatur
- Musikalische Abbildung eines pluralistischen Amerikas? Zur sozialen Funktion der Jazzgeschichtslehre: Mario Dunkel
- 1) Einleitung: Zur Praxis des Jazzgeschichtslehre
- 2) Die Vorgeschichte der Jazzgeschichtslehre
- 3) Erste Seminare zur Jazzgeschichte in der Nachkriegszeit
- 4) Fazit
- Quellen
- Literatur
- „Leicht und frei, wie ein Gott!“ Popularität und Presse in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts: Dominik Mercks
- Rahmen 1: Medienwelt im Wandel
- Rahmen 2: Musikwelt im Wandel
- Zweiteilung der Musikpublizistik
- Popularisierung von Gattungen
- Popularisierung von Personen
- Weitere Entwicklung
- Quellen
- Literatur
- Deutsche Frauen, deutsche Treue – Frauenbilder auf Feldpostkarten des Ersten Weltkriegs: Sabine Giesbrecht
- Frau und Nation
- Uniform und Geschlecht
- Soldatinnen?
- „Fräulein Feldgrau“ auf dem Theater
- Quellen
- Bildquellen
- Literatur
- Schlagertexte in Zahlen: Clemens Völlmecke
- Datengrundlage
- Auswertung der Daten
- Personeninventar
- Beruf, Tätigkeit
- Zeitliche Einordnung und geographischer Schauplatz
- Fazit
- Quellen
- Datenbasis
- Literatur
- Zur Rolle des Weiblichen in der Performance-Art des 20. Jahrhunderts – dargestellt an Werken von Yves Klein und Laurie Anderson: Erika Funk-Hennigs
- Was bedeutet „Performance-Art“?
- Was bedeutet ‚Performance-Art‘ im Kontext weiblicher Identitätsfindung?
- Yves Klein
- Laurie Anderson
- Fazit
- Quellen
- Literatur
- Das Wechselspiel von populärern und artifiziellen Aspekten in der Filmmusik zu Master and Commander: Burkhard Sauerwald
- I. Handlung und filmische Darstellung
- II. Die Rolle der Musik
- III. Fazit
- Quellen
- Bildtonträger
- Literatur
- Internetquelle
- Freunde bis ans Ende der Zeit. Schlagertümlichkeit reloaded: Thomas Phleps
- Quellen
- Literatur
- Internetquellen
- Schlager und Pop. Grenzziehungen, -überschreitungen und der Fall Heino: Peter Klose
- Einleitung
- Pop, Theorie und die Grenze zum Schlager
- Abgrenzung des Schlagers von innen heraus
- Heino gegen den Mainstream
- Die Rezeption des „verbotenen Albums“
- Fazit
- Quellen
- Diskographie
- Literatur
- Internetquellen
- Publikationsverzeichnis Mechthild von Schoenebeck
- I. Buchpublikationen
- II. Aufsätze
- III. Belletristik, musikbezogen
- IV. Musiktheaterstücke
- V. CDs mit eigenenen Werken
- VI. Ständige Herausgebertätigkeit
- VII. Satirisches und Humoristisches
- Zu den Personen
- Tabula Gratulatoria
Die Bücher, die wir besitzen, werden durch ein geheimnisvolles geistiges Band zusammen gehalten. Betritt man die Bibliothek eines anderen Menschen, so werden schnell thematische Schwerpunkte erkennbar, aber nur bei näherer Kenntnis einer Person erschließen sich die feinen Verbindungen zwischen den einzelnen Bereichen. Die Beiträge dieser Festschrift entfalten nicht nur die verschiedenen Interessen- und Arbeitsschwerpunkte der Jubilarin, sondern stellen auch den Versuch dar, die von Widersprüchen durchsetzte Lage einer forschenden und lehrenden Musikpädagogin zum Vorschein zu bringen.
*
Rollenspiele : Das gehört zunächst und vor allem in die Sphäre des Theaters. In Gero von Wilperts Sachwörterbuch der Literatur ist „Rolle“ definiert als „1. Buchrolle, siehe Papyrus, und 2. Einzelpart des Schauspielers innerhalb eines Dramas.“ Die Bühnensituation des Theaters hat den Vorzug, dass sie nicht nur durch Papier und Worte, sondern auch durch szenische Darstellung und Musik Sinne, Gemüt und Verstand ansprechen kann. Die mit dem Theater seit der Antike verbundene Maske ist zum einen Ausdruck des Sich-Verbergens, zum anderen ein Element des Offenlegens und Zeigens – beides gehört zum Theater wie zu jeder gut betriebenen Kunst. Ferner handelt es sich beim Theater um ein Spiel, d. h. der Ernst des Lebens ist vorübergehend unterbrochen, um (klassisch aufgefasst) in die Sphäre des Wahren, Guten und Schönen einzutauchen und dadurch zu Erkenntnissen und einem neuen Blick auf die Realität zu gelangen. Das Interesse der Jubilarin am Musiktheater wird schon durch einen Blick in ihr Schriftenverzeichnis offenkundig, mehr noch allerdings im persönlichen Umgang. Hier liegt für Mechthild von Schoenebeck eine Quelle der Freude.
Rollenspiele sind zweitens im Bereich der Pädagogik anzutreffen. Fast jedes schulpädagogische und didaktische Seminar thematisiert irgendwann die Frage der Rolle des Lehrenden und ihrer angemessenen persönlichen Ausgestaltung. Eine alte deutsche Tradition betont dabei vor allem die unbedingte Verpflichtung zur „Authentizität“ beim Lehren und damit eine größtmögliche Ferne von jeglicher Verkaufstätigkeit, während die damit konkurrierende amerikanische Maxime „Teaching is performing“ eher den auf Publikumswirksamkeit bezogenen Aspekt akzentuiert. Für die pädagogische Grundhaltung Mechthild von Schoenebecks, insbesondere im Hinblick auf Fragen der Lehrerbildung, steht exemplarisch das Zitat von Wagenschein am Beginn dieses Buches. Unabhängig von charakteristischen Eigenarten einer Lehrperson ist es vor allem die Fähigkeit, sich vertiefend – und ohne sofort an Außenwirkung oder „Vermittlung“ zu denken – mit einem Gegenstand zu beschäftigen, die zur Weitung des Horizonts ← 11 | 12 → beiträgt und zu einer menschenwürdigen Wissenschaft und Pädagogik hinführt. Anders ausgedrückt: Auf der Bühne der Pädagogik darf es auch leise und nachdenklich zugehen, aber dennoch müssen der Adressat und seine eigentlichen Anliegen stets im Blick sein.
Rollenspiele findet man nicht zuletzt auch im Bereich von Wissenschaft und Hochschule. Die Musikpädagogik als relativ junges akademisches Fach befindet sich in einer Zwischenwelt zwischen Musikpraxis, Musikwissenschaft und den Bildungs- und Sozialwissenschaften. Wer dieses Fach an einer Universität vertritt, muss Künstler und Forscher, Gelehrter und Stratege sein und alle zugehörigen Aktionsformen bedarfsgerecht beherrschen. Hinzu kommen bei sehr guten Hochschullehrern als Plus- und Minuspol eines Magneten die Rollen des Aufklärers und Kritikers einerseits, des Helfers und Arztes andererseits – Maledix und Scribifax. Die Grenzen verschwimmen mitunter, zumal wenn sie durch manche Maskeraden des universitären Alltagsbetriebs überlagert werden. Hier hilft bisweilen die alte Tradition des Hofnarrentums weiter, um auch gegenüber den Königen dieser Welt die Wahrheit zur Geltung zu bringen. Die Herausgeber der Festschrift durften als Mitarbeiter der Jubilarin erleben, wie anregend es ist, nach Humboldtschen Prinzipien, d. h. ohne die Dauerkontrollen eines modernen Wirtschaftsunternehmens mit sozialistischen Prinzipien (vulgo Universität) arbeiten zu dürfen.
*
Die Festschrift gliedert sich in die drei Themenbereiche Musik und Bühne, Musikpädagogik als Wissenschaft und Musik und Popularität. Als Autoren der ausschließlich wissenschaftlich ausgerichteten Beiträge konnten 17 aktuelle und ehemalige Kolleginnen und Kollegen des Dortmunder Instituts sowie elf externe Autorinnen und Autoren gewonnen werden, die nach umfangreichen geheimen Recherchen in verschiedenen Adressverzeichnissen der Jubilarin ermittelt wurden.1
Von der Theaternähe Mechthild von Schoenebecks war schon die Rede. Die Aufsätze des ersten Teils behandeln verschiedene Werke des Musiktheaters bzw. seiner künstlerischen Ableger. Es beginnt poetisch: Werner Abegg gibt einen Einblick in das märchenhafte, aber im Grunde falsch titulierte Schlaue Füchslein von Leoš Janáček, und Dietrich Helms, langjähriger Mitarbeiter der Jubilarin und inzwischen Professor in Osnabrück, führt den Leser in das multimediale Wunderland von Lewis Carrolls Alice ein. Danach folgt ein fachdidaktisch ausgerichteter Beitrag von Thomas Erlach zur unterrichtlichen Behandlung des Rosenkavalier-Films, einer frühen Form der Opernadaption. Eva-Maria ← 12 | 13 → Houben stellt, ausgehend von Thomas Mann, nachdenkliche Überlegungen zur Zeitgestaltung in Wolfgang Amadeus Mozarts Le Nozze di Figaro an. Hans-Joachim Erwe, Professor an der Bergischen Universität Wuppertal und damit an Mechthild von Schoenebecks alter Wirkungsstätte, ruft mit Koanga eine vergessene Oper von Frederik Delius in Erinnerung, die vor etwa 100 Jahren im heutigen Wuppertal uraufgeführt wurde. Zum Schluss folgen zwei Beiträge, die speziell das Musiktheater für Kinder zum Gegenstand haben: Gunter Reiß gibt einen Überblick über die Geschichte dieser oft unterschätzten Gattung, und Klaus Oehl analysiert einige Klavierstücke aus Hans Werner Henzes Kinderoper Pollicino, einer Perle der Gattung. Musikpädagogische Aspekte des Musiktheaters beschließen den ersten und leiten zum zweiten Teil des Buches über.
Die beiden anderen Themenkomplexe dieser Festschrift sind für Mechthild von Schoenebeck ebenfalls prägend, was ein Blick auf ihre Qualifikationsschriften deutlich macht. Durch ihre Dissertation zur Musikerziehung der DDR (Politisch-ideologische Erziehung durch Musik. Zur Rezeption von Musikwerken in der schulischen und außerschulischen Musikerziehung in der DDR, 1977) hat sie der historisch ausgerichteten Forschung in der Musikpädagogik spürbaren Aufwind verschafft. Im zweiten Teil dieses Buches sind zwölf Aufsätze zu verschiedenen für die Musikpädagogik als Wissenschaft bedeutsamen Themen vereint, wobei eine Grenzziehung zur Musikwissenschaft mitunter schwer fällt. Am Beginn stehen zwei richtungsweisende Vertreter der Zunft: Martin Geck geht in einem Grundsatzbeitrag zur Kontingenz der Musikanalyse auf die Rolle der Analyse im Musikstudium ein. Christoph Richter widmet sich dem Begriff des Spiels und seiner Bedeutung für die Musikpädagogik. Es folgen zwei Beiträge zur Geschichte der Musikpädagogik: Michael Stegemann stellt das erste Musiklehrbuch des Pariser Conservatoire von 1799 vor, und Helmke Jan Keden erläutert den Wandel des Chorleiterideals im Männerchorwesen der 1920er Jahre. Den Blickwinkel der Historiker ergänzen zwei weitere Perspektiven: Irmgard Merkt erörtert aus Sicht der Rehabilitationswissenschaften die Herausforderungen der Musikpädagogik durch die Forderung nach Inklusion, und Günther Rötter präsentiert als systematischer Musikwissenschaftler die musikpädagogischen Erträge der Lampenfieber-Forschung. In einem weit gespannten Bogen aktualisiert Reinhard Fehling seine in früheren Jahren aufgeschriebenen grundlegenden Gedanken zu einem „voraussetzungslosen Musikunterricht“. Andreas Stascheit geht der Frage nach der Fokussierung der Aufmerksamkeit beim Einstimmvorgang nach und erläutert dies unter Bezugnahme auf Theorieansätze der Phänomenologie. Alexander Gurdon beschreibt die Möglichkeiten musikbezogener Interpretationsforschung, eines wichtigen Bereiches der Musikwissenschaft in Dortmund. Winfried Pape geht der Frage nach dem Einfluss des Internets auf die musikalische Sozialisation Jugendlicher nach. Martina Krause-Benz erläutert die begrifflichen Untiefen der musikpädagogischen Performanzforschung und stellt damit einen weiteren, auch terminologi ← 13 | 14 → schen Querbezug zum ersten Teil der Festschrift her. Den Abschluss des zweiten Teils bildet der Beitrag von Ines Lücking, die im Jahr 2013 ihren Master-Abschluss am Institut für Musik und Musikwissenschaft erworben hat. Sie geht der für das Dortmunder Institut nicht ganz unbekannten Problematik eines Hörkanons nach, der nach Auffassung der Konrad-Adenauer-Stiftung auch in den schulischen Musikunterricht implementiert werden sollte.
Der dritte Teil der Festschrift umfasst Beiträge zum Bereich Musik und Popularität. Dieses Gebiet wurde von Mechthild von Schoenebeck in ihrer 1987 erschienenen Habilitationsschrift mit dem Titel Was macht Musik populär? ausführlich bearbeitet und ist seither ein wichtiger Arbeitsschwerpunkt. Die Autorinnen und Autoren nähern sich mit unterschiedlichen Perspektiven der musikalischen Popularität an, so dass im letzten Teil der Festschrift verschiedene Aspekte dieses Phänomens zur Geltung kommen. Er wird eröffnet durch eine Studie Friedhelm Brusniaks, die eine wichtige Quelle zu einer heute in Deutschland völlig verschwundenen Form populärer Musik auswertet, nämlich zu Gesängen im Kontext der patriotischen Erinnerungskultur der ‚Völkerschlacht‘ bei Leipzig 1813. Beiträge der beiden jüngsten Mitarbeiter unseres Instituts schließen sich an: Mario Dunkel entfaltet seine Forschungen zur Jazzgeschichtsschreibung in den USA, Dominik Mercks (als Vertreter des Musikjournalismus) gibt einen historischen Abriss zum Thema Popularität und Presse in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Die beiden Beiträge von Sabine Giesbrecht und Erika Funk-Hennigs thematisieren Gender-Aspekte populärer Kunst und greifen dabei auf außermusikalische Gegenstände über: Zum einen sind dies Frauenbilder auf Feldpostkarten des Ersten Weltkriegs, zum anderen ist das die Rolle des Weiblichen in der Performance-Art des 20. Jahrhunderts. Die beiden Aufsätze umrahmen einen statistisch unterfütterten Beitrag von Clemens Völlmecke zu deutschen Schlagern und ihren Texten, der auf einer Materialsammlung der Jubilarin beruht, die diese im Rahmen eines DFG-Projekts angelegt hatte. Burkhard Sauerwald verfolgt, wie für die Musik zum Hollywood-Film Master and Commander das Spannungsfeld zwischen populärer und artifizieller Musik nutzbar gemacht wird. Die beiden letzten Beiträge sind noch einmal dem Phänomen des Schlagers gewidmet. Thomas Phleps geht musikanalytisch und kontextualisierend dem Phänomen der „Schlagertümlichkeit“ am Beispiel der „Amigos“ nach; Peter Klose schließlich behandelt die Problematik einer trennscharfen Abgrenzung von Schlager und Pop am Beispiel des aktuellen Heino-Albums (Mit freundlichen Grüßen).
*
Ein besonderes Rollenspiel ist das der Herausgeber. Wir danken den Autorinnen und Autoren herzlich für die Abfassung und geduldige Überarbeitung der Aufsätze (Herausgeber können manchmal pingelig sein). Die Redaktionsarbeit hat uns deutlich gemacht, in wie viele fachliche Diskurse die Jubilarin eingebunden ← 14 | 15 → ist und wie viele Verstrebungen und Verankerungen sich bei der Vertiefung in spezielle Aspekte der drei von uns eher heuristisch abgesteckten Bereiche ihrer Tätigkeit entbergen.
Nicht zuletzt danken wir Waltraud Mudrich für ihr Engagement bei der Textredaktion, dem Dekan der Fakultät für Kunst- und Sportwissenschaften der TU Dortmund, Prof. Dr. Günther Rötter, für die Unterstützung dieses Buchprojektes sowie Dr. Hermann Ühlein von der Essener Dépendance des Peter-Lang-Verlages für die freundliche Zusammenarbeit.
Zum Schluss noch einmal zurück zu Wagenschein. Die Schwierigkeit bei einer Festschrift ist es, der Themenfülle einen stimmigen Rahmen zu geben. Mit der Aufzählung der Beiträge ist noch nichts gewonnen. Machen Sie sich, liebe Leserinnen und Leser, die Mühe der Lektüre, um selbst zu erfahren, wie durch die Versenkung ins Einzelne sich die Wände des Faches von selber auflösen.
Thomas Erlach, Burkhard Sauerwald ← 15 | 16 → ← 16 | 17 →
1Zum Fachdiskurs über die Qualität musikpädagogischer Festschriften vgl. Christoph Richter, Die Festschrift in der Musikpädagogik (Diskussion Musikpädagogik 51/2011, S. 51–53).
← 17 | 18 → ← 18 | 19 →
Tiere auf der Opernbühne sind keine Rarität. Häufig sind sie Erzeugnisse der Bühnentechniker oder stammen aus dem Requisitenfundus. Doch es gibt sie auch in natura, dann sind sie besondere Attraktionen – oder es entfacht sich Streit über sie zwischen Opernfreunden und Tierschützern. So geschah es in der Spielzeit 2012/13 an einem Opernhaus des Ruhrgebiets, dass Tierschützer den Einfall eines Regisseurs, zwei kleine Hunde über die Bühne führen zu lassen, vereitelten. In den meisten Fällen sind sie vom Librettisten oder Komponisten verlangte Staffage. Sie haben keine definierten Rollen.
Gegenbeispiele wären aber beispielsweise Fafner, der Drache, oder der dressierte Affe, der den Leuten von Hülsdorf-Gotha als Der junge Lord Barrat vorgeführt wird. Textierte Gesangsstimmen machen sie zu dramatischen Figuren, sie spielen eine Rolle. Deswegen werden sie von kostümierten Menschen dargestellt.
Dies finden wir auch in Opern für Kinder. Sie basieren entweder auf Märchenstoffen, in denen sich Tiere und Menschen begegnen, oder ihre Libretti sind märchenhaft angelegt. Gunter Reiß und Mechthild von Schoenebeck führen in den beiden Bänden ihrer Stückeverzeichnisse eine Reihe von Beispielen an, die von Engelbert Humperdincks Sieben Geißlein über Wilfried Hillers Tranquilla Trampeltreu bis in den Bereich des Musicals reichen, zu dem die Widmungsträgerin dieser Festschrift u. a. mit Die Rache der Igel selbst einen gewichtigen Beitrag geleistet hat. Auch zwei verschiedene Vertonungen von Reineke Fuchs sind im Stückeverzeichnis enthalten: eine Oper von Ruth Zechlin und ein Musical von Franz Josef Breuer.
Diese beiden Stücke basieren auf Johann Wolfgang Goethes Versepos von 1794. Es kommen nur Tiere vor, und jeder versteht: Hier werden in einer „anthropomorphisierenden Tierallegorie […] menschliche Eigenschaften verdeutlicht“1. Gleiches kann man von vielen der genannten Opern und Musicals für Kinder auch sagen.
Gilt es auch für Leoš Janáčeks Abenteuer der Füchsin Bystroushka? Mit Goethes Reineke Fuchs und den beiden Vertonungen von Zechlin und Breuer hat diese Oper die tierische Hauptrolle gemeinsam. Doch dieser steht auch eine menschliche gegenüber, der Förster. Und darüber hinaus geht es hier um eine Konfrontation von menschlichem und tierischem Verhalten. Tiere und Men ← 19 | 20 → schen benutzen zwar die gleiche Sprache, aber nur untereinander. Sie können sich gegenseitig nicht verstehen.
In Janáčeks Oper ist das erfüllt, was Jacob Grimm zum „Wesen der Tierfabel“ zählte:
„Wer Geschichten ersinnen wollte, in denen die Tiere sich bloß wie Menschen gebärdeten, nur zufällig mit Tiernamen und Gestalt begabt wären, hätte den Geist der Fabel ebenso verfehlt wie wer darin Tiere getreu nach der Natur aufzufassen suchte, ohne menschliches Geschick und ohne den Menschen abgesehene Handlung. Fehlte den Tieren der Fabel der menschliche Beigeschmack, so würden sie albern, fehlte ihnen der tierische, langweilig sein. Einleuchtend finden wir diese Erfordernisse bewährt, wenn sich die Kunst der Tierfabel bemächtigen will. Der Künstler muss es verstehen, den Tieren ihr Eigentümliches zu lassen und sie zugleich in die Menschenähnlichkeit zu erheben: er muss, den tierischen Leib beibehaltend, ihm dazu noch Gebärde, Stellung, leidenschaftlichen Ausdruck des Menschen zu verleihen wissen.“2
Janáček lässt in seiner Oper getreu diesem Postulat Mensch und Tier einander auf gleicher Höhe mit ihrem jeweils eigenen Verhalten begegnen und auch ab und zu die Grenzen verschwimmen. Mensch und Tier sind in gleichem Maße den allgemeinen Abläufen der Natur unterworfen.
In den beiden Bänden des Stückeverzeichnisses wird Janáčeks Oper nicht zu den ausgewählten Stücken für Kinder gezählt. In Tschechien ist sie dagegen „besonders für Schülervorstellungen sehr beliebt“3. Nun kann es viele Gründe haben, warum die Herausgeber die „Füchsin Bystroushka“ nicht in ihr Verzeichnis aufgenommen haben, nicht zuletzt wohl den, dass sie an „die Aufführungspraxis und Leistungsfähigkeit der Musikschulen“4 gedacht haben, also an die Aufführbarkeit der Stücke an Musikschulen. Janáčeks Oper ist dagegen für das professionelle Musiktheater bestimmt.
Sie wäre damit unter die Opern zu zählen, die sich an das eher erwachsene Publikum richten, aber auch für Kinder bzw. Schüler als zugänglich gelten, für die didaktische Konzepte erarbeitet wurden wie beispielsweise für Die Zauberflöte, für Der Freischütz oder für Der Fliegende Holländer. Allerdings sondert sie sich von diesen Opern wiederum ab wegen
–der großen Zahl von Tierrollen, der gegenüber die Menschenrollen in der Minderheit sind,
–der unmittelbaren Verschmelzung von mährischer Originalsprache und Melodik (‚Sprachmelodie‘), die eine Übersetzung ins Deutsche sehr schwer und ein tieferes Erfassen des musikalischen Ausdrucks nur in Verbindung mit der Originalsprache möglich macht. ← 20 | 21 →
Spätestens an dieser Stelle ist zu klären, wie der korrekte Titel lautet. Dazu kann die Entstehungsgeschichte beitragen. Die Brünner Zeitung Lidové noviny hatte eine Serie von 200 Federzeichnungen von Stanislaw Lolek über das Leben einer Füchsin angekauft und ihren Gerichtsreporter und Feuilletonisten Rudolf Tčsnohlídek beauftragt, dazu Bildlegenden zu schreiben. So sollte die Serie in Fortsetzungen in der Zeitung erscheinen, eine Art Vorläufer der Comic Strips. Janáček hielt diese Zeitung, ja er veröffentlichte auch selbst Beiträge in ihr. Seine Haushälterin Marie Stejskalová las die Zeitung auch und amüsierte sich über die Füchsin. Sie nimmt für sich in Anspruch, Janáček zur Komposition einer Oper über diese Füchsin angeregt zu haben, mit folgenden, in ihrer Autobiographie veröffentlichten Worten: „Der gnä‘ Herr weiß doch so gut, wie die Tiere sprechen, er schreibt doch immer auf, wie die Vögel singen – wäre das nicht eine herrliche Oper?“5.
Janáček hatte ebenfalls sein Vergnügen an den Bildergeschichten und plante tatsächlich eine Oper über das Sujet. Těsnohlídek sollte ihm das Libretto liefern, doch der weigerte sich. Janáček verfasste daraufhin sein Libretto selbst. Die Füchsin trug den Namen Bystrouška, so hatte sie schon in den Bildergeschichten geheißen, und Janáček gab seiner Oper den Titel Příhody Lišky Bystroušky (Die Abenteuer der Füchsin Bystroushka). In deutscher Übersetzung von Max Brod wurde daraus der bei uns geläufige Titel Das schlaue Füchslein, doch der ist irreführend, denn ein Füchslein ist Bystroushka nur am Anfang des ersten Aktes, danach wird ihr weiteres Leben als Füchsin bis zu ihrem Tod behandelt. Das Attribut „schlau“ kommt der deutschen Überlieferung vom „Schlaufuchs“ entgegen, wie er z. B. in Goethes Reineke Fuchs auftritt und deutlich menschliche Verhaltensweisen kritisiert. In der Oper verhält sich die Füchsin dagegen überwiegend tiergemäß, nimmt zwar wiederholt auch menschliche Verhaltensweisen an, die man aber nicht unbedingt als „schlau“ bezeichnen möchte. Der Eigenname Bystroushka leitet sich im Übrigen von den tschechischen Wörtern „bystrý“ (scharf) und der Verkleinerungsform „ouška“ von „ucha“ (Ohren) ab, bedeutet also „Scharföhrchen“ und damit eine artgemäße Eigenschaft. (Ursprünglich war der Name sogar „Bystronožka“ (scharffüßig, flink), durch einen Lesefehler des Setzers der Zeitung wurde daraus „Bystrouška“).6 So sollte man tatsächlich den wörtlich übersetzten Originaltitel Die Abenteuer der Füchsin Bystroushka auch im Deutschen benutzen, wie ihn der Komponist geprägt hat.7
Ab 1920 erschienen die Bildergeschichten mit den Texten von Těsnohlídek in den Lidové noviny. Ab 1921 machte sich Janáček an die Materialsuche und -auswahl, im Februar 1922 begann er mit der Komposition. Das fertige Werk erlebte im November 1924 in Brünn seine Uraufführung. Das Libretto entstand ← 21 | 22 → nach und nach mit mehreren Pausen; nachdem Těsnohlídek abgesagt hatte, schrieb es Janáček selbst und erfand dafür die Handlung des dritten Aktes neu, denn in der Bildergeschichte endet die Handlung mit der Hochzeit der Füchsin. Das Kinderglück des Fuchspaares, die Erschießung der Füchsin und den Traum des Försters, in dem er wieder eine kleine Füchsin vor sich sieht, die sich nach seinem Erwachen aber, wie auch schon am Anfang, als Frosch entpuppt, hat Janáček hinzugefügt.
Der Komponist teilte die drei Akte in sich symmetrisch in mehrere Einheiten auf, die abwechselnd in der Welt der Tiere und der Menschen spielen. Im ersten Akt haben zunächst die Tiere in ihrer Umgebung die Herrschaft, in die der Mensch, der Förster, als Fremdkörper eindringt; danach befinden wir uns im Lebensbereich des Menschen, dem Försterhaus mit der Familie und den gezähmten Haustieren, in die die Füchsin gewaltsam versetzt wurde. Der zweite Akt spielt zuerst bei den Tieren, dann bei den Menschen, anschließend wieder bei den Tieren; der dritte schließlich beginnt bei den Tieren und endet mit der Synthese von Tier- und Menschenwelt in der Natur. Die Abschnitte werden jeweils durch eine orchestrale Verwandlungsmusik verbunden. Ein weiteres Element der Symmetrie ist die Wiederkehr von Teilen des ersten Bildes aus dem ersten Akt am Ende des dritten Aktes.
Analog dazu sind auch einzelne Szenen symmetrisch umrahmt von gleichen musikalischen Abschnitten: So wird die erste Begegnung von jungem Füchslein und Förster zu Beginn des ersten Aktes von einem Tanz der blauen Libelle im Sechsviertel-Takt umrahmt. Die ausgedehnte Liebesszene von Fuchs und Füchsin im zweiten Akt ist eingerahmt von einem textlosen Gesang des Chores hinter der Bühne, der den Akt nach der Hochzeit hymnisch beschließt.
Indem der Komponist sich aus den kleinen Fortsetzungsgeschichten der Zeitung eine Folge von größeren Szenen mit einer zusammenhängenden Handlung schuf, die er auch mit erzählenden Überschriften (Wie das Füchslein Bystroushka gefangen wird – Bystroushka in der Seeförsterei – Bystroushka politisiert – Und entläuft) versah, stellte er auch eine lineare Zeitabfolge her. Allerdings behandelte er diese nicht getreu dem realen Zeitablauf. So überbrückt die erste Verwandlungsmusik zwischen der Gefangennahme von Bystroushka und ihrem Zwangsaufenthalt in der Försterei einen Zeitraum von einigen Monaten zwischen einem Sommer- und einem Herbstnachmittag. In diesen Monaten hat sich Bystroushka vom tapsigen Füchslein zum halb erwachsenen, selbstbewussten und aufmüpfigen Jungtier entwickelt. Die zweite Szene reiht einige kurze Aktionen aneinander, die man sich als kurze Bilderfolgen in der Zeitung vorstellen kann: den Dialog zwischen Bystroushka und dem traurigen Dackel, den Schabernack der beiden Knaben und Bystroushkas Gegenwehr mit ihrer Anleinung, Bystroushkas Traum von sich als schöner junger Frau, schließlich den Auftritt von Hahn und Hennen mit Bystroushkas aufwiegelnder Rede, dem Reißen der Hennen und ihrer Flucht. Dies alles folgt innerhalb der einen ← 22 | 23 → Szene wie in einem Film unmittelbar aufeinander; dabei fällt besonders auf, wie die Zeit zwischen Abend- und Morgendämmerung mit Bystroushkas Traum auf die Dauer von 71 Takten, etwa dreieinhalb Minuten komprimiert ist.
Komisch wirkt sich diese Zeitverkürzung in der Liebesszene des zweiten Aktes aus, als die Zeit zwischen erster gemeinsamer Nacht von Füchsin und Fuchs und der Klage Bystroushkas über ihre Schwangerschaft auf 24 Takte zusammenschmilzt. Hierzu unten mehr.
Diesen Kurzszenen im Zeitraffertempo stehen andere Szenen gegenüber, in denen die Zeit still zu stehen scheint. Wenn die Natur im Wald ungestört vom Menschen ihr eigenes, immer gleiches Leben lebt, dann gibt es keine Veränderung. Diese Szenen am Anfang und am Ende umschließen die Oper und verweisen damit auf das ewige Werden, Vergehen und Neuwerden des Lebens in der Natur, das Janáček zur Hauptaussage seines Werkes erhebt. In einem Brief an seinen Freund Max Brod formulierte er das so:
„Frühjahr im Walde – aber auch das Alter. Im Traum erscheint dem Förster der Wald mit allem, was da kreucht und fleucht; er sucht sein schlaues Füchslein. Es ist nicht mehr. Aber da watschelt ein kleines, ebensolches bis an ihn heran. ‚Der Mutter wie aus dem Auge gefallen.‘ Und so dreht sich das Übel und das Gute von neuem durch das Leben. Schluss.“8
Michael Ewans interpretiert diese Aussage der Oper ähnlich, leitet sie aber unterschiedlich her. Er sieht
„zwei Stränge eng miteinander verknüpft: Die Allegorie und die Parabel. Einerseits zeigt Janáček die Biographie einer Füchsin als allegorische Darstellung nicht nur des ewigen Zyklus von Wachstum, Liebe, Tod und Erneuerung in der Tierwelt, sondern auch der zyklischen Form alles animalischen und menschlichen Lebens; andererseits ist in Bystroushkas Biographie eine detaillierte Parabel zu sehen, eine Reihe von fast rituellen Konfrontationen zwischen Mensch und Tier, in deren Verlauf ein Mensch, nämlich der Förster, schließlich von der ausbeuterischen Grausamkeit (1. Akt) zur Weisheit einer visionären Harmonie mit der Natur gelangt.“9
Neun Menschen treten vierzehn Tieren mit Gesangsrollen und weiteren fünf oder sechs Kleintierrollen für das Ballett gegenüber. Dieses zahlenmäßige Übergewicht der Tiere relativiert sich aber, wenn man die Größe der Rollen berücksichtigt. Sowohl bei den Menschen wie bei den Tieren gibt es je eine Hauptrolle: Förster (Bariton) und Füchsin (Sopran). Nebenrollen finden wir bei den Menschen mit Schulmeister, Pfarrer und Landstreicher drei größere, bei den Tieren mit Fuchs und Dackel zwei, die kleineren Menschen- und Tierrollen sind nach Angaben des Klavierauszuges von Chorsängern oder Kinderstimmen auszuführen. In der Konzentration auf die beiden Hauptrollen zeigt sich das Gleichgewicht von Mensch und Tier. ← 23 | 24 →
Gleichgewicht von Mensch und Tier bedeutet nicht Einebnung aller Unterschiede. Zur Einsicht in den Kreislauf des Lebens und zur versöhnten Resignation ist am Ende der Mensch, der Förster fähig, während das Tier sich von Geburt an innerhalb dieses Kreislaufs befindet und keinen Lernprozess zu durchlaufen braucht. Trotz des Gebrauchs derselben Sprache, eines ostmährischen Dialekts, können sich die Tiere untereinander verständigen, ebenso auch die Menschen, aber die Menschen verstehen die Tiere nicht.10
Die Füchsin aber versteht die Sprache der Menschen und ist außerdem in der Lage, zu anderen Tieren wie ein Mensch zu reden. Dies zeigt sich bei ihrer Agitation, wenn sie die Hühner zum Aufstand gegen den Hahn aufstachelt, bei der Vertreibung des Dachses aus seinem Bau und in besonders anrührender Weise in der Liebesszene mit dem Fuchs. Hier spricht sie nicht nur die Sprache der Menschen, sondern sie zeigt auch das Verhalten wie bei einem jungen Mädchen, das sich geniert und sich unsicher ist, was der junge Mann/der Fuchs wohl so reizvoll an ihr findet, bis sie sich ihrem eigenen Liebesgefühl überlässt. In einer früheren Szene, im ersten Akt, träumt sie von ihrer Zukunft und sieht sich in der menschlichen Gestalt eines schönen Mädchens.
Aber die Füchsin ist kein Mensch in Tiergestalt, wie es in den meisten Märchenopern der Fall ist, sie zeigt auch reines Raubtierverhalten, wenn sie die Hühner des Försters reißt oder ihren Jungen ermöglicht, den Korb des Landstreichers Haraschta zu plündern und die Hühner darin zu töten. Schließlich stirbt sie auch als Tier durch die Kugel des Landstreichers, nachdem sie diesen noch beschimpft hat, er wolle sie nur töten, weil „ich ein Fuchs bin“ – was er nicht versteht. Janáček belässt die Tiere insgesamt in ihrer Welt, „in einer Bühnengemeinschaft […], die sich durch Humor und eine unkomplizierte, amoralische Lebenslust […] auszeichnet“11. Die Menschen dagegen greifen bedenkenlos in die Tierwelt ein; einzig der Förster verändert seine Haltung, singt von der Wiederkehr des Frühlings und der Jugend und lässt seine Flinte sinken. Zur Vision von der „Harmonie mit der Natur“ gelangt er in der Begegnung mit der Tierwelt, er erkennt sich als Teil der Natur. Ulrich Schreiber spricht von einem „nicht entfremdeten Dasein“12.
Die Natur im Einklang mit sich selbst präsentiert sich am Anfang der Oper. Ohne Vorspiel öffnet sich der Vorhang für eine Waldszenerie an einem Sommernachmittag. Insekten umschwirren den gemächlich Pfeife rauchenden Dachs, eine blaue Libelle tanzt ihr eigenes Ballett. Das Orchester trägt eine Musik dazu bei, die sowohl die Sommerhitze wie das lebendige Geschwirre der Insekten wiedergibt. Es ist nicht überaus groß besetzt, zu den üblichen Blasinstrumenten plus Englischhorn, Bassklarinette und Kontrafagott kommt das Schlagwerk einschließlich Glockenspiel und Xylophon sowie Harfe und ← 24 | 25 → Celesta; Streicher in Standardbesetzung. Die Farbigkeit seiner Klänge beruht auf ihrem kurzgliedrigen, kontrastreichen Einsatz, der Vermeidung von Tutti-Wirkungen und der abrupten Gegenüberstellung, auch in vertikaler Gleichzeitigkeit, von scharfen Klängen in extremer Lage mit sonorer Wärme in der Mittellage. Dynamische Extreme fehlen, ein einfaches Forte wird nicht überschritten. Rhythmisch wechseln periodisch gegliederte Tanzpassagen in klaren Zweier- oder Dreiertakten mit verwirrend unsteten Passagen voller Unregelmäßigkeiten ab.
Wenn in diese Naturszene der Förster eintritt, macht Janáček dessen störendes Eindringen musikalisch deutlich. Der Komponist lässt das Orchester eine Phrase weiterspinnen, die zuvor eher eine begleitende Funktion hatte, und den Förster mit seiner Gesangsmotivik eine „Fremdsprache“ sprechen, die auf Janáčeks eigentümlicher Sprechmelodik beruht. In der Gleichzeitigkeit beider Ebenen zeigt sich die Getrenntheit von Natur und Menschenwelt.
Der Förster legt sich nieder auf den Waldboden und schläft ein, da beginnen Grille und Heuschrecke ein kurzes Gespräch. Da wir wissen, dass Janáček auch zu Tierstimmen intensive Studien betrieb und ihre spezifische Melodik notierte13, können wir bei diesem ersten gesungenen Tiergespräch eine analoge Sprechmelodik zur Menschenmotivik erkennen. Tonwiederholungen und ein charakteristisches Intervall – hier die große Terz – werden von einem überwiegend konsonierenden Trillerton des Orchesters begleitet. Dieser könnte die Anspielung auf das Grillenzirpen sein, und so ergibt sich ein Harmonieren von Gesang und Orchester. Tiere und Natur sind einander nicht fremd, sondern eins.
Kurz danach betritt die Füchsin zum ersten Mal die Bühne – zwar erst ein Füchslein, aber noch nicht schlau. Sie sieht einen Frosch und fragt ihre Mutter, was das sei, ob man das essen könne. Ihr Gesang offenbart ihr Intervall, die große Terz, ergänzt etwas später durch die komplementäre kleine Sext. Ihr Motiv im Orchester fußt ebenfalls auf der großen Terz, zunächst abwärts, dann aufwärts. Im ungestörten, metrisch regelmäßigen Dreiachteltakt wird es mehrfach wiederholt und prägt sich leicht ein. So ist dann auch ihr Hilferuf „Mami, Mami!“, der die große Terz zu einer Viertonfolge erweitert, nach der Ergreifung durch den Förster leicht als motivisch abgeleitet zu erkennen. Sogar der Förster variiert die Viertonfolge bei seinem triumphierenden Siegerlachen, ebenso wie das Orchester, das daraus eine Ostinatofigur in Sechzehntel-Quartolen formt. Des Försters Siegerlachen erweist sich jedoch als Irrtum, die Natur behält die Oberhand.
Dies erkennt der Förster erst in der Schluss-Szene des dritten Aktes. Wieder betritt er die Stelle, an der er das Füchslein fing. Es ist ein warmer Herbstnachmittag, wieder ist er müde, und wieder schläft er ein, nachdem er zuvor der Erinnerung an die eigene Jugend und der hier gefundenen Liebe nachgehangen ← 25 | 26 → hat. Er denkt über das stete Wiedererwachen der Natur im Frühling nach und schläft darüber lächelnd ein. Im Traum bemerkt er das Fehlen des Füchsleins, das aber – in Gestalt von Bystroushkas Jungem – plötzlich vor seinem inneren Auge auftaucht und so verblüffend seiner Mutter Bystroushka gleicht. Im Orchester hört man die Anfangstakte des Liedchens, das kurz zuvor die Fuchskinder in der ersten Szene des dritten Aktes gesungen hatten, als Bystroushka noch nicht erschossen war. Der Rhythmus des Liedchens begleitet schließlich auch die letzten gesungenen Worte der Oper, mit denen der kleine Frosch, den der Förster anstelle des geträumten Füchsleins tatsächlich gegriffen hatte, sich als Enkel des Frosches zu erkennen gibt, den der Förster im 1. Akt auf der Nase hatte, als er da aus seinem Traum erwachte. Dieses Mal aber muss er lächeln und sinkt wieder in seinen Traum zurück. Sein Gewehr entgleitet ihm, und während sich der Vorhang langsam schließt, erklingt aus dem Orchester ein kurzer, aber starker Hymnus auf die Natur.
Details
- Seiten
- 484
- Erscheinungsjahr
- 2014
- ISBN (Hardcover)
- 9783631647127
- ISBN (PDF)
- 9783653042931
- ISBN (MOBI)
- 9783653992427
- ISBN (ePUB)
- 9783653992434
- DOI
- 10.3726/978-3-653-04293-1
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2014 (Mai)
- Schlagworte
- Geschichte der Musikpädagogik Musiktheater Musiktheaterpädagogik Populäre Musik
- Erschienen
- Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2014. 484 S., 28 s/w Abb., 17 Tab.
- Produktsicherheit
- Peter Lang Group AG