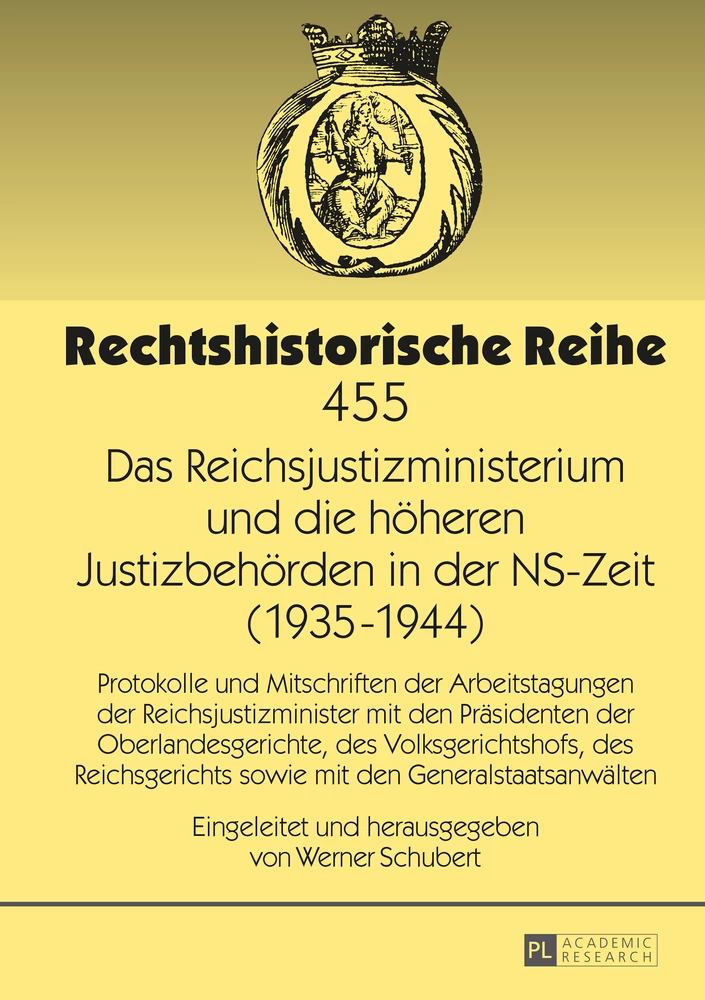Das Reichsjustizministerium und die höheren Justizbehörden in der NS-Zeit (1935–1944)
Protokolle und Mitschriften der Arbeitstagungen der Reichsjustizminister mit den Präsidenten der Oberlandesgerichte, des Volksgerichtshofs, des Reichsgerichts sowie mit den Generalstaatsanwälten
Summary
Excerpt
Table Of Contents
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- I. Die Quellen und der Umfang der Edition
- II. Die Reichsjustizminister (1933–1945)
- III. Der Abbau der Rechtsstaatlichkeit durch die Justizgesetzgebung und sonstige Reformprojekte (1933–1944)
- IV. Die Chefpräsidenten, Generalstaatsanwälte und Oberstaatsanwälte (1933–1945)
- V. Quellennachweis und weitere Informationen
- Protokolle und sonstige Unterlagen der Arbeitstagungen im Reichsjustizministerium mit den Chefpräsidenten der Obersten Gerichte und den Generalstaatsanwälten
- Teil A: Arbeitstagungen unter dem Reichsjustizminister Franz Gürtner
- I. Arbeitstagung der Staatssekretäre des Reichsjustizministeriums mit den Generalstaatsanwälten am 3.4.1935
- II. Arbeitstagung im Reichsjustizministerium am 23.9.1935 mit dem Oberreichsanwalt und den Generalstaatsanwälten
- 1. Aufzeichnung über die Arbeitstagung
- 2. Auszug aus der Tagungsniederschrift
- III. Arbeitstagung vom 29.11.1935 der Generalstaatsanwälte und Oberstaatsanwälte des Reichs
- 1. Überblick über die Arbeitstagung (DJ 1935, S. 1775–1776)
- 2. Auszug aus dem Referat von Karl Deluege
- IV. Arbeitstagung im Reichsjustizministerium vom 11.–14.11.1936 mit den Chefpräsidenten und den Generalstaatsanwälten
- 1. Pressenotiz: Wichtige Besprechungen im Reichsjustizministerium
- 2. Besprechung über die Behandlung von Hochverratssachen am 11. und 12.11.1936
- a) Tagesordnung
- b) Vortrag von Dr. Crohne: Allgemeine Fragen (Vortragsgliederung)
- c) Exposé zum Vortrag für Herrn MinDir. Dr. Crohne
- 3. Niederschrift über die Aussprache aus Anlaß der Tagung betreffend die Blutschutzrechtsprechung und Referat von Freisler über Richterfreiheit und Schutz der Richterehre vom 13.11.1936
- 4. Niederschrift über die Erörterung von Strafvollzugsfragen in der Arbeitstagung der Generalstaatsanwälte am 14.11.1936
- 5. Anhang: Arbeitstagung der Leiter der Justizpressestellen vom 3.–5.11.1936 im RJM (DJ 1936, S. 1739)
- V. Arbeitstagung des Reichsjustizministers mit den Chefpräsidenten und den Generalstaatsanwälten am 18.6.1937
- VI. Arbeitstagung des Reichsjustizministers mit den Chefpräsidenten und den Generalstaatsanwälten am 18.1.1938 (Hamburger Aufzeichnungen)
- VII. Arbeitstagung des Reichsjustizministers mit den Generalstaatsanwälten am 7. und 8.3.1938
- 1. Bericht über die Tagung (Hamburger Aufzeichnungen)
- 2. Zusammenfassung der Referate in der Deutschen Justiz (1938, S. 385 ff.)
- VIII. Arbeitstagung des Reichsjustizministers mit den Chefpräsidenten und den Generalstaatsanwälten vom 23.–26.1. und 27.2.1939
- 1. Besprechung mit den Generalstaatsanwälte im Reichsjustizministerium in Berlin vom 23.–26.1.1939
- 2. Besprechung mit den Chefpräsidenten am 24.1.1939
- 3. Fortsetzung der Besprechung am 25.1.1939 (Aufzeichnungen des Vizepräsidenten des OLG München)
- 4. Fortsetzung der Besprechung am 27.2.1939 (Aufzeichnungen des Vizepräsidenten des OLG München)
- 5. Anhang: Politische Beurteilung der Beamten (Kriterienkatalog des Reichsjustizministeriums) [wohl von Anfang 1939]
- IX. Anhang: Arbeitstreffen des Reichsjustizministers am 24.10.1939 mit den Vorsitzenden der Sondergerichte und den Sachbearbeitern für Sondergerichtsstrafsachen bei den Generalstaatsanwälten
- 1. Einleitende Ansprache durch Reichsminister der Justiz Dr. Gürtner:
- 2. Die Stellung der Sondergerichte in der Strafrechtspflege (Rietzsch)
- 3. Staatssekretär Dr. Freisler: Allgemeines zur Volksschädlings-Verordnung (v. 5.9.1939, RGBl.I 1939, S. 1679) und zu deren § 2
- 4. Staatssekretär Dr. Freisler: Entwurf des Gesetzes gegen Gewaltverbrecher (VO v. 5.12.1939, RGBl. I, S. 2378)
- 5. Beantwortung von Fragen
- 6. Reichsjustizminister Dr. Gürtner (Schlußwort)
- Teil B: Arbeitstagungen unter dem kommissarischen Reichsjustizminister Franz Schlegelberger
- I. Geplante Arbeitstagung am 20.3.1941 mit den Generalstaatsanwälten in Berlin
- 1. Arbeitsplan
- 2. Material für die Besprechung mit den Generalstaatsanwälten am 20.3.1941
- 3. Zusammenstellung der bei der Tagung der Generalstaatsanwälte am 20.3.1941 zu erörternden Punkte, die das Arbeitsgebiet des Sonderreferats betreffen
- 4. Material für die Besprechung mit den Generalstaatsanwälten
- II. Arbeitstagung des kommissarischen Reichsjustizministers mit den Chefpräsidenten und den Generalstaatsanwälten am 23. und 24.4.1941
- 1. Protokoll der Sitzung vom 23. und 24.4.1941
- 2. Protokoll der Sitzung vom 24.4.1941
- III. Arbeitstagung des kommissarischen Reichsjustizministers mit den Generalstaatsanwälten vom 28.–29.10.1941 und den Jugendrichtern vom 30.–31.10.1941
- 1. Tagesordnung
- 2. Aufzeichnungen des Generalstaatsanwalts Wurmstich/Jena über die Mitteilungen von Mettgenberg, Westphal und Freisler
- 3. Roland Freisler: Strafrecht und Fremdvölker im Reich
- 4. Referate über das Thema: „Reichsinspekteur der Staatsanwaltschaft“
- a) Referat von Kramberg (Generalstaatsanwalt in Kiel) […] c) Ich fasse meine Ausführungen in folgenden Sätzen zusammen
- b) Korreferat von Crohne
- 5. Anhang
- a) Besprechung mit den OLG-Präs. und Generalstaatsanwälten der eingegliederten Ostgebiete am 8.11.1940 unter dem Vorsitz des Herrn Ministers in Anwesenheit des Herrn Staatssekretärs Dr. Freisler, Herrn MinDir. Schäfer, MinDir. Dr. Crohne sowie von Sachbearbeitern der Abt. I, II u. III
- b) Besprechung über die Strafrechtspflege der eingegliederten Ostgebiete am 13.12.1940 unter dem Vorsitz des Staatssekretärs Freisler in Posen
- c) Besprechung mit den Vorstandsbeamten der eingegliederten Ostgebiete am 28.7.1942 im Reichsjustizministerium
- IV. Arbeitstagung des kommissarischen Reichsjustizministers Schlegelberger mit den OLG-Präsidenten im Reichsjustizministerium am 16.12.1941
- V. Arbeitstagung des kommissarischen Reichsjustizministers Schlegelberger mit den Chefpräsidenten und den Generalstaatsanwälten am 31.3.1942
- VI. Arbeitstagung mit den Chefpräsidenten und den General Staatsanwälten im Reichsjustizministerium am 5. und 6.5.1942
- 1. Besprechung vom 5.5. 1942 mit den Chefpräsidenten
- 2. Arbeitstagung vom 6.5.1942 mit den Generalstaatsanwälten
- VII. Arbeitstagung der Generalstaatsanwälte in Berlin am 30.6. und 1.7.1942 (Aufzeichnungen von Generalstaatsanwalt Wurmstich/Jena).
- Teil C: Arbeitstagungen unter dem Reichsjustizminister Otto Georg Thierack (1942–1944)
- I. Arbeitstagung des Reichsjustizministers mit den Chefpräsidenten und Generalstaatsanwälten am 29.9.1942
- II. Arbeitstagung des Reichsjustizministers mit den Chefpräsidenten und den Generalstaatsanwälten vom 10. und 11.2.1943
- 1. Protokoll vom 10.2.1943
- 2. Protokoll vom 11.2.1943
- III. Arbeitstagung des Reichsjustizministers mit den Chefpräsidenten und den Generalstaatsanwälten vom 19. und 20.10.1943
- 1. Mitteilung in der DJ 1943, S. 499–500
- 2. Tagesordnung
- 3. Referate aus dem Arbeitsgebiet der Strafrechtspflege- Abteilung des RJM
- 4. Mitschrift der Tagung von GStA Wurmstich/Jena
- IV. Arbeitstagung des Reichsjustizministers vom 3. und 4.2.1944 in Weimar
- 1. Ansprachen des Ministers (teilweise verkürzte Fassung) und des Staatssekretärs
- 2. Referate der Sachbearbeiter
- 3. Detailinformationen zu einigen Tagesordnungspunkten
- V. Arbeitstagung des Reichsjustizministers mit den Chefpräsidenten und den Generalstaatsanwälten vom 23.–25.5.1944 auf der Reichsburg Kochem
- 1. Ausführungen des Ministers auf der Cheftagung in Kochem am 23.5.1944
- 2. Niederschrift des Generalstaatsanwalts Wurmstich/Jena
- 3. Überblick über gesetzgeberische Arbeiten der Abteilung III [Suchomel/Grau]
- 4. Auszug aus dem Referat des ORR Kümmerlein über Fragen aus dem Gebiet der Jugendrechtspflege
- 5. Rede des Reichsführers SS Heinrich Himmler vor Vertretern der deutschen Justiz in Kochem am 25.5.1944
- VI. Arbeitstagung des Reichsjustizministeriums mit den Chefpräsidenten und Generalstaatsanwälten vom 23. und 24.8.1944 auf der Reichsburg Kochem (Niederschrift des GenStA Wurmstich/Jena)
- Anhang I: Teilbericht über die Dienstreise des Amtes des Reichsjustizministeriums für „Neuordnung der Deutschen Gerichtsverfassung“ nach Dresden am 21. und 22.9.1943
- Anhang II: Besprechung der bayerischen OLG-Präsidenten am 28.10.1942 mit Vertretern des Reichsjustizministeriums in Neustadt (Personalangelegenheiten)
- Anhang III: Rede von Thierack zur Hochschullehrertagung vom 16.–18.9.1944 auf der Reichsburg Kochem (gekürzt)
- Anhang IV: Arbeitstagung im RJM vom 3.7.1944 (Ehescheidungsrecht). Referat von Martin Jonas (Senatspräsident am Reichsgericht)
- Biographische Daten der Referenten (mit Ausnahme der OLG-Präsidenten und der Generalstaatsanwälte)
- Register der Redner und Referenten
- Sachregister
I. Die Quellen und der Umfang der Edition
Der Lenkung der Rechtsprechung, der „Kontrolle und Überwachung der Justiz“1 und der einheitlichen Ausrichtung der Justizverwaltung dienten seit der Verreichlichung der Justiz ab 1935 die Arbeitstagungen des Reichsjustizministers oder in Ausnahmefällen Freislers mit den Chefpräsidenten und den Generalstaatsanwälten im Reichsjustizministerium in Berlin. Sie fanden unter dem Reichsjustizminister Gürtner ein bis zwei Mal im Jahr, unter Schlegelberger und Thierack halbjährlich statt. Der Lenkung der Rechtsprechung dienten nicht erst die Tagungen unter Schlegelberger und Thierack, sondern bereits unter Gürtner, wie die Aufzeichnung über die Tagung vom November 1936 zeigt (Hochverratsprozesse, Blutschutzrechtsprechung). Die Protokolle der Arbeitstagungen und Aufzeichnungen über diese sind wiederholt in der Literatur für einzelne Beratungsgegenstände herangezogen worden, sehr oft für die Zeit bis 1940 von Lothar Gruchmann, ferner insbesondere für die Kriegszeit von Werner Johe und von Hinrich Rüping2. Es scheint deshalb gerechtfertigt, die Protokolle und sonstigen Materialien der Arbeitstagungen weitgehend ungekürzt zu veröffentlichen, damit der Zusammenhang, in dem die einzelnen Beratungsgegenstände behandelt wurden, deutlich wird. Von Interesse sind insbesondere die Ausführungen der jeweiligen Justizminister. Während Gürtner – wenn auch mit Einschränkungen – noch 1938 davon sprach, „das Dritte Reich sei auf dem Fundament einer unabhängigen ← XI | XII → Rechtsprechung gegründet“, sprach Thierack 1942/1943 nur noch von der „Weisungsfreiheit“ des Richters, die sich primär auf die Feststellung des Tatbestandes beziehen sollte. Von Interesse sind auch die Diskussionsbeiträge einzelner OLG-Präsidenten und Generalstaatsanwälte besonders auf den Tagungen von Thierack.
Die Überlieferung der Protokolle der Tagungen bzw. der vollständigen Niederschrift über die Tagungen ist unvollständig. Für die Zeit bis Mitte 1939 sind insoweit die Generalakten des Reichsjustizministeriums über die Arbeitstagungen verlorengegangen. Als Ersatz dienen einerseits Einzelteile der Niederschriften/Protokolle in den jeweiligen Sachakten des Reichsjustizministeriums (besonders für 1936), andererseits zusammenhängende Tagungsmitschriften aus den Überlieferungen der Oberlandesgerichte Hamburg, Jena und München sowie der Münchner Generalstaatsanwaltschaft. Aus der Amtszeit Schlegelbergers (1941/42) sind zwei Protokolle überliefert.
Über die Arbeitstagungen unter Schlegelberger vom 16.12.1941, vom 5./6.5. und vom 30.6./1.7.1942 liegen Mitschriften des Generalstaatsanwalts Wurmstich von Jena sowie des OLG-Präsidenten Becker von Jena vor. Zu den Arbeitstagungen unter Thierack vom 29.9.1942, vom 10./11.2.1943 und teilweise auch vom 3./4.2.1944 sind die Protokolle überliefert. Die weiteren Arbeitstagungen vom 19./20.11.1943, vom 23.–25.5. und 23.–24.8.1944 werden erschlossen durch Teilüberlieferungen im Bundesarchiv in Berlin und vor allem durch die Niederschriften des Generalstaatsanwalts Wurmstich und des OLG-Präsidenten Becker von Jena, von denen die jeweils aussagekräftigere Niederschrift – mit Ergänzungen aus der parallelen Mitschrift – wiedergegeben wird.
Die Anlagen zu Teil C bringen zunächst einen Teilbericht über die durch einen Fragebogen vorbereitete Dienstreise des Amtes des RJM für „Neuordnung der deutschen Gerichtsverfassung“ nach Dresden vom 21.–22.9.1943, das Reformvorschläge zur Gerichtsverfassung (einschließlich der Stellung des Richters) ausarbeiten sollte. Weitere Berichte liegen vor für die OLG-Bezirke von Bamberg, Breslau, Graz (einschließlich der Gerichte für die Untersteiermark, des Oberkrains und der Operationszone „Adriatisches Küstenland“), ← XII | XIII → von Hamm, Innsbruck, Jena, Karlsruhe, Königsberg, Leitmeritz, Naumburg, Stuttgart und Zweibrücken. Mit der Wiedergabe des Berichts für den OLG-Bezirk Dresden soll gleichzeitig auf die inhaltsreichen weiteren Arbeitsberichte hingewiesen werden. Die Anlage II bringt Auszüge aus einem Protokoll über eine Besprechung der bayerischen OLG-Präsidenten am 28.10.1942 mit Vertretern des Reichsjustizministeriums über die Abordnung preußischer Juristen an bayerische Gerichte. Im Anhang III werden Auszüge aus der Rede von Thierack zur Hochschullehrertagung vom 16.–18.9.1944 auf der Reichsburg Kochem (Richterstellung, familienrechtliche Fragen) wiedergegeben.
Zum Anhang IV ist zunächst darauf hinzuweisen, dass auf der 1942 vom Reichsjustizministerium erworbenen Burg Kochem zumindest von April bis Anfang 1944 Lehrgänge und Arbeitsgemeinschaften stattfanden für Personalsachbearbeiter, die Vorsitzenden der Hochverratssenate bei den Oberlandesgerichten (einschließlich der Sachbearbeiter der Staatsanwaltschaften), für die Sondergerichtsvorsitzenden, die Vormundschafts- und Familienrichter, die Nachwuchskräfte, die Personalsachbearbeiter für den gehobenen Personaldienst (einschließlich der Leiter der Rechtspfleger- und Justizschulen) sowie für die Erbhofgerichtsvorsitzenden und für die Ehescheidungsrichter. Ferner fanden noch Lehrgänge für die Praktiker-Arbeitsgemeinschaften an den Universitäten und für den Nachwuchs statt (Niederschriften im Thüringischen HStA Weimar, OLG Jena, Nr. 826, und BA Berlin R 3001/10121). Die Tagungen wurden geleitet von den jeweils zuständigen Abteilungsleitern des Reichsjustizministeriums (u. a. von den Ministerialdirektoren Altstötter, Vollmer und Letz). Wiedergegeben wird die Niederschrift über das Referat von Jonas (Vorsitzender des familienrechtlichen Senats des Reichsgerichts) auf der Arbeitstagung für Scheidungsrichter im Hinblick auf die in den Chefbesprechungen wiederholt behandelte Judikatur zum Ehegesetz von 1938 (zugleich auch als Hinweis auf die Arbeitstagungen von 1944).
Für einzelne Tagungsabschnitte werden teilweise zwei Teilversionen (u. a. für die Tagungen vom 5./6.5.1942 mit den OLG-Präsidenten ← XIII | XIV → und den Generalstaatsanwälten mit teilweise gleichem Inhalt) wiedergegeben, um die unterschiedliche Schwerpunktsetzung der Mitschriften zu dokumentieren. Im übrigen ist es nicht ausgeschlossen, dass sich in den Überlieferungen weiterer Oberlandesgerichte/Generalstaatsanwaltschaften Mitschriften über die Cheftagungen auffinden ließen; jedoch ist es unwahrscheinlich, dass diese ähnlich ausführlich wären wie die Mitschriften aus Jena.
Kleinere Teile der Ausführungen von Schlegelberger und Freisler vom 31.3.1942 sowie von Thierack am 29.9.1942 und vom 16.–18.9.1944 hat Heinz Boberach 1975 veröffentlicht. Auch diese Teile werden in der vorliegenden Edition mit Genehmigung des Bundesarchivs nochmals wiedergegeben, schon um den Gesamtzusammenhang zu erschließen, in dem die Ausführungen von Schlegelberger, Freisler und Thierack stehen. Die Rede von Thierack zur Hochschullehrertagung vom September 1944 auf der Reichsburg Kochem ist insofern auch im Rahmen der vorliegenden Edition von Interesse, als Thierack hier zur Stellung des Richters und zum familienrechtlichen Reformprogramm Stellung nimmt.
Aus Platzgründen mußten Teile der Niederschriften/Protokolle vom 18.6.1937, vom 27.10.1939, vom 23./24.4.1941 und vom 10./11.2.1943, die sich meist mit Fragen der Justizverwaltung befassen, weggelassen werden. Dagegen werden die kürzeren Niederschriften vom Herbst 1943 und von 1944 auch insoweit wiedergegeben, als sie Fragen des Justizalltags und Bombenschäden an den Justizgebäuden behandeln, um das Funktionieren der Justiz bis in die Endphase des Nationalsozialismus zu dokumentieren.
Als Anlagen zu Teil A werden wiedergegeben: die Ausführungen Gürtners und Freislers auf der Arbeitstagung u. a. der Sondergerichtsvorsitzenden am 24.10.1939, im Quellenteil B die Aufzeichnungen über die Besprechungen mit den Vorstandsbeamten der eingegliederten Ostgebiete am 8.11.1940 und 13.12.1940 sowie 28.7.1942, auf die zum Teil in den zentralen Arbeitsbesprechungen hingewiesen wurde.
Die Einleitung unter II. geht ein auf die Biographie der Justizminister und des Staatssekretärs Freisler, unter III. auf die wichtigsten Stationen des Abbaus der Rechtstaatlichkeit. Eine detaillierte ← XIV | XV → Erschließung der Beratungsgegenstände (u. a. Hochverrats- und Blutschutzgesetzgebung, Unabhängigkeit/Weisungsfreiheit des Richters, Schutzhaft, Sicherungsverwahrung, Polenstrafrecht, Strafvollzug, Judikatur zum Ehegesetz von 1938) ist in der vorliegenden Edition nicht möglich. Für die Amtszeit Gürtners (bis Angang 1941) sei auf Lothar Gruchmann: „Justiz im Dritten Reich 1933–1940. Anpassung und Unterwerfung in der Ära Gürtner“, 3. verbesserte Auflage, München 2001 (mit einem breiten Sachregister) verwiesen. Für die Dienstzeit Schlegelbergers liegt insoweit noch keine Monographie vor. Über die Amtszeit Thieracks unterrichtet Sarah Schädler, „Justizkrise“ und „Justizreform“ im Nationalsozialismus. Das Reichsjustizministerium unter Reichsminister Thierack (1942–1945), Tübingen 2009; jedoch fehlt hier eine detailliertere Erschließung der Strafrechts- und Zivilrechtspflege. Im übrigen sei auf das Sach- und Personenregister und auf die Hinweise zu den Sachbearbeitern des RJM, soweit sie auf den Arbeitstagungen Referate hielten, am Ende des Bandes hingewiesen.
II. Die Reichsjustizminister (1933–1945)
1. Franz Gürtner (Reichsjustizminister von 1932–1941)3 wurde am 26.8.1881 in Regensburg als Sohn eines Lokomotivführers geboren und starb am 29.1.1941 in Berlin. Nach dem Abitur am Neuen Gymnasium in Regensburg studierte er Rechtswissenschaften von 1900–1904 in München (1908 2. Juristische Staatsprüfung). 1909 war er Syndicus bei einem Brauereiverband, trat jedoch im gleichen Jahr in den bayerischen Justizdienst ein (3. Staatsanwalt am LG München II, 1912 Amtsgerichtsrat). Im Ersten Weltkrieg war Gürtner Offizier an der Westfront und danach Hauptmann beim deutschen Expeditionskorps in Palästina. 1917 erfolgte seine Ernennung zum I. Staatsanwalt am LG München I (jeweils ohne Status als Referent im bayerischen Justizministerium). 1920 Ernennung zum LG-Rat, 1921 zum Oberregierungsrat im bayerischen Justizministerium. Von August ← XV | XVI → 1922 – Mitte 1932 war er bayerischer Justizminister als Vertreter der national-konservativ ausgerichteten Bayerischen Mittelpartei (später DNVP). Die milde Bestrafung Hitlers im Münchner Hochverratsprozeß (1924) „ist“ – so Gruchmann, „soweit heute nachweisbar“ – „keinem speziellen Einwirken Gürtners zu seinen Gunsten, sondern der allgemeinen Haltung der damaligen bayerischen Justiz zuzuschreiben. Nicht Gürtner, sondern die Richter des Münchener Volksgerichts, des LG und des Obersten Landesgerichts haben Hitler milde beurteilt, bzw. für seine vorzeitige Entlassung aus der Festungshaft gesorgt“ (Gruchmann, S. 47 f.).
Gürtner, welcher der parlamentarischen Demokratie distanziert gegenüberstand und – unter voller Wahrung der Unabhängigkeit der Justiz – eine „autoritär organisierte“ Regierung als „ideal“ ansah (Gruchmann, S. 49), war seit dem 2.6.1932 im Kabinett v. Papen und anschließend im Kabinett v. Schleicher Reichsjustizminister. Den Eintritt in das Kabinett Hitler als Reichsjustizminister versagte er sich nicht vor allem aus Pflichtgefühl und Loyalität gegenüber dem Staatspräsidenten Hindenburg. Seine Illusion, bei Hitler die Einhaltung der rechtsstaatlichen Grundsätze durchsetzen zu können, war bereits mit den zwischen Ende Februar bis Anfang April 1933 erlassenen, unter III. aufgeführten Gesetzen erschüttert, eine Illusion, an der er „zunächst unbeirrt an seinem optimistischen Glauben an eine Wende zum besseren“ festhielt (Förster, S. 221). Aber bereits mit der Zustimmung zum Staatsnotwehrgesetz vom 3.7.1934 in der Röhm-Affäre vom 30.6.1934 – nach Heintzeler, „wohl der allerletzte Moment, wo man das Schicksal legal hätte enden können“4 – beteiligte er sich am NS-Verbrechenssystem. Mit der Verreichlichung der Justiz konnte Gürtner sich der Übernahme des Staatssekretärs im preussischen Justizministerium Roland Freisler nicht entziehen. Freisler übernahm die Abteilungen für Strafrecht, Strafvollzug und Strafrechtspflege sowie die Personalabteilung für die Hälfte der Oberlandesgerichtsbezirke, das Justizprüfungsamt und für die Staatsanwaltschaften am Reichsgericht und Volksgerichtshof. ← XVI | XVII → Nach der Röhm-Affäre ließ Gürtner ein Diensttagebuch, das einen Umfang von über 2700 Schreibmaschinenseiten einnahm (knapp 1500 Blatt), durch seine persönlichen Referenten v. Dohnanyi vom 4.10.1934–24.12.1938 führen, das alle rechtsstaatswidrigen Eingriffe in die Justiz verzeichnete5. An den Nürnberger Rassengesetzen, an dessen Ausarbeitung das RJM nicht beteiligt war, konnte Gürtner nur geringfügige Milderungen durchsetzen.
Die Schwäche des RJM gegenüber der NSDAP und der Polizei zeigte sich nach dem Novemberpogrom 1938. Wie Gürtner in der Arbeitsbesprechung Ende Januar 1939 ausführte, war „eine justizförmliche Erledigung nicht möglich, weil der Staat seine eigene Rechtsordnung nicht aufheben und zugleich die bei dieser Gelegenheit vorgekommenen Taten verfolgen kann“ (unten S. 112). Die Kriegsstrafgesetze dürfte Gürtner auch im Hinblick auf die Erfahrungen im ersten Weltkrieg wohl weitgehend gebilligt haben: „Ein Volk, dem es nicht gelänge, solchen Willen (Ablehnung des Gemeinschaftsgedankens) zu brechen, würde kaum hoffen können, einen Krieg mit Ehren siegreich zu bestehen“ (unten S. 141). Am 29.1.1941 verstarb Gürtner an schwerer Krankheit in Berlin nach der Rückkehr von einer Reise in das Generalgouvernement unter Hans Frank. Gürtner hat sich während seiner Ministerzeit durch Teilnahme am Unrechtssystem des Nationalsozialismus in Schuld verstrickt, wohl auch um „Schlimmeres zu verhindern“ (Gruchmann, S. 79). Jedoch ist zugleich festzustellen, dass Gürtner „bei seinem Verbleiben im Amt nicht ‚aus irgendwelchen unlauteren Motiven gehandelt hat, weder aus Habsucht, noch aus Ehrgeiz‘ [Niemöller 1950] noch – darf getrost hinzugefügt werden – aus Bedürfnis nach persönlicher Geltung, Sozialprestige oder aus Machtbesessenheit“ (Gruchmann, S. 80).
Anhang: Staatssekretäre während der Amtszeit Gürtners
a) Franz Schlegelberger: über ihn unter II.
b) Roland Freisler (geb. 30.10.1893 in Celle als Sohn eines aus Mähren stammenden Diplom-Ingenieurs; gest. 3.2.1945 bei einem ← XVII | XVIII → Bombenangriff in Berlin)6, begann 1912 nach Besuch von Schulen in Duisburg, Aachen und Kassel (dort am Wilhelm-Gymnasium Abitur) das Studium der Rechtswissenschaften, und trat 1914 in ein Infanterie-Regiment ein. Im Oktober 1915 geriet er in russische Kriegsfangenschaft, während der er die russische Sprache erlernte. Als sich die Kriegsgefangenenlager nach Ausbrauch der Oktoberrevelution auflösten, wurde Freisler bolschewistischer Kommissar. Der Grund für seine späte Rückkehr aus der Kriegsgefangenschaft im Juni 1920 ist bis heute nicht bekannt. Er setzte das Studium der Rechtswissenschaften in Jena fort, das er 1921 mit dem ersten Staatsexamen und der Promotion abschloß (2. Staatsexamen im Oktober 1923). Im Februar 1924 ließ er sich als Rechtsanwalt in Kassel nieder (zusammen mit seinem Bruder Oswald F.). Zunächst im Völkisch-sozialen Block tätig, trat Freisler im Juli 1925 der NSDAP bei und war 1924–1933 Mitglied der Stadtverordnetenversammlung in Kassel, zugleich Kommunal- und Provinziallandtagsabgeordneter.
1932 wurde er in den preussischen Landtag, 1933 in den Reichstag gewählt. Im März 1933 wurde er Ministerialdirektor, zum 1.6.1933 Staatssekretär im preussischen Justizministerium (ab Herbst 1934 im Reichsjustizministerium). Auf Freisler – ein hochbegabter Jurist und dynamischer Redner – geht vor allem die Durchdringung des Straf- und Strafverfahrensrechts mit nationalsozialistischem Gedankengut zurück. Am 20.8.1942 wurde er als Nachfolger Thieracks zum Präsidenten des Volksgerichtshofs ernannt. Als Vorsitzender des Ersten Senats des VGH war er für eine Vielzahl von Todesurteilen vor allem in den als Schauprozesse anzusehenden Strafverfahren zum 20. Juli 1944 verantwortlich.
2. Franz Schlegelberger wurde am 29.10.1876 in Königsberg als Sohn eines wohlhabenden Kaufmanns geboren und verstarb am ← XVIII | XIX → 14.12.1970 in Flensburg7. Nach dem Studium an den Universitäten Königsberg und Berlin wurde er 1897 Referendar, promovierte 1899 zum Dr. iur., wurde 1901 Gerichtsassessor und 1904 Landrichter in Lyck. 1908 kam er als Hilfsrichter an das Kammergericht (hier 1914 Kammergerichtsrat). 1918 war er zunächst im Reichsjustizamt kommissarisch tätig, dann als Regierungsrat und Vortragender Rat im Reichsjustizministerium (seit 1920 Ministerialrat). 1921 wurde er Leiter (ab 1927 als Ministerialdirektor) der neuen Abteilung III Handels-, Gewerbe-, Arbeits- und Völkerrecht des RJM. In der Weimarer Zeit war er maßgeblich an der Aktienrechtsreform beteiligt, die er bis zum Aktiengesetz von 1937 betreute. Zunächst unter Joël, 1932 unter Gürtner, und zwar auch für die Zeit nach dem 31.1.1933, war er Staatssekretär des Reichsjustizministeriums. In die NSDAP wurde er 1938 zwangsweise aufgenommen. Schlegelberger schätzte sich „als bürgerlich konservativ“, eher als „fortschrittlich konservativ“ ein (Förster, S. 39). Im März/Anfang April 1933 leistete Schlegelberger teilweise „sorgfältig versteckten Protest“ (Förster, S. 40; vereinzelt auch noch danach) gegen gesetzgeberische Zumutungen des Nationalsozialismus. Insgesamt hat er die Ausschaltung des Parlaments bei der Gesetzgebung sowie deren Abkehr vom „Individualismus“ und „politischen Liberalismus“ (Förster, S. 42) in der Gesetzgebung begrüßt, wie sich insbesondere in seinem Vortrag von 1937: „Abschied vom BGB“ zeigte. Im ganzen war das Verhalten Schlegelbergers gegenüber Hitler und dem Nationalsozialismus zumindest bis Anfang 1941 ambivalent.
Vom 30.1.1941–20.8.1942 leitete er das Justizministerium als kommissarischer Justizminister. Im März 1942 war er mit dem Fall Schlitt (scharfe Kritik Hitlers an einem seiner Ansicht nach zu milden Urteil) ← XIX | XX → konfrontiert8, der nach einer Urteilskorrektur durch das Reichsgericht Ende März 1942 zur Verurteilung Schlitts zum Tode führte. Ein Jahr vorher war Schlegelberger mit dem Euthanasieproblem9 befaßt, das er in der Arbeitsbesprechung am 31.3.1941 zur Sprache brachte. Unter ihm erfolgten der Erlass der Polenstrafrechts-VO vom 4.12.1941 und die Einführung der Nichtigkeitsbeschwerde in Zivilsachen durch VO vom 15.7.1941; hinzu kam eine „massive Bevormundung“ der Staatsanwaltschaft (Förster, S. 98) durch sein Ministerium. Auch an der Nacht-und-Nebel-Aktion von Ende 1941/1942 (Verschleppung von 7000 nichtdeutschen Zivilisten aus Frankreich, Belgien, den Niederlanden und Norwegen zur Verurteilung in Deutschland) war Schlegelberger beteiligt (Förster, S. 127 ff.). Ferner erklärte sich Schlegelberger mit der Überstellung von Strafgefangenen an die Gestapo einverstanden. Endlich unterstützte er den Vorschlag des Innenministers, „Mischlinge ersten Grades“ zu sterilisieren10: Es sei vorzuziehen „die Verhinderung der Fortpflanzung dieser Mischlinge ihrer Gleichbehandlung mit den Volljuden und der hiermit verbundenen Abschiebung“. „Dem würde es entsprechen, dass die Abschiebung bei denjenigen Halbjuden von vornherein ausscheidet, die nicht mehr fortpflanzungsfähig sind. Ein völkisches Interesse an der Lösung der Ehe zwischen einem solchen Halbjuden und einem Deutschblütigen besteht nicht. Den fortpflanzungsfähigen Halbjuden sollte die Wahl gelassen werden, sich der Unfruchtbarmachung zu unterziehen oder in gleicher Weise (wie Juden) abgeschoben zu werden“.
Im Nürnberger Nachfolgeprozeß III wurde Schlegelberger am 3.12.1947 zu lebenslanger Haft vor allem wegen seines Verhaltens ← XX | XXI → während der Ministerzeit verurteilt11. Seine Billigung des Vorschlags, Halbjuden „die Wahl zu lassen zwischen Unfruchtbarmachung und Abschiebung“ wurde vom Gericht nicht entlastend berücksichtigt. Anfang 1951 wurde er wegen „krankheitsbedingter Haftunfähigkeit“(Förster, S. 169) vorläufig aus der Haft entlassen. Erst 1957 wurde seine Strafe auf die tatsächliche Haftzeit herabgesetzt.
3. Otto Georg Thierack wurde am 19.4.1889 in Wurzen/Sachsen als Sohn eines Kaufmanns geboren (gest. 22.11.1946 im Lager Eselheide/Sennelager [Selbstmord])12. Studium der Rechtswissenschaften in Marburg und Leipzig, 1913 Referendarexamen, 1914 Promotion, 1914–1918 Teilnahme am 1. Weltkrieg. Nach dem Assessorexamen 1920 wurde er 1921 Staatsanwalt beim Landgericht Dresden (1926 beim OLG Dresden). Mitglied der NSDAP seit dem 1.8.1932. Vom 12.5.1933–31.3.1935 war er sächsischer Justizminister und ab 1.1.1935 zugleich Beauftragter des Reichsjustizministers zur Überleitung der Rechtspflege auf das Reich und Leiter der Abteilung Sachsen-Thüringen des RJM. Am 1.4.1935 wurde er Vizepräsident des Reichsgerichts, am 1.5.1936 Präsident des Volksgerichtshofs. Er war Mitglied der strafrechtlichen Ausschüsse der Akademie für Deutsches Recht zwischen 1933 bis ca. 1937, der Strafrechtskommission des Reichsjustizministeriums (1933–1939) und der Großen Strafprozeßkommission des RJM (1936–1938)13. Vom 20.8.1942–30.4.1945 war er Reichsjustizminister, zugleich auch Vorsitzender des NS-Rechtswahrerbundes und Präsident der Akademie für Deutsches Recht. ← XXI | XXII →
Nach dem im Reichsgesetzblatt veröffentlichten Führererlaß vom 20.8.1942 war Thierack damit beauftragt, „eine nationalsozialistische Rechtspflege aufzubauen“ (RGBl. I 1942, S. 535). Thierack war ein „fanatischer Nationalsozialist“14, der skrupellos die Ziele des Nationalsozialismus in der Justiz durchzusetzen versuchte. Mit Himmler vereinbarte er bereits am 18.9.1942 eine „Korrektur bei nicht genügenden Justizurteilen durch polizeiliche Sonderbehandlung“(Braun, S. 176 ff.). Ferner vereinbarte er mit dem Reichsführer SS: „Es werden restlos ausgeliefert die Sicherungsverwahrten, Juden, Zigeuner, Russen und Ukrainer, Polen über 3 Jahre Strafe, Tschechen oder Deutsche über 8 Jahre Strafe nach Entscheidung des Reichsjustizministers. Zunächst sollen die übelsten asozialen Elemente unter letzteren ausgeliefert werden“(Braun, S. 179) (bis Ende April 1943 wurden 14700 Personen von der Justiz unmittelbar in die Konzentrationslager deportiert).
Zur Abgabe von Strafverfolgungen wurde zwischen Thierack und Himmler im September 1942 folgende Vereinbarung getroffen: „Es besteht Übereinstimmung darüber, dass in Rücksicht auf die von der Staatsführung für die Bereinigung der Ostfrage beabsichtigten Ziele in Zukunft Juden, Polen, Zigeuner, Russen und Ukrainer nicht mehr von den ordentlichen Gerichten, soweit es sich um Strafsachen handelt, abgeurteilt werden sollen, sondern durch den Reichsführer SS erledigt werden. Dies gilt nicht für bürgerlichen Rechtsstreit und auch nicht für Polen, die in die deutschen Volkslisten angemeldet und eingetragen sind“(Braun, S. 192). Wegen des Widerstandes von östlichen Gauleitern und des OLG-Präsidenten Wohler (Danzig) wurde die Übernahme der Strafverfolgung von Polen durch die Polizei vorübergehend ausgesetzt. In einer Verordnung vom 1.7.1943 wurde allgemein bestimmt, dass „strafbare Handlungen von Juden durch die Polizei geahndet“ würden (RGBl. I 372). Hinsichtlich einer Prügelstrafe für Jugendliche stellte die Niederschrift über die Besprechung vom 18.9.1942 fest: „Anläßlich der Berichterstattung über die Swing-Jugend hat der Führer die Einführung der ← XXII | XXIII → Prügelstrafe für diese Jugendlichen angeordnet. Aus äußerlichen Gründen soll von der gesetzlichen Einführung dieser Prügelstrafe abgesehen werden. Die für diese Strafe in Frage kommenden Jugendlichen sollen vielmehr durch den Herrn Justizminister an Jugendschutzlager der Sicherheitspolizei abgegeben werden, wo dann die Prügelstrafe zu vollstrecken ist“ (Braun, S. 198). Die von Thierack eingeführten Richterbriefe (ab Oktober 1942)15 und die teilweise schon früher praktizierte Vor- und Nachschau (Besprechung der Gerichtspräsidenten mit Vorsitzenden Richtern vor und nach der Hauptverhandlung) waren zwar noch kein Eingriff in die von Thierack immer wieder betonte „Weisungsfreiheit des Richters“, dürften jedoch in praxi als Beeinträchtigung der Entscheidungsfreiheit des Richters empfunden worden sein.
Staatssekretär unter Thierack war zunächst der Hamburger OLG-Präsident Curt Rothenberger16, der sich schon vor seinem Amtsantritt als Justizreformer empfohlen hatte. Wohl primär auf ihn geht die Begründung der im folgenden Abschnitt genannten „Ämter“ des RJM und von Akademieausschüssen zurück. In den Beratungen des „Amtes“ für „Neuordnung der deutschen Gerichtsverfassung“ bestand für das zu erlassende Richtergesetz Einigkeit darüber17, dass „der Richter seinem Wesen nach frei von bindenden Weisungen, die das Ergebnis des Einzelfalles betreffen, entscheiden müsse“. Insbesondere in der Tatsachenermittlung und Beweiswürdigung sollte der Richter von äußeren Einflüssen frei sein. Auf der anderen Seite wurde als „Ausnahme“ anerkannt, dass „der Führer nicht nur rechtsgrundsätzliche Weisungen ← XXIII | XXIV → erteilen, sondern auch in den Einzelfall eingreifen könne, indem er die Entscheidung an sich ziehe“. Nach der Anlage zum Bericht über die Tagung des „Amtes“ vom März 1944 wurden zu der Frage, „ob der Führer einen Richter anweisen könne, eine bestimmte Entscheidung zu fällen, ohne dass diese Anweisung im Rechtsstreit erwähnt werde“, zwei Meinungen vertreten: „entweder: ‚Der Führer sollte das nicht tun‘, oder: ‚Der Führer kann das nicht tun, weil in der bindenden Anweisung schon die Entscheidung der Evokation liegt‘. Wenn der Rechtsstreit aus dem Bereich des freien Rechts heraustrete und in die politische Sphäre überspiele, dann müsse man die Entscheidung dem Richter nehmen, und zwar offen. Der Führer wolle zweifellos keine Unehrlichkeit.“ Allerdings war unbestritten, dass der Richter sowohl an das Gesetz als auch die hinter ihm stehende nationalsozialistische Rechtsidee gebunden war. Verstieß er gegen die Grundlagen der nationalsozialistischen Weltanschauung und bot er danach nicht mehr die Gewähr, dass er das Recht als Nationalsozialist anwenden werde, so war er in den Ruhestand zu versetzen. Die Entscheidung war vom „Führer“ zu treffen. Die Leitsätze vom 15.6.1944 zu einem Richtergesetz stellten fest, dass die Gerichtsbarkeit vom Führer ausgehe und dieser den Richter auf Lebenszeit ernenne und jede richterliche Gewalt bekleide. Damit sollte der Richter aus der beamtenrechtlichen Stellung herausgenommen werden. Unter Nr. 9 der Leitsätze war die Unabhängigkeit des Richters wie folgt umschrieben: „Niemand darf den Richter in der Ausübung seines Amtes behindern oder beeinflussen, niemand darf in sein Amt eingreifen. Sein Spruch fordert Achtung und Gehorsam. Für ihn ist er nur dem Führer verantwortlich“. Unter Ziffer 10: „Nationalsozialistische Haltung des Richters“ war in Abs. 1 festgestellt: „Der Richter ist Nationalsozialist.“
Am 21.12.1943 wurde Rothenberger von Thierack, in deren Verhältnis es bald zu erheblichen Differenzen gekommen war, entlassen. Äußerer Anlaß hierfür war der Vorwurf, das Werk von Rothenberger „Der deutsche Richter“ (1943), enthalte Plagiate aus einem Werk des Schweizer Rechtshistorikers Heinz Fehr. ← XXIV | XXV →
Nachfolger Rothenbergers wurde zum 1.1.1944 Herbert Klemm18, der im sächsischen Justizministerium persönlicher Referent Thieracks gewesen war und von März 1941 an der Parteikanzlei angehörte (Leiter der Gruppe: „Justiz und Parteirecht“).
Trotz oder besser vielleicht auch wegen der Abgabe von Kompetenzen an die Polizei konnte Thierack die Stellung des RJM im NS-Staat konsolidieren: „Insgesamt hat sich das RJM“ (so Schädler, S. 336 f.), „in den letzten drei Kriegsjahren als aktive und durchaus einflußreiche oberste Reichsbehörde präsentiert, die durch den Wechsel an der Justizspitze sehr bald aus ihrer vorübergehenden Bedeutungslosigkeit herausgetreten ist und wieder an Einfluß gewonnen hat. Das Reichsjustizministerium muß daher als ein wichtiges Ordnungszentrum am Ende des ‚Dritten Reichs‘ gesehen werden, das aufgrund seiner Radikalisierung weit davon entfernt war – wie zwischendurch einmal geplant -, als mit dem Nationalsozialismus unvereinbare Behörde aufgelöst und in andere Ministerien integriert zu werden.“
III. Der Abbau der Rechtsstaatlichkeit durch die Justizgesetzgebung und sonstige Reformprojekte (1933–1944)19
Im folgenden wird auf wichtige Gesetze und Verordnungen sowie sonstige Maßnahmen, welche rechtsstaatliche Grundsätze aushöhlten oder beseitigten, und bedeutendere Reformgesetze hingewiesen. Ein Großteil von ihnen war Gegenstand der Besprechungen im Reichsjustizministerium. ← XXV | XXVI →
- – VO des Reichspräsidenten zum Schutz von Volk und Staat vom 28.2.1933 (RGBl. I 83): Die Verordnung setzte „Kernfreiheitsrechte“ (Werle, S. 65) wie die persönliche Freiheit, das Recht der freien Meinungsäußerung (einschließlich Pressefreiheit), das Vereins- und Versammlungsrecht sowie das Briefgeheimnis „bis auf weiteres außer Kraft“, auch außerhalb der sonst hierfür bestimmten gesetzlichen Grenzen“(§ 1). § 1 der VO bildete die Grundlage für die Verhängung von Schutzhaft, der sog. vorbeugenden Polizeihaft (hierzu Erlasse vom 12./26.7.1934 und 25.1.1938), die der gerichtlichen Kontrolle entzogen und wiederholt Gegenstand von Besprechungen im RJM waren. Durch die VO wurden die mit der Todesstrafe bedrohten Delikte erweitert (vgl. auch § 4, der eine „unbegrenzte Ermächtigung an die Exekutive zum Erlaß strafbewehrter Anordnungen“ enthielt (Werle, S. 65).
- – VO des Reichspräsidenten gegen Verrat am Deutschen Volke und hochverräterische Umtriebe vom 28.2.1933 (RGBl. I 85); Sie brachte eine Verschärfung der Vorschriften gegen Landesverrat und Verrat militärischer Geheimnisse.
- – VO vom 21.3.1933 über die Bildung von Sondergerichten (RGBl. I 136), von denen zunächst für jeden OLG-Bezirk je ein Sondergericht gebildet wurde (zunächst 26 Sondergerichte, in der Kriegszeit bis zu 74 Sondergerichte). Die Zuständigkeit der Sondergerichte wurde sukzessive erweitert. Die Besetzung der Mitglieder der Sondergerichte (ein Vorsitzender, zwei Beisitzer) erfolgte zunächst durch das Präsidium des Landgerichts, ab 1937 wohl durch den OLG-Präsidenten. Rechtsmittel gegen Entscheidungen der Sondergerichte waren nicht zulässig (ab 1940 Möglichkeit der Erhebung der Nichtigkeitsbeschwerde durch die Reichsanwaltschaft beim Reichsgericht [in der Regel zu Ungunsten des Angeklagten]).
- – Verordnung des Reichspräsidenten zur Abwehr heimtückischer Angriffe gegen die Regierung der nationalen Erhebung vom 21.3.1933 (RGBl. I 135), ersetzt durch das sog. Heimtückegesetz, das Gesetz gegen heimtückische Angriffe auf Staat und Partei und zum Schutz der Parteiuniformen vom 20.12.1934 (RGBl. I 1269): „Wer ← XXVI | XXVII → vorsätzlich eine unwahre oder gröblich entstellte Behauptung tatsächlicher Art aufstellt oder verbreitet, die geeignet ist, das Wohl des Reichs oder das Ansehen der Reichsregierung oder der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei oder ihrer Gliederungen schwer zu schädigen, wird … mit Gefängnis bis zu 2 Jahren und, wenn er die Behauptung öffentlich aufstellt oder verbreitet, mit Gefängnis nicht unter drei Monaten bestraft“(§ 1). – „Wer öffentlich gehässige, hetzerische oder von niedriger Gesinnung zeugende Äußerungen über leitende Persönlichkeiten des Staates oder der NSDAP, über ihre Anordnungen oder die von ihnen geschaffenen Einrichtungen macht, die geeignet sind, das Vertrauen des Volkes zur politischen Führung zu untergraben, wird mit Gefängnis bestraft“ (§ 2 Abs. 1).
- – Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich (Ermächtigungsgesetz) vom 24.3.1933 (RGBl. 1933 141). Nach dem vom Reichstag verabschiedeten Gesetz konnten Gesetze auch durch die Reichsregierung (d. h. ohne Zustimmung des Parlaments) beschlossen werden. Die „von der Reichsregierung beschlossenen Reichsgesetze können von der Reichsverfassung abweichen, soweit sie nicht die Einrichtung des Reichstags und des Reichsrats als solche zum Gegenstand haben (Art.2)“.
- – Gesetz über Verhängung und Vollzug der Todesstrafe vom 29.3.1933 (RGBl. I 151). Rückwirkende Einführung der Todesstrafe für die in § 5 der VO vom 28.2.1933 genannten Verbrechen für die Zeit vom 31.1.–28.2.1933 (sog. lex van der Lubbe) – insoweit Aufhebung des Grundsatzes nulla poena sine lege.
- – Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums vom 7.4.1933 (RGBl. I 175). Nach diesem Gesetz waren Beamte (auch Richter und Staatsanwälte), „die nicht arischer Abstammung sind“, in den Ruhestand zu versetzen (§ 3). Dies sollte nicht gelten für Beamte, „die bereits seit dem 1.8.1914 Beamte gewesen sind oder die im Weltkrieg an der Front für das Deutsche Reich oder für seine Verbündeten gekämpft haben oder deren Väter oder Söhne im Weltkrieg gefallen sind“ (§ 3 Abs. 2). Nach § 4 konnten auch Beamte aus dem Dienst entlassen werden, „die nach ihrer bisherigen ← XXVII | XXVIII → politischen Betätigung nicht die Gewähr dafür bieten, dass sie jederzeit rückhaltlos für den nationalen Staat eintreten“.
- – Gesetz über die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft vom 7.4.1933 (RGBl. I 188): „Die Zulassung von Rechtsanwälten, die im Sinne des Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums vom 7. April 1933 nicht arischer Abstammung sind, kann bis zum 30. September 1933 zurückgenommen werden“ (§ 1 Abs. 1). Diese Regelung sollte nicht gelten für die sog. Frontkämpfer und Altanwälte (§ 1 Abs. 2). Zur Beratung dieses Gesetzes des RJM mit den Justizministern der Länder W. Schubert: „Sentimentalität sei nicht am Platze sondern Brutalität“ (Kerrl), Sav.–Zeitschrift für Rechtsgeschichte, Germ. Abt., Bd. 126, 2009, 281–295). – Die Entlassung der Notare erfolgte nach dem Berufsbeamtengesetz.
- – Gesetz gegen gefährliche Gewohnheitsverbrecher und über Maßregeln der Sicherung und Besserung vom 24.11.1933 (RGBl. I 995). Möglichkeit der Anordnung der zeitlich unbegrenzten Sicherungsverwahrung (§ 42 i StGB) von gefährlichen Gewohnheitsverbrechern. Diese Maßregel war wiederholt Gegenstand der Besprechungen im RJM. Ferner Möglichkeit der Anordnung der „Entmannung“ gefährlicher Sittlichkeitsverbrecher (§ 42 k).
- – Gesetz zur Änderung von Vorschriften des Strafrechts und des Strafverfahrens vom 24.4.1934 (RGBl. I 341). Neufassung der Bestimmungen über Hochverrat (§§ 80–93 a StGB). Errichtung des Volksgerichtshofs zur Aburteilung von Hochverrats- und Landesverratssachen. Entscheidung in der Besetzung von fünf Mitgliedern. Der Vorsitzende und ein weiteres Mitglied mußten die Befähigung zum Richteramt haben (Art. III § 1 Abs. 2 des Gesetzes). Verfolgungs- und Anklagebehörde war der „Oberreichsanwalt“ am VGH.
- – Zweites Gesetz zur Überleitung der Rechtspflege auf das Reich vom 5.12.1934 (RGBl. I 1214). Nach diesem Gesetz gingen die Zuständigkeiten der obersten Landesjustizbehörden auf den Reichsminister der Justiz über (vgl. Erstes Überleitungsgesetz vom 16.2.1934, RGBl. I 91). – Durch einen Erlaß des RJM Gürtner vom 16.10.1934 (DJ 1934, 1295) wurde zum 22.10.1934 das ← XXVIII | XXIX → preussische Justizministerium mit dem RJM vereint. Durch das 3. Gesetz zur Überleitung der Rechtspflege auf das Reich vom 24.1.1935 (RGBl. I 68) wurden mit dem 1.4.1935 „die Justizbehörden der Länder Reichsbehörden, die Justizbeamten der Länder unmittelbare Reichsbeamte“ (§ 1). Bereits unter dem 18.12.1934 war eine Ausführungsverordnung zur Vereinheitlichung der Staatsanwaltschaften ergangen (DJ 1934, 1608).
- – Gesetz zur Änderung des Strafgesetzbuchs vom 28.6.1935 (RGBl. I 839). Dieses brachte u. a. eine Durchbrechung des Grundsatzes „nulla poena sine lege“: „Bestraft wird, wer eine Tat begeht, die das Gesetz für strafbar erklärt oder die nach dem Grundgedanken eines Strafgesetzes und nach gesundem Volksempfinden eine Bestrafung verdient. Findet auf die Tat kein bestimmtes Strafgesetz unmittelbar Anwendung, so wird die Tat nach dem Gesetz bestraft, dessen Grundgedanke auf sie am besten zutrifft“ (§ 2 StGB).
- – Das Gesetz zur Änderung von Vorschriften des Strafverfahrens und des Gerichtsverfassungsgesetzes vom 28.6.1935 (RGBl. I 844) brachte eine „freiere Stellung des Richters“ (Rechtsschöpfung durch entsprechende Anwendung der Strafgesetze; Verhütung ungerechter Freisprechungen durch Zulassung der Wahlfeststellung; freieres Ermessen des Richters bei Beweiserhebungen; Beseitigung von einseitigen Bindungen des Rechtsmittelgerichts, eine Befreiung des Reichsgerichts von Bindungen an alte Urteile sowie eine freiere Stellung der Staatsanwaltschaft).
- – Legalisierung der „Röhm-Aktion“ (Ermordung von mindestens 85–90 Personen) durch das Gesetz vom 3.7.1934 über Maßnahmen der Staatsnotwehr (RGBl. I, 529).
- – Gesetz zum Schutz des deutschen Blutes und der deutschen Ehre vom 15.9.1935 (RGBl. I 1146). Nach § 1 war Staatsangehöriger, „wer dem Schutzverband des Deutschen Reiches angehört und ihm dafür besonders verpflichtet ist“. Reichsbürger war nur der „Staatsangehörige deutschen oder artverwandten Blutes, der durch sein Verhalten beweist, dass er gewillt und geeignet ist, in Treue dem Deutschen Volk und Reich zu dienen“ (§ 2). Nach § 4 der 1. VO zum Reichsbürgergesetz vom 15.11.1935 (RGBl. I 1333) konnte ein ← XXIX | XXX → Jude nicht Reichsbürger sein. – „Jüdische Beamte treten mit Ablauf des 31. Dezember 1935 in den Ruhestand“ (§ 4 Abs. 2 S. 1). Dies galt jedoch nicht für Rechtsanwälte, die 1933 noch nicht entlassen worden waren (Frontkämpfer, Altanwälte). Nach der 5. VO zum Reichsbürgergesetz vom 27.9.1938 (RGBl. I 1403) schieden sämtliche jüdischen Anwälte aus der Rechtsanwaltschaft aus; im alten Reichsgebiet war die Zulassung jüdischer Rechtsanwälte zum 30.11.1938 zurückzunehmen. – Zur rechtlichen Beratung und Vertretung von Juden ließ die Justizverwaltung „jüdische Konsolenten“ zu, soweit hierfür ein Bedürfnis bestand. Jüdische Konsolenten durften nur Rechtsangelegenheiten von Juden sowie von jüdischen Gewerbebetrieben usw. geschäftsmäßig besorgen.
- – Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre (Blutschutzgesetz) vom 15.9.1935 (RGBl. I, 1146): § 1 Abs. 1: „Eheschließungen zwischen Juden und Staatsangehörigen deutschen oder artverwandten Blutes sind verboten. Trotzdem geschlossene Ehen sind nichtig, auch wenn sie zur Umgehung dieses Gesetzes im Ausland geschlossen sind.“ – § 2: „Außerehelicher Verkehr zwischen Juden und Staatsangehörigen deutschen oder artverwandten Blutes ist verboten.“ – § 3: „Juden dürfen weibliche Staatsangehörige deutschen oder artverwandten Blutes unter 45 Jahren in ihrem Haushalt nicht beschäftigen.“
- – Gesetz gegen die Schwarzsender vom 24.11.1937 (RGBl. I 1298). Dieses Gesetz war Gegenstand der Besprechungen im RJM.
- – Gesetz zur Vereinheitlichung des Rechts der Eheschließung und Ehescheidung im Lande Österreich und im übrigen Reichsgebiet (Ehegesetz vom 6.7.1938, RGBl. I 807). Das Ehegesetz brachte u. a. die Möglichkeit der Ehescheidung nach Auflösung der häuslichen Gemeinschaft: „Ist die häusliche Gemeinschaft der Ehegatten seit drei Jahren aufgehoben und infolge einer tiefgreifenden unheilbaren Zerrüttung des ehelichen Verhältnisses die Wiederherstellung einer dem Wesen der Ehe entsprechenden Lebensgemeinschaft nicht zu erwarten, so kann jeder Ehegatte die Scheidung begehren. – Hat der Ehegatte, der die Scheidung begehrt, die Zerrüttung ganz oder überwiegend verschuldet, so kann der andere der ← XXX | XXXI → Scheidung widersprechen. Der Widerspruch ist nicht zu beachten, wenn die Aufrechterhaltung der Ehe bei richtiger Würdigung des Wesens der Ehe und des gesamten Verhaltens beider Ehegatten sittlich nicht gerechtfertigt ist“ (§ 55).
- – Gesetz über die Errichtung von Testamenten und Erbverträgen vom 31.7.1938 (RGBl. I 973). Nach § 48 Abs. 2 war eine Verfügung von Todes wegen nichtig, „soweit sie in einer gesundem Volksempfinden gröblich widersprechenden Weise gegen die Rücksichten verstößt, die ein verantwortungsbewußter Erblasser gegen Familie und Volksgemeinschaft zu nehmen hat.“
- – Die Verordnung zur Regelung der gesetzlichen Erbfolge in besonderen Fällen vom 4.10.1944 (RGBl. I 242) brachte folgende Regelung: „Soweit die gesetzliche Erbregelung offensichtlich von dem Willen des Erblassers zum Nachteil naher Angehöriger in erheblicher Weise abweicht, kann das Nachlaßgericht auf Antrag den Nachlaß diesem Willen gemäß regeln, wenn das gesunde Volksempfinden dies erfordert“ (§ 1 Abs. 1).
- – Verordnung über das Sonderstrafrecht im Kriege und bei besonderem Einsatz vom 17.8.1938/26.8.1939 (RGBl. 1939, I 1455). Bestrafung u. a. der sog. Wehrkraftzersetzung: „Wegen Zersetzung der Wehrkraft wird mit dem Tode bestraft: 1. wer öffentlich dazu auffordert oder anreizt, die Erfüllung der Dienstpflicht in der deutschen oder einer verbündeten Wehrmacht zu verweigern oder sonst öffentlich den Willen des deutschen oder verbündeten Volkes zur wehrhaften Selbstbehauptung zu lähmen und zu zersetzen sucht; 2. wer es unternimmt, einem Soldaten oder Wehrpflichtigen des Beurlaubtenstandes zum Ungehorsam, zur Widersetzung oder zur Tätlichkeit gegen einen Vorgesetzten oder zur Fahnenflucht oder unerlaubten Entfernung zu verleiten oder sonst die Manneszucht in der deutschen oder einer verbündeten Wehrmacht zu untergraben; 3. wer es unternimmt, sich oder einen anderen durch Selbstverstümmelung, durch einen auf Täuschung berechnetes Mittel oder auf eine andere Weise der Erfüllung des Wehrdienstes ganz, teilweise oder zeitweise zu entziehen“ (§ 5 Abs. 1). ← XXXI | XXXII →
- – Novemberpogrome in der Nacht vom 9. auf den 10.11.1938 (sog. Reichskristallnacht). Die Verfolgung der hierbei begangenen Straftaten war der Justiz weitgehend entzogen (vgl. unten S. 93 f., 112 f. und L. Gruchmann, Justiz im Dritten Reich, 3. Aufl. 2001, S. 484 ff.).
- – Verordnungen vom September/Dezember 1939 zum sog. Sonderstrafrecht.
- a) VO über außerordentliche Rundfunkmaßnahmen vom 1.9.1939 (RGBl. I 1683); Strafbarkeit u. a. des Abhörens ausländischer Sender.
- b) Kriegswirtschaftverordnung vom 4.9. 1939 (RGBl. I 1609).
- c) VO gegen Volksschädlinge vom 5.9.1939 (RGBl. I 1679): Strafbarkeit u. a. der Plünderung im frei gemachten Gebiet, der Verbrechen bei Fliegergefahr, von gemeingefährlichen Verbrechen. Ausnutzung des Kriegszustandes als Strafschärfung.
- – Verordnung zum Schutz gegen jugendliche Schwerverbrecher vom 4.10.1939 (RGBl. I 2000). Anwendung von Erwachsenenstrafrecht.
- – Verordnung gegen Gewaltverbrecher vom 5.12.1939 (RGBl. I 2378). Gewalttaten mit der Waffe: „Wer bei einer Notzucht, einem Straßenraub, Bankraub oder einer anderen schweren Gewalttat Schuß-, Hieb- oder Stoßwaffen oder andere gleich gefährliche Mittel anwendet oder mit einer solchen Waffe einen anderen an Leib und Leben bedroht, wird mit dem Tode bestraft.– Ebenso wird der Verbrecher bestraft, der Verfolger mit Waffengewalt angreift oder abwehrt“ (§ 1). Erfordernis des Tätertyps (Werle, S. 295 ff.).
- – Gesetz zur Änderung von Vorschriften des allgemeinen Strafverfahrens, der Wehrmachtstrafverfahren und des Strafgesetzbuchs vom 16.9.1939 (RGBl. I, 1841): Einführung des außerordentlichen Einspruchs gegen rechtskräftige Strafurteile: „Gegen rechtskräftige Urteile in Strafsachen kann der Oberreichsanwalt beim Reichsgericht binnen einem Jahr nach Eintritt der Rechtskraft Einspruch erheben, wenn er wegen schwerwiegender Bedenken gegen die Richtigkeit des Urteils eine neue Verhandlung und Entscheidung in der Sache für notwendig hält“. Aufgrund des Einspruchs hatte ein „besonderer Strafsenat des Reichsgerichts in der Sache von Neuem“ zu entscheiden. ← XXXII | XXXIII →
- – Gesetz über die Mitwirkung des Staatsanwalts in bürgerlichen Rechtssachen vom 15.7.1941 (RGBl. I 383): „In bürgerlichen Rechtssachen der ordentlichen Gerichte ist der Staatsanwalt zur Mitwirkung befugt, um die vom Standpunkt der Volksgemeinschaft im Verfahren bei der Entscheidung zu berücksichtigenden Umstände geltend zu machen“ (§ 1 Abs. 1 S. 1). – Vgl. ferner § 2: „In rechtskräftig entschiedenen bürgerlichen Rechtssachen der ordentlichen Gerichte kann der Oberreichsanwalt beim Reichsgericht binnen eines Jahres nach Eintritt der Rechtskraft die Wiederaufnahme des Verfahrens beantragen, wenn gegen die Richtigkeit der Entscheidung schwerwiegende rechtliche oder tatsächliche Bedenken bestehen und er wegen der besonderen Bedeutung der Entscheidung für die Volksgemeinschaft die erneute Verhandlung und Entscheidung für erforderlich hält“ (§ 2).
- – Gesetz zur Änderung des Reichsstrafgesetzbuchs vom 4.9.1941 (RGBl. I 549). Todesstrafe für gefährliche Gewohnheits- und Sittlichkeitsverbrecher. Neuregelung der Tatbestände des Mordes und des Totschlags (Problem des Tätertypenerfordernisses, Werle, S. 314, 334 ff.).
- – Verordnung über die Strafrechtspflege gegen Polen und Juden in den eingegliederten Ostgebieten vom 4.12.1941 (RGBl. I 759): I: Polen und Juden „werden mit dem Tode bestraft, wenn sie gegen einen Deutschen wegen seiner Zugehörigkeit zum deutschen Volkstum eine Gewalttat begehen“. – „Sie werden mit dem Tode, in minderschweren Fällen mit Freiheitsstrafe bestraft, wenn sie durch gehässige oder hetzerische Betätigung eine deutschfeindliche Gesinnung bekunden, insbesondere deutschfeindliche Äußerungen machen oder öffentliche Anschläge deutscher Behörden oder Dienststellen abreißen oder beschädigen, oder wenn sie durch ihr sonstiges Verhalten das Ansehen oder das Wohl des Deutschen Reiches oder deutschen Volkes herabsetzen oder schädigen.“ – Nach II. sollten Polen und Juden auch bestraft werden, „wenn sie gegen die deutschen Strafgesetze verstoßen oder eine Tat begehen, die gemäß dem Grundgedanken eines deutschen Strafgesetzes nach den in den eingegliederten Ostgebieten ← XXXIII | XXXIV → bestehenden Staatsnotwendigkeiten Strafe verdient“ (II.). Die Aburteilung der Polen und Juden erfolgte vor dem Sondergericht oder dem Amtsrichter. Jedes Urteil war sofort vollstreckbar; jedoch hatte der Staatsanwalt das Recht, gegen Urteile des Amtsrichters Berufung an das OLG einzulegen. – Vgl. bereits die VO vom 6.6.1940 (RGBl. I 844) zur Einführung des Reichsstrafrechts und dessen „sinngemäße“ Anwendung.
- – Erlaß des Führers über die Vereinfachung der Rechtspflege vom 21.3.1942 (RGBl. I 139; unten S. 273 f. abgedruckt).
- – Beschluß des Großdeutschen Reichstags vom 26.4.1942 (RGBl. I 247): „Es kann keinem Zweifel unterliegen, dass der Führer … als oberster Gerichtsherr und als Führer der Partei jederzeit in der Lage sein muß, nötigenfalls jeden Deutschen – sei er einfacher Soldat oder Offizier, niedriger oder hoher Beamter oder Richter, leitender oder dienender Funktionär der Partei, Arbeiter oder Angestellter – … im besonderen ohne Einleitung vorgeschriebener Verfahren aus seinem Amte, aus seinem Rang oder seiner Stellung zu entfernen“.
- – Erlaß des Führers über besondere Vollmachten des Reichsministers der Justiz vom 20.8.1942 (RGBl. I 535): „Zur Erfüllung der Aufgaben des Großdeutschen Reiches ist eine starke Rechtspflege erforderlich. Ich beauftrage und ermächtige daher den Reichsminister der Justiz, nach meinen Richtlinien und Weisungen im Einvernehmen mit dem Reichsminister und Chef der Reichskanzlei und dem Leiter der Partei-Kanzlei eine nationalsozialistische Rechtspflege aufzubauen und alle dafür erforderlichen Maßnahmen zu treffen. Er kann hierbei vom bestehenden Recht abweichen.“
- – 1942–1944: Auf den Tagungen im RJM wurden die Arbeiten der folgenden Ausschüsse der Akademie für Deutsches Recht und von „Ämtern“ des RJM zur Rechtsreform wiederholt angesprochen: a) Sonderausschuß für Wahrheitsforschung in der ADR (1943), – Rechtsprechung durch das Volk (Akademieausschuß und Amt des RJM), Richter und Rechtspfleger (Amt des RJM), Neuordnung der deutschen Gerichtsverfassung (Amt des RJM). (Protokolle der Ausschüsse der ADR und der „Ämter des RJM“ bei W. Schubert, ← XXXIV | XXXV → Akademie für deutsches Recht, Protokolle, Bd. VI, 1997, S. 373 ff., 527 ff., 557 ff., 648 ff., 671 ff., 723 ff., 735 ff.).
- – Verordnung zur Angleichung des Strafrechts des Altreichs und der Alpen- und Donau-Reichsgaue (Strafrechtsangleichungsverordnung) vom 29.5.1943 (RGBl. I 339; vgl. hierzu Werle, S. 426 ff.). Änderungen im Allg. Teil des StGB im Sinne des Willensstrafrechts. Bestrafung der uneidlichen Falschaussage (§ 453 ff.). Zum Willensstrafrecht aus der Begründung zum StGB-Entwurf von 1936: „Die neue Weltanschauung stellt höchste Anforderungen an den Willen des Einzelnen in seinem Verhältnis zur Gemeinschaft. Sie erblickt deshalb in dem betätigten bösen Willen den eigentlichen Friedensstörer, den Feind, der mit den Waffen des Strafrechts zu bekämpfen ist. Der Entwurf will deshalb das künftige Strafrecht zu einem kämpferischen Recht, zu einem Willensstrafrecht ausgestalten“(zitiert nach J. Regge/W. Schubert, Quellen zur Reform des Straf- und Strafprozeßrechts, II. Abt., I 2, Berlin 1990, S. 4).
- – Neufassung des Reichsjugendgerichtsgesetzes vom 6.11.1943 (RGBl. I 635, 637). Unterscheidung zwischen Jugendstrafe (u. a. Gefängnisstrafe von unbestimmter Dauer), Zuchtmitteln (Jugendarrest, bereits seit 1940, Auferlegung von Pflichten, Verwarnung) und Erziehungsmaßregeln (Weisungen, Schutzaufsicht, Fürsorgeerziehung). Vorrangig Erziehung vor der Strafe. – Zum nationalsozialistischen Gehalt des JGG von 1943 Werle, S. 456 ff. und Jörg Wolff, Jugendliche vor Gericht im Dritten Reich. Nationalsozialistische Jugendstrafrechtspolitik und Justizalltag, München 1992.
- – Projekt (Entwürfe) zu einem Gesetz über die Behandlung Gemeinschaftsfremder (letzte Fassung vom 17.3.1944: Entwurf zu einer Neufassung des Allgemeinen Teils des StGB vom 29.6.1944, in den das Gemeinschaftsfremdengesetz eingearbeitet wurde). Nach dem Entwurf zu einem Gemeinschaftsfremdengesetz war gemeinschaftsfremd (§ 1): „1. Wer sich nach Persönlichkeit und Lebensführung, insbesondere wegen außergewöhnlicher Mängel des Verstandes oder des Charakters außerstande zeigt, aus eigener Kraft den Mindestanforderungen der Volksgemeinschaft zu ← XXXV | XXXVI → genügen – 2. wer a) aus Arbeitsscheu oder Liederlichkeit ein nichtsnutzes, unwirtschaftliches oder ungeordnetes Leben führt und dadurch andere oder die Allgemeinheit belastet oder gefährdet oder einen Hang oder eine Neigung zum Betteln oder Landstreichen, zu Arbeitsbummelei, Diebereien, Betrügereien und anderen nicht ernsten Straftaten oder Ausschreitungen in der Trunkenheit betätigt oder aus solchen Gründen bereits Pflichten gröblich verletzt oder b) aus Unverträglichkeit oder Streitlust den Frieden der Allgemeinheit hartnäckig stört, oder 3. wer nach seiner Persönlichkeit und Lebensführung erkennen läßt, dass seine Sinnesart auf Begehung von ernsten Straftaten gerichtet ist (gemeinschaftsfeindlicher Verbrecher und Neigungsverbrecher)“. Die Überwachung der Gemeinschaftsfremden sollte durch die Polizei erfolgen. Über Maßnahmen, die gegen Gemeinschaftsfremde wegen strafbarer Handlungen erforderlich waren, sollten Gerichte entscheiden; daneben sollten „polizeiliche Überwachungsmaßnahmen“ zulässig sein (Werle, 621 ff., W. Schubert, Akademie für Deutsches Recht, Bd. VIII, Frankfurt a.M. 1999, S. 298 ff.; Sarah Schädler, „Justizkrise“ und „Justizreform“ im Nationalsozialismus. Das RJM unter Reichsjustizminister Thierack (1942–1945, Tübingen 2009, S. 280 ff.).
- – 1939, September – 1944, September: Vereinfachungsverordnungen und Kriegsmaßnahmenverordnungen für den Zivilprozeß und die Gerichtsverfassung: RGBl. I 1939 658; 1940, 1253, 1942, 333, 1943, 7, 290, 1944, 229.
- – 1939, September – 1944: Vereinfachungs- und Kriegmaßnahmenverordnungen für den Strafprozeß und die Strafgerichtsverfassung: RGBl. I 1939, 1659, 1940, 405 (Zuständigkeitsverordnung, 1942, 508, 512, 1943, 342, 346 und 1944, 339.) ← XXXVI| XXXVII →
IV. Die Chefpräsidenten, Generalstaatsanwälte und Oberstaatsanwälte (1933–1945)20
1. Oberlandesgerichtspräsidenten
Kammergericht (Berlin): Dr. Eduard Tigges (1922–1933), Heinrich Hölscher (1933–1943), Dr. Johannes Block (1943–1945).
Bamberg: Hans Aull (1932–1933), Albert Heuwieser (1933–1938), unbesetzt (1938–1939) (Vertreter: Vizepräsident Otto Stammler), Dr. Enst Dürig (1939–1944).
Braunschweig: Dr. Willy Röpcke (1930–1933), Dr. Bruno Heusinger (1933–1934), Günther Nebelung (1935–1944), Richard Kuhlenkamp (1944–1945).
Breslau: Max Witte (1927–1933), Dr. August Herwegen (1933–1935), Walther Frhr. von Steinaecker (1936–1942), Dr. Friedrich Jung (1943–1945).
Celle: Adolf von Garßen (1932–1945).
Danzig: Walter Wohler (1939–1945) (seit 1937 Präsident des Obergerichts Danzig).
Darmstadt: Dr. Adolf Müller (1931–1935), Dr. Wilhelm Stuckart (1935), Dr. Ludwig Scriba (1936–1945).
Dresden: Dr. Alfred Hüttner (1931–1939), Rudolf Beyer (1939–1945).
Düsseldorf: Dr. Franz Schollen (1922–1933), Wilhelm Schwister (1933–1943), Paul Windhausen (1943–1945).
Frankfurt a.M.: Dr. Bernhard Hempen (1930–1933), Otto Stadelmann (1933–1939), Artur Ungewitter (1939–1945).
Graz: Dr. Fritz Meldt (1938–1945). ← XXXVII | XXXVIII →
Hamburg: Dr. Wilhelm Kiesselbach (1928–1933), Dr. Arnold Engel (1933–1935), Dr. Curt Rothenberger (1935–1942), Dr. Albert Georg Heinrich Schmid-Eyk (1943).
Hamm: Rudolf Schneider (1933–1943), Hans Semler (1943–1945).
Innsbruck: Dr. Hermann Greinz (1938; Kommisarischer Leiter), Dr. Oskar Stritzl (1939–1945).
Jena: Bruno Becker (1925–1945).
Karlsruhe: Dr. Karl Buzengeiger (1930–1937), Heinrich Reinle (1937–1945).
Kassel: Dr. Heinrich Anz (1925–1933), Dr. Kurt Delitzsch (1933–1945).
Kattowitz: Dr. Johannes Block (1941–1943), Karl Drendel (1943–1945).
Kiel: Dr. Gottfried Kuhnt (1928–1933), Dr. Karl Martin (1933–1943), Johannes Hastert (1943–1945).
Köln: Dr. Max Josef Vollmer (1932–1933), Dr. Alexander Bergmann (1933–1943), Dr. Erich Ludwig Heinrich Lawall (1943).
Königsberg: Walter Moehrs (1932–1933), Hugo Minde (1933–1934), Otto Hardt (1934–1937), Dr. Max Draeger (1937–1945).
Leitmeritz: Dr. Herbert David (1939–1944), Dr. E. Dürig (Vertretg. 1944/45).
Linz: Dr. Edmund Krautmann (1939–1943), Dr. Leo Sturma (1944/45).
Marienwerder: Dr. Arthur Ehrhardt (1923–1933), Dr. Max Karge (1933–1936), Dr. Max Draeger (1937), Fritz Szelinski (1937–1943).
München: Dr. Alexander Gerber (1931–1933), Georg Neithardt (1933–1937), Dr. Alfred Dürr (1937–1943), Dr. Walther Stepp (1943).
Naumburg: Georg Werner (1923–1933), Dr. Paul Sattelmacher (1933–1945).
Nürnberg: Friedrch Burkhardt (1933), Otto Bertram (1933–1937), Friedrich August Döbig (1937–1943), Dr. Ernst Emmert (1943–1945). ← XXXVIII | XXXIX →
Oldenburg: Dr. Eduard Högl (1931–1939), Dr. Kurt Reuthe (1939–1945).
Posen: Hellmut Froböß (1940–1945).
Prag: Fritz Bürkle (1939–1945).
Rostock: Heinrich Burmeister (1930–1935), Rudolf Goetsch (1935–1943), Hans-Hermann Zastrow (1943).
Stettin: Dr. Paul Cormann (1920–1933), Richard Kulenkamp (1933–1944), Richard Köhler (1944).
Stuttgart: Dr. Eugen Schmoller (1926–1933), Erwin Heß (1933–1935), Dr. Otto Küstner (1935–1945).
Wien: Dr. Friedrich Schober (Kommissarischer Leiter 1938–1943), Dr. Gustav Adalbert Tamele (1943).
Zweibrücken: Friedrich Becker (1927–1933), Dr. Karl Siegel (1933–1945).
2. Generalstaatsanwälte
Kammergericht (Berlin): Dr. Carl Wiechmann (1931–1933), Dr. Ernst Gutjahr (1933), Dr. Friedrich Jung (1933–1942), Dr. Hanssen (1943).
Bamberg: Nikolaus Döll (1925–1934) (bis 1931 mit dem Titel Oberstaatsanwalt), Otto Kahl (1934–1944), Steuer (1944–1945).
Braunschweig: Paul Koch (1932–1933), Heinrich Müller (1933–1941), Wilhelm Hirte (Vertretg. 1941–1942), Willy Rahmel (1942–1943), Werner Meißner (1944–1945).
Breslau: Dr. Walter Schaeffer (1933–1935), Dr. Reinhold Sturm (1935–1945).
Celle: Georg Bach (1931–1933), Friedrich Parey (1933–1937), Karl Schnoering (1937–1945).
Danzig: Curt Graßmann (1939–1941), Dr. Bode (1942).
Darmstadt: Fritz Hoos (1928–1933), Dr. Gerhard Eckert (1933–1945).
Dresden: Rudolf Schlegel (1927–1933), Dr. Alfred Weber (1933–1935), Dr. Heinrich Jung (1936–1945). ← XXXIX| XL →
Düsseldorf: Bernhard Wichmann (1932–1933), Karl Schnoering (1934–1937), Franz Hagemann (1937–1945).
Frankfurt a.M.: Dr. Kurt Wackermann (1932–1944). Hermann Vetter (1944).
Graz: Dr. Johannes Meißner (1939–1945).
Hamburg: Dr. Franz Lang (1921–1933), Dr. Erich Drescher (1933–1943, Hans Kaak (1944).
Hamm: Wilhelm Homann (1923–1933), Walther Frhr. von Steinaecker (1933–1935). Hans Semler (1936–1943), Dr. Hans Joël (1943).
Innsbruck: Dr. Johann Moser (1939–1941), Dr. Rudolf Löderer (1941), Dr. Anton Köllinger (1942).
Details
- Pages
- L, 642
- Publication Year
- 2015
- ISBN (Hardcover)
- 9783631643914
- ISBN (PDF)
- 9783653034899
- ISBN (MOBI)
- 9783653995497
- ISBN (ePUB)
- 9783653995503
- DOI
- 10.3726/978-3-653-03489-9
- Language
- German
- Publication date
- 2015 (May)
- Keywords
- Justizverwaltung Strafrechtspflege NS-Justiz Roland Freisler
- Published
- Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2015. L, 642 S.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG