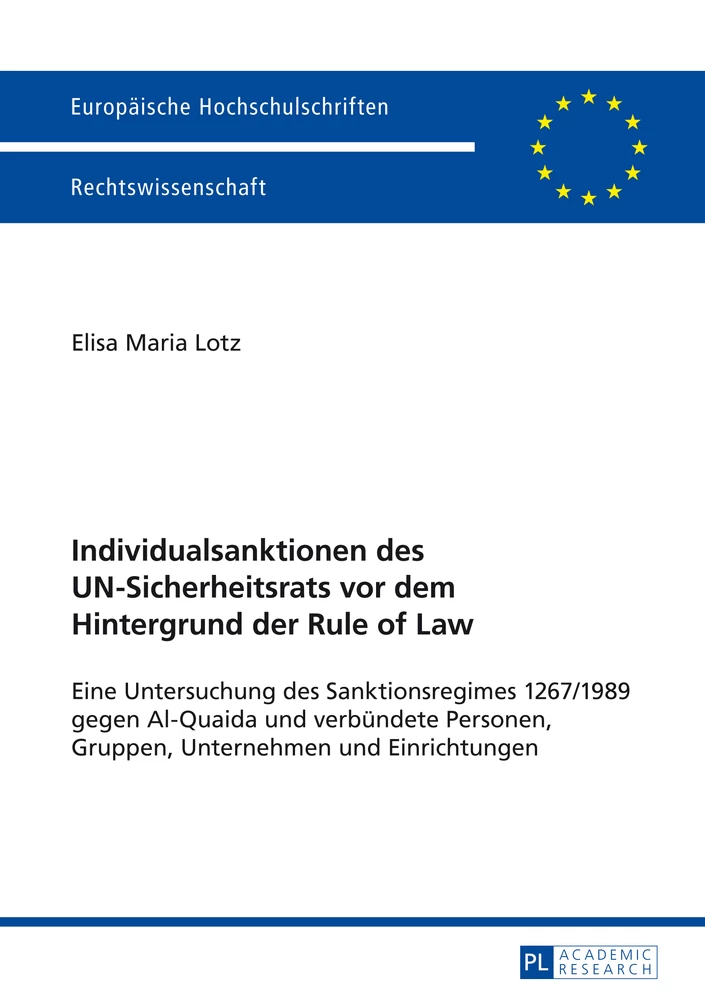Individualsanktionen des UN-Sicherheitsrats vor dem Hintergrund der Rule of Law
Eine Untersuchung des Sanktionsregimes 1267/1989 gegen Al-Quaida und verbündete Personen, Gruppen, Unternehmen und Einrichtungen
Summary
Excerpt
Table Of Contents
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Vorwort
- Inhaltsübersicht
- Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- A. Einleitung
- I. Einführung
- II. Gegenstand und Gang der Untersuchung
- B. Überblick: Das Sanktionsregime 1989
- I. Resolution 1267, 1333 und 1390: von Afghanistan zur Bekämpfung des internationalen Terrorismus
- II. Resolution 1452, 1455, 1526 und 1617: humanitäre Ausnahmen und Verfahrensverbesserungen
- III. Resolution 1730, 1735 und 1822: Focal Point, Aktualisierung der Listen und „narrative summaries“
- IV. Resolution 1904: eine neue Ära des Rechtsschutzes durch den Ombudsmann?
- V. Resolution 1989: Trennung der Sanktionsregime und Stärkung des Ombudsmanns
- VI. Zusammenfassung
- C. Die Rule of Law – eine Annäherung
- I. Bekenntnisse zur Rule of Law
- 1. Erklärung zur Rule of Law A/67/1
- 2. Bewertung und Einordnung der Erklärung A/67/1
- 3. Aufgeworfene Fragestellungen
- II. Inhaltliche Annäherung
- 1. Rechtsbindung
- a) Debatte im Rechtsausschuss der Generalversammlung
- aa) International und national
- bb) Vereinte Nationen und Sicherheitsrat
- b) Einordnung der Debatte
- c) Bedeutung für die Sanktionspraxis
- 2. Rechtsanwendung
- a) Debatte im Rechtsausschuss der Generalversammlung
- b) Einordnung der Debatte
- aa) Gleichheit vor dem Recht
- bb) Auslegungsregeln
- cc) Treu und Glauben
- dd) Zwischenergebnis
- c) Bedeutung für die Sanktionspraxis
- 3. Rechtsschutz und Rechtskontrolle
- a) Debatte im Rechtsausschuss der Generalversammlung
- aa) Internationale Streitbeilegung
- bb) Rechtsdurchsetzung für und gegen natürliche Personen
- (1) Internationales Strafrecht
- (2) Sanktionsregime des Sicherheitsrats
- (3) Nationale Rechtssysteme
- b) Debatte im Sicherheitsrat
- c) Einordnung der Debatten
- aa) Klassische Völkerrechtssubjekte
- bb) Öffentliche Gewalt – Individuum
- d) Bedeutung für die Sanktionspraxis
- 4. Materielle Elemente einer Rule of Law
- a) Debatte im Rechtsausschuss der Generalversammlung
- aa) Funktionales Verständnis
- bb) Rechtliche Inhalte
- cc) Demokratie
- b) Einordnung der Debatte
- aa) Formelle Definitionen
- bb) Materielle Definitionen
- (1) Wertungen und Prinzipien im Völkerrecht
- (2) Bewertung im Lichte der Generalversammlung
- c) Bedeutung für die Sanktionspraxis
- 5. Internationale und nationale Rule of Law
- a) Debatte im Rechtsausschuss der Generalversammlung
- b) Einordnung der Debatte
- c) Bedeutung für die Sanktionspraxis
- 6. Nutzen der Rule of Law
- a) Debatte im Rechtsausschuss der Generalversammlung
- b) Einordnung der Debatte
- c) Bedeutung für die Sanktionspraxis
- III. Ergebnisse und Gang der weiteren Untersuchung
- D. Die Sanktionspraxis vor dem Hintergrund der Rule of Law
- I. Voraussetzung der Rule of Law: Rechtsbindung des Sicherheitsrats
- 1. Grundsätze: Quellen und Grenzen der Rechtsbindung
- a) Quellen der Rechtsbindung
- aa) Allgemeine Rechtsgrundsätze
- bb) Allgemeines Völkergewohnheitsrecht
- (1) Originäre Bindung
- (2) Abgeleitete Bindung
- (3) Stellungnahme
- (a) Gekorene und originäre Völkerrechtssubjekte
- (b) Sonderfall Vereinte Nationen?
- (c) nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse habet?
- (4) Zwischenergebnis
- cc) Völkerrechtliche Verträge der Mitgliedsstaaten
- (1) Nachfolgemodelle
- (a) Rechtsprechung europäischer Gerichte
- (b) Anwendbarkeit auf die Vereinten Nationen
- (2) Durchgriffs- und Gewährleistungsmodelle
- dd) Gründungsstatut
- ee) Zwischenergebnis
- b) Grenzen der Rechtsbindung
- aa) Objektive Auslegung
- bb) Dynamisch-evolutive Auslegung
- cc) Effektivitätsgrundsatz
- dd) Grenzen der Auslegung
- (1) Autorität zur Auslegung und Änderung
- (a) Sicherheitsrat oder Mitgliedstaaten?
- (b) Stellungnahme
- (2) Zwischenergebnis
- 2. Sanktionspraxis: Ermächtigungsgrundlage und rechtliche Grenzen
- a) Eröffnung der Handlungskompetenz nach Art. 39 ff. UNCh
- aa) Kompetenzregeln
- bb) Art. 39 UNCh und der internationale Terrorismus
- b) Rechtsfolge: Ermessen und seine Grenzen
- aa) Art. 24 Abs. 2 UNCh: Ziele und Grundsätze
- (1) Welche Ziele und Grundsätze?
- (2) Ziele und Grundsätze als rechtliche Prinzipien
- bb) Individualsanktionen und betroffene Prinzipien
- (1) Art. 1 Abs. 3 UN-Charta: Auslegung
- (a) Art. 31 Abs. 2 Hs. 1 WVK
- (b) Art. 31 Abs. 3 lit. c) WVK
- (aa) Generierung allgemeiner Rechtsgrundsätze: europäische Rechtsprechung
- (bb) Menschenrechte des allgemeinen Völkerrechts
- (c) Förderungs- und Beachtungspflicht der Menschenrechte
- (d) Zwischenergebnis
- (2) Treu und Glauben und estoppel
- (aa) Bekenntnisse zu den Menschenrechten im Rahmen der Terrorismusbekämpfung
- (bb) Straftribunale
- (cc) Territorialverwaltungen
- (dd) Zwischenergebnis
- (3) Betroffene Menschenrechte der Sanktionspraxis
- (a) Recht auf Eigentum
- (aa) Sachlicher Schutzbereich
- (bb) Persönlicher Schutzbereich
- (cc) Enteignungsbegriff
- (dd) Sonstige Eingriffe in das Eigentum
- (b) Recht auf Freizügigkeit
- (c) Recht auf Schutz der Familie
- (d) Recht auf Schutz der Ehre und des Rufes
- (e) Verfahrensrechte: Überblick
- (4) Individualsanktionen und ausgleichende Normen
- (a) Geeignetheit und Erforderlichkeit innerhalb von Kapitel VII
- (b) Verhältnismäßigkeit innerhalb von Art. 41 UNCh
- (aa) Pauschaler Vorrang der Friedenssicherung
- (bb) Gleichrangigkeit der Ziele und Grundsätze
- (cc) Stellungnahme
- (c) Sanktionspraxis: Verhältnismäßigkeit der Menschenrechtsbeschränkungen
- II. Rechtsanwendung: rechtliche Maßstäbe
- 1. Grundsatz: Sachverhaltsermittlung nach Treu und Glauben
- a) Umfassende Freiheit bei Einschätzung der Faktenlage
- b) Kenntnis und Überprüfbarkeit der Faktenlage
- c) Diskussion
- aa) Systematik der Charta und Organpraxis
- bb) Staatliche Analogien
- cc) Dringlichkeit als Sonderfall von Kapitel VII
- d) Zwischenergebnis: fließendes Modell zur Sachverhaltskenntnis und -prüfung
- 2. Sanktionspraxis: Sachverhaltsermittlung bei Listing- und De-Listing-Verfahren
- a) Listing
- b) Verbleib auf den Listen
- c) De-Listing
- III. Rechtsschutz und Rechtskontrolle
- 1. Rechtsschutz und Rechtskontrolle bei Listing und De-Listing
- a) Quellen und Arten von Verfahrensgarantien
- b) Eingriffsvoraussetzungen und administrative Verfahrensanforderungen
- aa) Positive Handlungspflichten aus Individualrechten
- bb) Herleitung der Verfahrensrechte
- cc) Inhalt der Eingriffs- und Verfahrensanforderungen
- (1) Anforderungen an die Eingriffsgrundlage
- (a) Grundsätze
- (b) Sanktionspraxis
- (2) Begründung des Eingriffs
- (a) Grundsätze
- (b) Sanktionspraxis
- (3) Rechtsschutzverfahren vor einer unabhängigen Stelle
- (a) Grundsätze
- (b) Sanktionspraxis
- (aa) Unabhängigkeit und Unparteilichkeit
- (bb) Effektivität des Rechtsbehelfs
- (i) Kompetenz zur Beendigung der Eingriffsmaßnahme
- (ii) Tatsachenbasis für die Prüfung
- (iii) Verfahrensdauer
- (4) Gewährung von Gehör
- (a) Grundsätze
- (b) Sanktionspraxis
- (5) Zwischenergebnis
- c) Verfahrensanforderungen des gerichtlichen Rechtsschutzes
- aa) Strafrechtliche oder gefahrenabwehrrechtliche Maßnahmen
- bb) Anwendbarkeit des gerichtlichen Rechtsschutzes
- cc) Grundsätze des Fair Trial
- (1) Sanktionspraxis
- (2) Rechtfertigung
- dd) Rechtliches, öffentliches Gehör
- (1) Sanktionspraxis
- (2) Rechtfertigung
- ee) Effektiver Rechtsschutz durch unabhängiges, unparteiliches Gericht
- (1) Sanktionspraxis
- (a) Überprüfungsumfang
- (b) Verbindliche Entscheidungskompetenz
- (2) Rechtfertigung
- (a) Geeignetheit und Erforderlichkeit der Beschränkungen
- (b) Angemessenheit der Beschränkungen
- (aa) Entscheidungsmodus und -verfahren bei De-Listing
- (bb) Pflicht zur Einrichtung eines Gerichts mit umfassender Entscheidungskompetenz?
- ff) Reaktionen der Staatengemeinschaft
- d) Zwischenergebnis
- 2. Rechtsschutz und Rechtskontrolle außerhalb des De-Listing-Verfahrens
- a) Rechtmäßigkeit und Rechtsverbindlichkeit von Entscheidungen
- aa) Schwere und Offensichtlichkeit des Verstoßes
- bb) Rechtsfolgenlösung: Anfechtbarkeit
- cc) Rechtmäßigkeitsvermutungen
- dd) Stellungnahme: Rechtmäßigkeit als Problem der Feststellungsbefugnis
- b) Feststellungsbefugnis der Nichtigkeit von Entscheidungen des Sicherheitsrats
- aa) Sicherheitsrat
- bb) IGH
- (1) Problemkreise: Überblick
- (2) Stand der Rechtsprechung
- (a) Überprüfungszuständigkeit
- (b) Überprüfungsumfang
- (3) Rechtskontrolle von Sanktionsentscheidungen
- cc) Mitgliedstaaten
- (1) Willkür, Missbrauch, Verfahrensfehler
- (2) Einfache Rechtsverstöße
- (3) Sanktionspraxis
- (a) Boykott des Sanktionsregimes insgesamt
- (b) Aufhebung von einzelnen Sanktionen gegen Personen
- dd) Generalversammlung
- (1) Rechtskontrolle durch die Generalversammlung im Namen der Staatengemeinschaft?
- (2) Sanktionspraxis
- IV. Ergebnisse
- V. Schluss
- E. Literaturverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
II. Gegenstand und Gang der Untersuchung
B. Überblick: Das Sanktionsregime 1989
I. Resolution 1267, 1333 und 1390: von Afghanistan zur Bekämpfung des internationalen Terrorismus
II. Resolution 1452, 1455, 1526 und 1617: humanitäre Ausnahmen und Verfahrensverbesserungen
IV. Resolution 1904: eine neue Ära des Rechtsschutzes durch den Ombudsmann?
V. Resolution 1989: Trennung der Sanktionsregime und Stärkung des Ombudsmanns
C. Die Rule of Law – eine Annäherung
I. Bekenntnisse zur Rule of Law
1. Erklärung zur Rule of Law A/67/1
2. Bewertung und Einordnung der Erklärung A/67/1
3. Aufgeworfene Fragestellungen
a) Debatte im Rechtsausschuss der Generalversammlung
aa) International und national
bb) Vereinte Nationen und Sicherheitsrat
c) Bedeutung für die Sanktionspraxis
a) Debatte im Rechtsausschuss der Generalversammlung
c) Bedeutung für die Sanktionspraxis
3. Rechtsschutz und Rechtskontrolle
a) Debatte im Rechtsausschuss der Generalversammlung
aa) Internationale Streitbeilegung
bb) Rechtsdurchsetzung für und gegen natürliche Personen
(1) Internationales Strafrecht
(2) Sanktionsregime des Sicherheitsrats
aa) Klassische Völkerrechtssubjekte
bb) Öffentliche Gewalt – Individuum
d) Bedeutung für die Sanktionspraxis
4. Materielle Elemente einer Rule of Law
a) Debatte im Rechtsausschuss der Generalversammlung
(1) Wertungen und Prinzipien im Völkerrecht
(2) Bewertung im Lichte der Generalversammlung
c) Bedeutung für die Sanktionspraxis
5. Internationale und nationale Rule of Law
a) Debatte im Rechtsausschuss der Generalversammlung
c) Bedeutung für die Sanktionspraxis
a) Debatte im Rechtsausschuss der Generalversammlung
c) Bedeutung für die Sanktionspraxis
III. Ergebnisse und Gang der weiteren Untersuchung
D. Die Sanktionspraxis vor dem Hintergrund der Rule of Law
I. Voraussetzung der Rule of Law: Rechtsbindung des Sicherheitsrats
1. Grundsätze: Quellen und Grenzen der Rechtsbindung
aa) Allgemeine Rechtsgrundsätze
bb) Allgemeines Völkergewohnheitsrecht
(a) Gekorene und originäre Völkerrechtssubjekte
(b) Sonderfall Vereinte Nationen?
(c) nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse habet?
cc) Völkerrechtliche Verträge der Mitgliedsstaaten
(a) Rechtsprechung europäischer Gerichte
(b) Anwendbarkeit auf die Vereinten Nationen
(2) Durchgriffs- und Gewährleistungsmodelle
bb) Dynamisch-evolutive Auslegung
(1) Autorität zur Auslegung und Änderung
(a) Sicherheitsrat oder Mitgliedstaaten?
2. Sanktionspraxis: Ermächtigungsgrundlage und rechtliche Grenzen
a) Eröffnung der Handlungskompetenz nach Art. 39 ff. UNCh
bb) Art. 39 UNCh und der internationale Terrorismus
b) Rechtsfolge: Ermessen und seine Grenzen
aa) Art. 24 Abs. 2 UNCh: Ziele und Grundsätze
(1) Welche Ziele und Grundsätze?
(2) Ziele und Grundsätze als rechtliche Prinzipien
bb) Individualsanktionen und betroffene Prinzipien
(1) Art. 1 Abs. 3 UN-Charta: Auslegung
(b) Art. 31 Abs. 3 lit. c) WVK
(aa) Generierung allgemeiner Rechtsgrundsätze: europäische Rechtsprechung
(bb) Menschenrechte des allgemeinen Völkerrechts
(c) Förderungs- und Beachtungspflicht der Menschenrechte
(2) Treu und Glauben und estoppel
(aa) Bekenntnisse zu den Menschenrechten im Rahmen der Terrorismusbekämpfung
(3) Betroffene Menschenrechte der Sanktionspraxis
(bb) Persönlicher Schutzbereich
(dd) Sonstige Eingriffe in das Eigentum
(c) Recht auf Schutz der Familie
(d) Recht auf Schutz der Ehre und des Rufes
(e) Verfahrensrechte: Überblick
(4) Individualsanktionen und ausgleichende Normen
(a) Geeignetheit und Erforderlichkeit innerhalb von Kapitel VII
(b) Verhältnismäßigkeit innerhalb von Art. 41 UNCh
(aa) Pauschaler Vorrang der Friedenssicherung
(bb) Gleichrangigkeit der Ziele und Grundsätze
(c) Sanktionspraxis: Verhältnismäßigkeit der Menschenrechtsbeschränkungen
II. Rechtsanwendung: rechtliche Maßstäbe
1. Grundsatz: Sachverhaltsermittlung nach Treu und Glauben
a) Umfassende Freiheit bei Einschätzung der Faktenlage
b) Kenntnis und Überprüfbarkeit der Faktenlage
aa) Systematik der Charta und Organpraxis
cc) Dringlichkeit als Sonderfall von Kapitel VII
d) Zwischenergebnis: fließendes Modell zur Sachverhaltskenntnis und -prüfung
2. Sanktionspraxis: Sachverhaltsermittlung bei Listing- und De-Listing-Verfahren
Details
- Pages
- XXIV, 398
- Publication Year
- 2014
- ISBN (Softcover)
- 9783631645734
- ISBN (PDF)
- 9783653037760
- ISBN (MOBI)
- 9783653994568
- ISBN (ePUB)
- 9783653994575
- DOI
- 10.3726/978-3-653-03776-0
- Language
- German
- Publication date
- 2014 (May)
- Keywords
- Sanktionen smart sanctions Terrorismus Menschenrechte Sicherheitsrat
- Published
- Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2014. XXIV, 398 S.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG