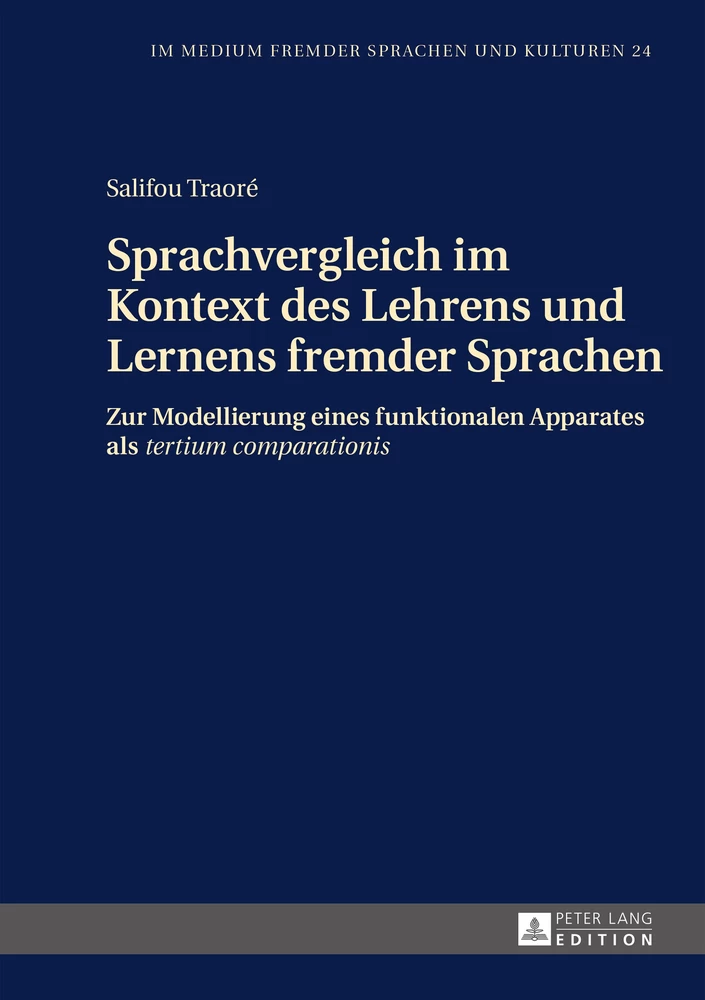Sprachvergleich im Kontext des Lehrens und Lernens fremder Sprachen
Zur Modellierung eines funktionalen Apparates als «tertium comparationis»
Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Vorwort
- Inhalt
- Abbildungs- und Tabellenverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Forschungsgegenstand und Zielsetzung
- 1.2 Aufbau der Arbeit
- 2 Wissenschaftsgeschichtlicher Überblick über den Sprachvergleich in der Linguistik
- 2.1 Vorbemerkungen
- 2.2 Die historisch-vergleichende Sprachwissenschaft
- 2.3 Der sprachtypologische Vergleich
- 2.4 Das „vergleichende Sprachstudium“ Wilhelm von Humboldts
- 2.5 Die Areallinguistik
- 2.6 Die kontrastive Linguistik
- 2.7 Zwischenbilanz
- 3 Sprachvergleich im Dienste des Fremdsprachenerwerbs
- 3.1 Die vortheoretischen Anfänge
- 3.2 Der kontrastive Sprachvergleich als Paradigmenwechsel im Fremdsprachenunterricht
- 3.2.1 Die Grundlagen der kontrastiven Linguistik im Fremdsprachenunterricht
- 3.2.1.1 Lernpsychologische Grundlagen
- 3.2.1.2 Sprachtheoretische Grundlagen
- 3.2.2 Kontrastivhypothese: Die Genese der kontrastiven Linguistik im Fremdsprachenunterricht
- 3.2.3 Die kontrastive Methode und die Grundfrage des tertium comparationis
- 3.3 Zwischenbilanz
- 4 Funktion als sprachwissenschaftliches Forschungsthema
- 4.1 Zum Begriff „Funktion“ in Grammatik und Sprachwissenschaft
- 4.2 Die Heterogenität der funktionalen Forschungsansätze
- 4.2.1 Das Bühlersche Organon-Modell
- 4.2.2 Die funktionale Satzperspektive
- 4.2.3 Die funktional-kommunikative Sprachbeschreibung der DDRLinguistik
- 4.2.4 Die funktionale Pragmatik
- 4.2.5 Die funktionale Grammatik von Simon Dik
- 4.2.6 Die funktionale Grammatik von Klaus Welke
- 4.3 Zwischenbilanz
- 5 Der funktionale Apparat als tertium comparationis im fremdsprachenerwerbsbezogenen Sprachvergleich: Begriffliche Abgrenzung, Modellskizze und Methode
- 5.1 Vorbemerkung
- 5.2 Der Funktionale Apparat
- 5.2.1 Funktion und funktionale Kategorien
- 5.2.2 Sprache, Sprachstruktur, Sprachsystem, Sprachnorm
- 5.2.3 Sprache als Weltansicht
- 5.2.4 Zusammenfassung
- 5.3 Methodischer Zugang
- 5.4 Zwischenbilanz
- 6 Analysebeispiel: Die funktionale Kategorie „Höflichkeit“ im Deutschen und im Thailändischen
- 6.1 Übereinzelsprachliche Verortung von Höflichkeit
- 6.2 Die sprachliche Realisierung der Höflichkeit im Deutschen und im Thailändischen
- 6.2.1 Grundsätzliche typologische Anmerkungen
- 6.2.2 Ausdrucksmittel der Höflichkeit im Deutschen
- 6.2.2.1 Konjunktiv II
- 6.2.2.2 Modalverben
- 1. dürfen
- 2. können
- 3. mögen
- 4. wollen
- 6.2.2.3 Modalpartikeln
- 6.2.2.4 Die Personalpronomina und die pronominale Referenz im Deutschen
- 1. du (Singular)/ihr (Plural)
- 2. Sie-Form
- 6.2.2.5 Titel und allgemeine Anredeformen
- 6.2.3 Ausdrucksmittel der Höflichkeit im Thailändischen
- 6.2.3.1 Die lexikalische Substitution als Höflichkeitsform im Thailändischen
- 6.2.3.2 Klassifikatoren
- 1. khon
- 2. thân
- 3. rûup
- 6.2.3.3 Partikeln
- 6.2.3.3.1 Modalpartikeln
- 6.2.3.3.2 Höflichkeitspartikeln
- 6.2.3.4 Die Personalpronomina und die pronominale Referenz im Zusammenspiel mit Titeln und allgemeinen Anredeformen bei der Realisierung der Höflichkeit im Thailändischen
- 6.2.3.4.1 Häufig gebrauchte Pronomina der 1. Person
- 6.2.3.4.2 Häufig gebrauchte Pronomina der 2. Person
- 6.2.3.4.3 Häufig gebrauchte Pronomina der 3. Person
- 6.2.4 Zusammenfassung der Ergebnisse
- 7 Konsequenzen für das Lehren und Lernen fremder Sprachen und Schlussfolgerungen
- 7.1 Funktionaler Apparat, Sprachbewusstsein und Sprachreflexion
- 7.2 Der Funktionale Apparat im Dienste der interkulturellen Kommunikation
- 7.3 Der Funktionale Apparat im Dienste des Grammatikunterrichts
- 7.4 Vorläufige didaktische Überlegungen
- 8 Ausblick
- 9 Literaturverzeichnis
Abbildungs- und Tabellenverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
1Einleitung
1.1 Forschungsgegenstand und Zielsetzung
In der zunehmenden Globalisierung und der daraus resultierenden Intensi-vierung von Interaktionen mit Mitgliedern anderer Sprach- und Kulturgemein-schaften mit ihren Einstellungen und kommunikativen Gewohnheiten, die einzelsprachlichen Normen, Regeln und Wertungen unterworfen sind, steht die Fremdsprachenerwerbsforschung der Herausforderung gegenüber, wie im Fremdsprachenunterricht die Lernenden auf diesen Prozess des Austauschs vor-bereitet werden können. Mit anderen Worten: Wie kann der Fremdsprachen-unterricht ein Wissen generieren, auf das in genuinen kommunikativen Interaktionen zurückgegriffen werden kann? Die Beantwortung dieser und ähnlicher Fragen stellt neue Anforderungen an den Sprachvergleich im Dienste des Fremdsprachenunterrichts, die sich darin äußern, die Zuordnungsmö-glichkeiten zu Formen und Funktionen von L1 und L2 und die damit ver-bundenen Normen und Konventionen im eigenkulturellen Kontext zu eruieren. Auf Grund dieser Überlegungen wird in der vorliegenden Arbeit im Lichte verschiedener funktionaler Forschungsansätze in der Grammatik und Sprach-wissenschaft der Versuch unternommen, einen funktionalen Apparat als tertium comparationis in kontrastiven Sprachvergleichsanalysen im Kontext des Fremdsprachenerwerbs bei homogenen Lernergruppen zu konzipieren, um Unterschiede, Ähnlichkeiten und Gemeinsamkeiten von L1 und L2 in Bezug auf ihre Geeignetheit in der kommunikativen Anwendung in sozialen Interaktionen zu ermitteln und adäquat zu beschreiben. Vor dem Hintergrund der damit verbundenen Möglichkeiten und Grenzen didaktischen Handelns wird anhand der funktionalen Kategorie „Höflichkeit“ im Deutschen und im Thailändischen exemplarisch aufgezeigt, inwieweit sprachfunktionale Analysen den Gebrauch grammatischer Strukturen in geeigneten Kommunikationskontexten zutage bringen. Der Ansatz geht über fremdsprachenerwerbsbezogene kontrastive Untersuchungen traditionellen Zuschnitts hinaus, die darauf ausgerichtet sind, in der Regel formal-strukturelle Aspekte als tertium comparationis zugrunde zu legen und damit eine Sprache auf eine andere abzubilden. Dagegen lässt sich aber einwenden, dass Formen von Einzelsprachen in dem Maße unterschiedlich sind, dass bei einem rein strukturbasierten Vergleich nicht immer garantiert werden kann, dieselbe Form in den beteiligten Sprachen zu finden. Dies bringt Croft, unter Berücksichtigung der ihn beschäftigenden Fragestellungen zum typologischen Sprachvergleich, folgendermaßen zum Ausdruck:
The essential problem is that languages vary in their structure to a great extent; indeed, that is what typology (and more generally, linguistics) aims to study and explain. But the variation in structure makes it difficult if not impossible to use structural criteria, to identify grammatical categories across languages. Although there is some similarity in ← 13 | 14 → structure (“formal” properties) that may be used for cross-linguistics identification of categories, the ultimate solution is a semantic one, or to put it more generally, a func-tional solution (²1993, 11).
Darüber hinaus führen die metasprachlichen Unterschiede zwischen den Einzelsprachen dazu, dass das Einbeziehen von formal-strukturellen Kriterien als Bezugsgröße in kontrastiven Analysen der Ermittlung der kommunikations-kontextuellen Gebrauchsnormen der Vergleichssprachen nicht gerecht wird. Es wird daher in der vorliegenden Arbeit der Frage nachgegangen, wie ein funktionaler Apparat als übereinzelsprachlich invariante Vergleichsgrundlage modelliert werden kann, um im Fremdsprachenerwerbsprozess L1 und L2 in Bezug auf ihre Kommunikationswirklichkeit in entsprechenden Interaktions-kontexten zu vergleichen.
Die Forschungsziele der Arbeit lassen sich aus den folgenden Fragen ableiten:
Details
- Seiten
- 164
- Erscheinungsjahr
- 2014
- ISBN (Hardcover)
- 9783631650301
- ISBN (PDF)
- 9783653039993
- ISBN (MOBI)
- 9783653984620
- ISBN (ePUB)
- 9783653984637
- DOI
- 10.3726/978-3-653-03999-3
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2014 (August)
- Schlagworte
- Spracherwerb funktionale Grammatik funktionale Kategorie kontrastive Linguistik
- Erschienen
- Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2014. 164 S., 13 s/w Abb., 6 Tab.
- Produktsicherheit
- Peter Lang Group AG