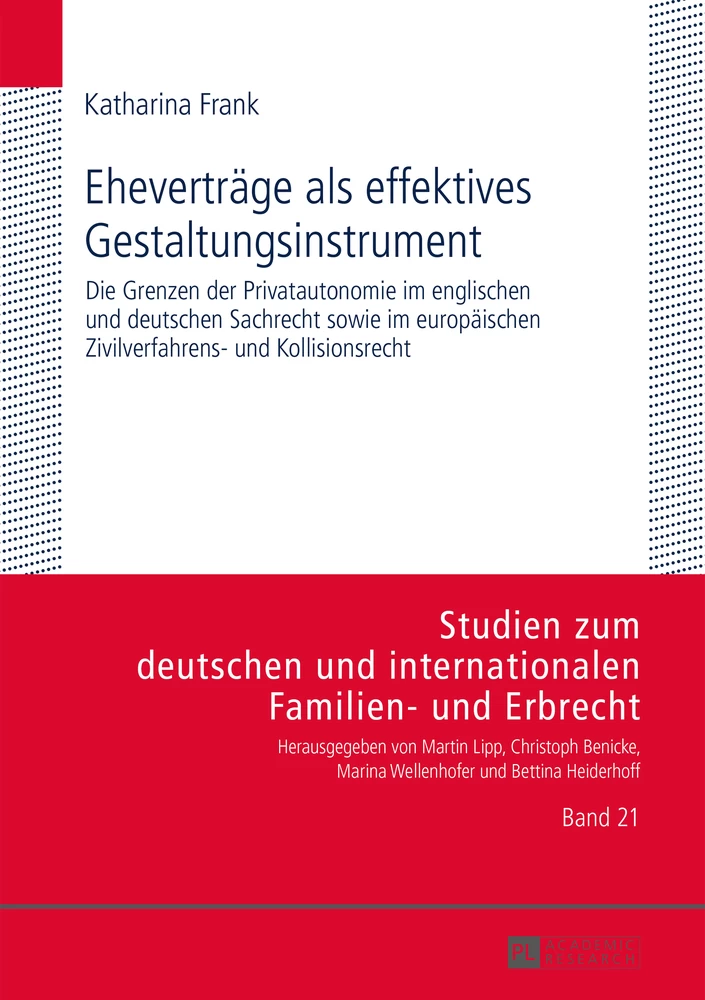Eheverträge als effektives Gestaltungsinstrument
Die Grenzen der Privatautonomie im englischen und deutschen Sachrecht sowie im europäischen Zivilverfahrens- und Kollisionsrecht
Summary
Excerpt
Table Of Contents
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Vorwort
- Inhaltsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Einleitung
- A. Das Problem in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht
- I. Einführung – Erwartungshaltung und Interessenlage
- II. Nationale Dimension – Materielles Sachrecht
- 1. Privatautonomie und Schutzmechanismen
- 2. Divergenz und Konvergenz im englischen und deutschen Recht
- III. Internationale Dimension – Internationale Zuständigkeit und Kollisionsrecht
- 1. Forum Shopping und internationale Zuständigkeit (Lokalproblem)
- 2. Rechtsanwendungsunsicherheit und Kollisionsrecht (Globalproblem)
- B. Zielsetzung und Gang der Untersuchung
- C. Zur Verwendung deutscher und fremdsprachlicher Fachterminologie
- 1. Teil: Marital Agreements in der englischen Rechtsordnung
- A. Einführung
- I. Richterliche Entscheidungsgewalt im Scheidungsfolgenrecht
- II. Privatautonomie im Scheidungsfolgenrecht
- B. Grundlagen – Richterliches Ermessen im Scheidungsfolgenrecht unter dem Eindruck des Gesetzes und der Rechtsprechung
- I. Gesetzliche Vorgaben
- 1. Verteilungsbefugnisse des Richters
- a) Maßnahmenkatalog
- b) Zeitpunkt der Anordnung
- 2. Faktoren nach s. 25 MCA 1973
- a) Wohlergehen des Kindes (s. 25 (1) MCA 1973)
- b) Sonstige Faktoren (s. 25 (2) MCA 1973)
- aa) Income, Earning Capacity, Property and Other Financial Resources (lit. a))
- bb) Financial Needs, Obligations and Responsibilities (lit. b))
- cc) Standard of Living enjoyed by the Family (lit. c))
- dd) Age of each Party and Duration of Marriage (lit. d))
- ee) Physical or Mental Disability (lit. e))
- ff) Contributions (lit. f))
- gg) Conduct (lit. g))
- hh) Benefits (lit. h))
- c) Marital Agreement als einer der Faktoren der s. 25 MCA 1973
- 3. Clean Break-Prinzip (s. 25A MCA 1973)
- II. Konkretisierung durch die Rechtsprechung
- 1. Notwendigkeit der Interpretation des Gesetzes
- 2. Fairness als oberste Maxime (White v White)
- a) Instanzieller Werdegang
- b) Kernpunkte der Entscheidung des House of Lords
- 3. Determinierung eines fairen Ergebnisses (Miller v Miller; McFarlane v McFarlane)
- a) Rahmenbedingungen für eine faire Entscheidung
- b) Instanzieller Werdegang
- c) Kernpunkte der Entscheidung des House of Lords
- aa) Drei Elemente der Fairness (Needs, Compensation und Sharing)
- bb) Behandlung von ehelichem und nicht-ehelichem Vermögen
- 4. Verhältnis der Elemente zueinander (Charman v Charman)
- 5. Verhältnis von Gesetz und Rechtsprechung
- III. Zusammenfassung der Grundlagen
- C. Private Ordering – Marital Agreements auf dem Weg zur Vertragsfreiheit?
- I. Einführung – Die Manifestierung richterlichen Paternalismus durch das Hyman-Prinzip
- II. Consent Orders
- III. Separation Agreements
- 1. Rechtsnatur und Rechtswirkung
- 2. Richterliche Würdigung
- IV. Pre- und Post-Nuptial Agreements (Nuptial Agreements)
- 1. Keine rechtsgeschäftliche Verfügbarkeit über die Ehe als Institution im Spiegel der Tradition (Public Policy)
- 2. Lösung der gesetzlichen Verankerung der Public Policy durch die Reform 1969/1970
- 3. Neuere Entwicklungen in der Rechtsprechung
- a) Graduelle Steigerungen bei der Gewichtung und die vorübergehende Entstehung eines Paradoxons
- b) Partielle Enthebung der Public Policy in der Rechtsprechung durch MacLeod v MacLeod
- V. Die Rechtsprechung seit Radmacher v Granatino und ihre Folgen für die Rechtswirkung von Nuptial Agreements
- 1. Instanzieller Werdegang
- 2. Anwendungsbezogene Vorfragen
- a) Anwendungstiefe (Hyman v Hyman und Radmacher v Granatino)
- b) Anwendungsbreite (MacLeod v MacLeod und Radmacher v Granatino)
- 3. Grundlagen der Nuptial Agreements
- a) Vollständige Enthebung der Public Policy in der Rechtsprechung sowie deren Folgen
- aa) Keine Anwendung der ss. 34 und 35 des MCA 1973 auf Post-Nuptial Agreements
- bb) Aufgabe der Differenzierung zwischen Pre- und Post-Nuptial Agreements
- cc) Keine Anwendung des Edgar-Tests auf (Post-) Nuptial Agreements
- b) Fortgeltung elementarer Prinzipien
- c) Rechtsnatur und Rechtswirkung
- 4. Form und Inhalt der Nuptial Agreements (Two-Stage-Test of Fairness)
- a) First Stage – Procedural Fairness
- aa) Formale Vorgaben und ihre Kritik im Allgemeinen
- bb) Funktionaler Ansatz
- b) Sonderstellung – Foreign Element
- aa) Englisches Kollisionsrecht und dessen Plädoyer für die Anwendung der lex fori
- bb) Materiell-rechtlicher Inhalt des Foreign Elements
- cc) Weite und enge Auslegung des Begriffs – Konflikt zwischen dem englischen materiellen Sachrecht und dem englischen Kollisionsrecht
- dd) Weite und enge Auslegung des Begriffs – Konsequenzen des Konflikts für das internationale Recht
- ee) Verbleibende Bedeutung des Foreign Elements für internationale Ehepaare
- c) Second Stage – Substantive Fairness
- aa) Wohlergehen des Kindes
- bb) Privatautonomie
- cc) Nicht-eheliches Vermögen
- dd) Unvorhergesehene Umstände und Disponibilität der drei Elemente (Needs, Compensation und Sharing)
- d) Privatautonomie auf Umwegen und richterliche Kompetenz-Kompetenz
- aa) Widerlegbare Vermutung zugunsten der Anerkennung und Beweislastumkehr
- bb) Systemwidrige Beweislastverteilung
- cc) Aufweichung der Vermutungsregel
- dd) Inkurs – Yardstick of Equality (White v White) oder Equal Sharing Principle (Miller v Miller; McFarlane v McFarlane)
- e) Zwischenergebnis und Bewertung
- aa) Ausmaß des Fortschrittes
- bb) Dilemma der Rechtsprechung
- cc) Radmacher-Test (Nuptial Agreements) und Edgar-Test (Separation Agreements) im Vergleich
- 5. Nachfolgende Entwicklung
- VI. Reformbewegung der Law Commission – Einführung von Qualifying Nuptial Agreements de lege ferenda
- D. Zusammenfassende Beurteilung der Marital Agreements
- 2. Teil: Einordnung und Bewertung der Entwicklungen in der englischen Rechtsordnung am Maßstab der deutschen Rechtsordnung
- A. Einführung
- I. Vertragsfreiheit und Vertragsgerechtigkeit
- II. Evaluierungsmethodik
- B. Privatautonomie als systemimmanentes Prinzip
- I. Rechtsnatur und Rechtswirkung der Vereinbarung
- II. Interdependenz von Privatautonomie und Default System
- 1. Grundlegung
- a) Default System
- aa) Ermessenbasiertes Scheidungsfolgenpaket im englischen Recht
- bb) Regelbasiertes Säulensystem im deutschen Recht
- b) Integration privatautonomer Vereinbarungen in das System
- aa) Integrationsmechanismus – Primäre und sekundäre Integration
- bb) Integrationsgründe – Ehebild und Ehetypen
- 2. Deutsche Perspektive
- a) Begriff des Ehevertrages
- b) Inhalt des Ehevertrages als Abweichung vom Default System
- aa) Güterrecht
- bb) Versorgungsausgleich
- cc) Nachehelicher Unterhalt
- dd) Ehewohnung und Haushaltsgegenstände
- c) Form des Ehevertrages
- III. Rechtsvergleich und Zwischenergebnis
- 1. Zeitpunkt der Eheschließung
- 2. Zeitpunkt der Ehescheidung
- C. Richterliches Prüfverfahren als paternalistisches Element zur Gewährleistung eines systemgeprägten Gerechtigkeitsverständnisses
- I. Entwicklungen in der Rechtsprechung im Zeitraffer – Konservatismus und Liberalismus
- 1. Grundlegung
- 2. Deutsche Perspektive
- a) Materialisierung des Vertragsrechts
- aa) Verfassungsrechtliche Wertungen
- bb) Einfluss des Verfassungsrechts auf zivilrechtliche Verträge
- b) Vertragsarten und Anwendbarkeit des richterlichen Prüfverfahrens
- 3. Rechtsvergleich und Zwischenergebnis
- II. Annäherung der Rechtsordnungen durch richterliches Prüfverfahren
- 1. Grundlegung
- a) Dichotomie der Kontrollverfahren
- aa) Two-Stage-Test of Fairness im englischen Recht
- bb) Zweistufige Inhaltskontrolle im deutschen Recht
- b) Beweislastverteilung und Systemgerechtigkeit
- 2. Deutsche Perspektive
- a) Kernbereichslehre
- aa) Disponibilität einzelner Scheidungsfolgen
- bb) Kritik an der Kernbereichslehre – Mindestgehalt an Scheidungsfolgen und Ausgleich ehebedingter Nachteile in der Diskussion
- b) Wirksamkeitskontrolle nach § 138 Abs. 1 BGB
- aa) Maßstäbe der Rechtsprechung
- bb) Kritik an der Wirksamkeitskontrolle und Konsequenz
- c) Ausübungskontrolle nach § 242 BGB
- aa) Maßstäbe der Rechtsprechung
- bb) Dogmatische Anbindung und entwicklungsorientierte Vertragskontrolle nach Sanders
- III. Rechtsvergleich und Ergebnis – Diametrale Grundhaltung und Annäherung durch richterliches Prüfverfahren
- 1. Strukturelle Konzeption der Prüfverfahren
- 2. Inhaltliche Konzeption der Prüfverfahren
- a) Zeitpunkt des Abschlusses der Vereinbarung
- b) Zeitpunkt der Geltendmachung der Vereinbarung
- 3. Bewertung des Falles Radmacher v Granatino aus deutscher materiell-rechtlicher Perspektive
- D. Entscheidungswert – Rechtssicherheit v Einzelfallgerechtigkeit und Privatautonomie v Paternalismus
- I. Grundlegung
- II. Rechtssicherheit und richterliche Rechtsfortbildung
- III. Privatautonomie und pluralistisches Gerechtigkeitsverständnis
- E. Schlussfolgerungen für internationale Ehepaare
- 3. Teil: Internationaler Kontext
- A. Einführung – Europäische Zielsetzung und Realitätsferne im Familienrecht
- B. Rechtszustand de lege lata
- I. Internationale Zuständigkeit im Scheidungs- und Scheidungsfolgenrecht
- 1. Vereinheitlichtes Verfahrensrecht
- a) Europäisches Unterhaltsrecht
- aa) Abgrenzung zu Güterrechtssachen
- bb) Gerichtsstandsvereinbarung
- cc) Gesetzliche Gerichtsstände
- b) Annexzuständigkeit als Schnittstelle zum internationalen Scheidungsrecht
- c) Keine Vereinheitlichung im Bereich der sonstigen Scheidungsfolgen
- 2. Verbleibender Anwendungsbereich des nationalen Verfahrensrechts
- a) Internationale Zuständigkeit aus englischer Perspektive
- b) Internationale Zuständigkeit aus deutscher Perspektive
- II. Kollisionsrecht im Scheidungs- und Scheidungsfolgenrecht
- 1. Vereinheitlichtes Kollisionsrecht
- a) Europäisches Unterhaltsrecht
- b) Akzessorische Anknüpfung als Schnittstelle zum internationalen Scheidungsrecht
- c) Keine Vereinheitlichung im Bereich der sonstigen Scheidungsfolgen
- 2. Verbleibender Anwendungsbereich des nationalen Kollisionsrechts
- 3. Zwischenergebnis und Bewertung des Falles Radmacher v Granatino aus internationaler Perspektive
- III. Anerkennung und Vollstreckung im Scheidungsfolgenrecht
- C. Rechtszustand de lege ferenda
- I. Konturierung des Lösungsspektrums (Implementierungsebenen)
- II. Determinierung des Lösungsspektrums (Implementierungsmethodik und -plattform)
- 1. Vorbedingungen und Grundsatzentscheidungen der Implementierungsmethodik
- a) Trennung zwischen gesetzlichen und vertraglichen Scheidungsfolgen
- b) Abhängigkeit von internationaler Zuständigkeit und Kollisionsrecht
- aa) Verlagerung des Kollisionsrechts in die Zuständigkeit (lex fori in foro proprio)
- bb) Kein umgekehrter Gleichlauf zwischen Zuständigkeit und anwendbarem Recht (forum legis)
- c) Verwirklichung des Parteiwillens durch Gerichtsstandsvereinbarung und Vermeidung positiver Kompetenzkonflikte
- d) Zuständigkeitenbündelung der Ehevertragssache zugunsten der Statussache (international und örtlich)
- 2. Europäische Verordnungen als adäquate Implementierungsplattform
- a) Auswahl der Implementierungsplattform
- b) Konkreter Implementierungsvorschlag
- aa) Ausschließliche Zuständigkeit in Ehevertragssachen zugunsten der Statussache (Brüssel I-VO-AE)
- bb) Gerichtsstandsvereinbarung in Statussachen (Brüssel IIa-VO-AE)
- cc) Gesetzlicher Gerichtsstand in Statussachen (Brüssel IIa-VO-AE)
- dd) Anwendung des eigenen materiellen Sachrechts in Ehevertragssachen (Rom I-VO-AE)
- ee) Hinweise zur Anerkennung und Vollstreckung in Ehevertragssachen
- 3. Weiterer Forschungsbedarf
- III. Radmacher v Granatino als Anwendungsbeispiel
- D. Zusammenfassung des internationalen Kontextes
- 4. Teil: Zusammenfassung der Ergebnisse und rechtspolitischer Ausblick
- A. Nationale Dimension – Materielles Sachrecht
- B. Internationale Dimension – Internationale Zuständigkeit und Kollisionsrecht
- Literaturverzeichnis
- Internetquellen
Abb. 1: Privatautonomie und richterliches Prüfverfahren (Sachrechtsannäherung)
Abb. 2: Rechtszustand de lege lata (internationaler Kontext)
Abb. 3: Rechtszustand de lege ferenda (internationaler Kontext) ← XV | XVI →
Im Übrigen wird auf das Abkürzungsverzeichnis der Rechtssprache von Kirchner/Butz, 6. Aufl., 2008 sowie auf den Cardiff Index to Legal Abbreviations (abrufbar unter: http://www.legalabbrevs.cardiff.ac.uk, Stand: 18.12.2014) verwiesen. ← XX | 1 →
A. Das Problem in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht
I. Einführung – Erwartungshaltung und Interessenlage
Aus welchem Grund entscheiden sich Ehegatten in erster Linie dazu, eine Vereinbarung zur Regulierung ihrer vermögensrechtlichen Verhältnisse für den Fall der Scheidung zu schließen? Sie streben nach Rechtssicherheit, denn „[c]ertainty is a valuable commodity which most people want in all areas of their life“1, und optieren in Anlehnung an die geplante Lebensgestaltung für eine eigenverantwortliche Regelung der Scheidungsfolgen in Abkehr vom gesetzlichen Schutz- und Kompensationssystem und dem diesem zugrunde liegenden Ehetyp. Der Vertrag soll für die Zukunft Rechtsklarheit schaffen und Streit bezüglich der rechtlichen Konsequenzen einer Scheidung vermeiden.2
Die natürliche Erwartungshaltung einer jeden vertragschließenden Partei ist es bzw. sollte es sein, dass sie von der Wirksamkeit und der richterlichen Anerkennung der geschlossenen Regelungen als effektives Mittel zur Verwirklichung von Privatautonomie ausgeht. Das tatsächlich erreichte Ziel kann jedoch in zweierlei Hinsicht hinter dem angestrebten Ziel zurückbleiben3 und eine für die Erwartungshaltung enttäuschende Wirkung nach sich ziehen: So kann zum einen die Würdigung des Vertrages im materiellen Sachrecht der jeweiligen Rechtsordnung bereits erste Probleme aufwerfen (Nationale Dimension, A. II). Zum anderen können bei Fällen mit Auslandsberührung die zur Anwendung gelangenden Regelungen zur internationalen Zuständigkeit der Gerichte eines Staates sowie zum Kollisionsrecht beabsichtigte oder auch unvorhergesehene Resultate hervorbringen (Internationale Dimension, A. III), sollten Gerichtsstandsvereinbarungen und Rechtswahlklauseln als Bestandteil des Ehevertrages (Hauptvertrag) im Einzelfall wirkungslos bleiben und nicht zum intendierten materiellen ← 1 | 2 → Sachrecht führen. Kumulieren sich die Risikofaktoren in der nationalen und der internationalen Dimension, potenziert sich die Rechtsunsicherheit, was zu einer mangelhaften Effektivität des Vertrages im Erkenntnisverfahren führen kann.
In diesem Zusammenhang kann die Interessenlage der Ehegatten die Erwartungshaltung beeinflussen und zugleich über das Schicksal des Vertrages entscheiden.4 Wirtschaftliche und emotionale Parität der Parteien bedingt, jedenfalls präsumtiv, nicht nur einen ausgewogenen Ausgleich der beiderseitigen Interessen innerhalb des Vertrages5 (Vertragsgerechtigkeit), sondern im Falle gleichbleibender Umstände auch eine Gleichlagerung der Interessen bei Störfalleintritt6 (festhalten am Vertrag) und ein daraus folgendes gleichförmiges Agieren (kein Angriff des Vertrages). Die für die Untersuchung interessante Fallgestaltung eröffnet sich demzufolge erst in disparitätischen Verhältnissen, in denen sich mit Blick auf die Interessenlage der Parteien ein dissonantes und partikularistisches Bild ergibt.
Einerseits können gesetzliche Ansprüche verkürzt oder sogar ausgeschlossen werden (Vereinbarungen mit negativer Funktion). Zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses ist es die potenziell anspruchsverpflichtete und damit die wirtschaftlich stärkere Partei, die einen solchen Abschluss forciert, um die andere Partei im Falle einer Scheidung nicht am Vermögen beteiligen zu müssen. Dies kann verständliche oder auch moralisch fragwürdige Gründe haben. Denkbar wäre die Erhaltung eines einheitlichen Vermögensgegenstandes, z. B. eines Unternehmens, die Sicherung des Vermögens zugunsten eines Erben oder schlicht eine Trennung der Vermögensmassen ohne eine über die Scheidung hinausgehende Verpflichtung, insbesondere auch, wenn Verpflichtungen aus erster Ehe bzw. gegenüber ← 2 | 3 → einem Kind bestehen.7 Die potenziell anspruchsberechtigte, wirtschaftlich schwächere Partei nimmt in dieser Situation aufgrund ihrer Unterlegenheit eine resignierende, wenn nicht sogar aufgrund irrationaler Vorstellungen im zeitlichen Kontext der Eheschließung indifferente Haltung ein.
Zum Zeitpunkt der Geltendmachung führt die wirtschaftliche Disparität hingegen regelmäßig zu einer Verfolgung diametraler Interessen, weil beide Parteien angesichts des konkreten Störfalles bestrebt sind, das für sie optimale Ergebnis zu erzielen:8 Sie konteragieren und es kommt zum Interessenkonflikt; der eine wird zum Angreifer, der andere zum Verteidiger des Vertrages. Das Interesse der anspruchsverpflichteten Partei ist darauf gerichtet, weiterhin an der vertraglichen Regelung festzuhalten (Verteidigungshaltung), denn schließlich wird sie durch die Verkürzung begünstigt. Die anspruchsberechtigte Partei versucht indes Wege zu finden, eben diesen Vertrag außer Kraft zu setzen (Angriffshaltung), weil die Anwendung der gesetzlichen Regelungen für sie in der Regel vorteilhafter ist. Statt habgieriger Absichten steht meist die Geltendmachung schützender und kompensatorischer Ansprüche im Vordergrund, die das Recht der betroffenen Person ohne den Vertrag zugestehen würde.
Beide Parteien werden daher mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln versuchen, ihren Partikularinteressen entsprechend bestmöglich auf das Ergebnis Einfluss zu nehmen. Vor allem für die anspruchsberechtigte Partei bestehen in der nationalen Dimension (materiell-rechtlich) wie auch in der internationalen Dimension (prozessuale Taktik) hierfür qualitativ divergierende Angriffspunkte. Denn während eine Abstandnahme vom Vertrag vor dem Hintergrund des materiellen Rechts zum Schutz der schwächeren Partei vollkommen legitim erscheinen kann, könnte der Rechtszustand de lege lata im Recht der internationalen Zuständigkeit und des Kollisionsrechts bei Sachverhalten mit Auslandsberührung im schlimmsten Falle zu einer Instrumentalisierung der nationalen Schutzmechanismen führen. Es stellt sich sodann die Anschlussfrage, ob und in welchem Maße der anspruchsverpflichteten, auf den Vertrag vertrauenden Partei aus Gründen der Chancen- und Waffengleichheit Verteidigungsmittel zuzusprechen sind. Dies gilt auch, wenn die Rollenverteilung (Anspruchsberechtigter oder Anspruchsverpflichteter) und infolgedessen die Interessenlage der Parteien zwischen Vertragsabschluss (Resignation oder Forcierung) und Geltendmachung (Angriff oder Verteidigung) im zeitlichen Verlauf der Ehe alternieren sollte. ← 3 | 4 →
Hiervon zu unterscheiden sind andererseits gesetzliche Ansprüche, die erweitert werden (Vereinbarungen mit positiver Funktion).9 Diese vertragliche Abweichung geht zulasten der anspruchsverpflichteten, wirtschaftlich stärkeren Partei, sodass im Vergleich zur ersten Konstellation die dargestellten Interessenlagen und aufgeworfenen Fragestellungen grundsätzlich mit vertauschten Rollenverteilungen wiederkehren: Der Anspruchsverpflichtete wird zum Angreifer und der Anspruchsberechtigte zum Verteidiger des Vertrages. Die finanziell nachteilhaften Auswirkungen zulasten der wirtschaftlich stärkeren Partei sind jedoch grundsätzlich leichter hinnehmbar als solche zulasten der schwächeren Partei. Zudem stehen der stärkeren Partei bei Vertragsschluss aufgrund ihrer wirtschaftlichen Überlegenheit meist mehrere Handlungsoptionen offen, sodass die Eingehung nachteilhafter Regelungen erst einmal selbstbestimmt erfolgt. Das Schutzbedürfnis der stärkeren Partei ist daher jedenfalls zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gering, auch wenn es im Laufe der Jahre im Falle sich verändernder, für den Inhalt des Vertrages ausschlaggebender Faktoren erneut steigen kann. Das Hauptaugenmerk der Untersuchung liegt aus diesem Grund auf der erstgenannten Konstellation.
II. Nationale Dimension – Materielles Sachrecht
1. Privatautonomie und Schutzmechanismen
Die nationalen Rechtsordnungen unterscheiden sich zuweilen signifikant im Hinblick darauf, wie sie vermögensrechtliche Verträge zwischen Ehegatten einordnen. Ist es in vielen Rechtsordnungen die Regel, dass privatautonome Vereinbarungen als wählbare Alternative (Opt-Out-System) zu einem vom Gesetz vorgegebenen Schutz- und Kompensationssystem (Default System) getroffen werden können, so ist es in England und Wales durchaus üblich, Marital Agreements als gegenüber dem Matrimonial Court nicht bindend anzusehen und das Default System als maßgebliche Entscheidungsgrundlage heranzuziehen; bei Letzterem besteht demzufolge grundsätzlich keine Möglichkeit zum Opt-Out.10 Die Stellung der Privatautonomie in einer Rechtsordnung steht damit in jedem ← 4 | 5 → Fall in einem starken Abhängigkeitsverhältnis zum jeweils zugrunde liegenden Default System.
Da die vermögensrechtlichen Verhältnisse der Ehegatten gerade im Scheidungsfall von enormer Bedeutung sind, sieht jede Rechtsordnung, unabhängig von der konkreten Stellung der Privatautonomie, ein schützendes Instrument zugunsten der schwächeren Partei sowie zugunsten eines Kindes vor.11 Die Wirkungsweise des Instruments ist notwendigerweise an dem Mechanismus ausgerichtet, der die Integration privatautonomer Vereinbarungen in das jeweilige System beschreibt.
Das Schutzinstrument führt entweder dazu, dass die Privatautonomie der Ehegatten von vornherein eingeschränkt oder eine nachträgliche Inhaltskontrolle des Vertrages durchgeführt wird:12 Im ersten Fall sind die Möglichkeiten zur privatautonomen Regulierung weitgehend unterbunden. Die Parteien werden auf die Vorschriften des Scheidungsfolgenrechts verwiesen, die unter den gegebenen Umständen eine nuancierte Berücksichtigung des Vertrages auf der Grundlage des richterlichen Ermessensspielraumes als Integrationsmechanismus in die Entscheidung zulässt (sekundäre Integration mit Positiveffekt). Der dahinter stehende Gedanke ist häufig von Einzelfallgerechtigkeitsaspekten getrieben und Ausprägung eines paternalistischen Ansatzes. Im zweiten Fall sind privatautonome Regelungen grundsätzlich erlaubt (primäre Integration in Opt-Out-Systemen mit Negativeffekt). Für bestimmte Sachlagen behält man sich jedoch die Option vor zu intervenieren und damit wiederum den gesetzlichen Vorgaben Wirkung zu verschaffen. Hintergrund dieser Konstellation ist, dass man den Parteien eine eigenständige Regelung ihrer Verhältnisse zutraut und dem Vertrag im Grundsatz rechtssichernde Wirkung zukommen lässt. Es handelt sich also hierbei um einen von Privatautonomie geprägten, individualistischen Ansatz. Das konkrete Verhältnis des Scheidungsfolgenrechts zur Möglichkeit des Opt-Outs sowie der Wahl der Schutzmechanismen offenbart deshalb unwillkürlich, wem die Rechtsordnung primär die Kompetenz zuschreibt, eine faire Entscheidung zu treffen: dem Richter (extern ex post) oder den Parteien (intern ex ante), ein zuvörderst paternalistischer oder privatautonomer Ansatz.13 ← 5 | 6 →
2. Divergenz und Konvergenz im englischen und deutschen Recht
Im konkreten Vergleich der englischen und der deutschen Rechtsordnung zeigt sich die soeben angedeutete diametrale Interaktion zwischen Privatautonomie und Schutzmechanismen.14 Die beiden Rechtsordnungen können im ehevertragsrechtlichen Kontext – wenn sie auf ihre Grundpfeiler reduziert werden – als weit voneinander entfernt eingestuft werden.15 Nach englischem Recht können die zwischen den Parteien im Hinblick auf die vermögensrechtlichen Verhältnisse geschlossenen Agreements keine Bindung gegenüber dem Matrimonial Court herstellen, der im Falle der Scheidung unter Zugrundelegung eines erheblichen Ermessensspielraumes über die Anordnung der Financial Orders entscheidet. Vielmehr kann hier nur infolge der richterlichen Bewertung eine in Abhängigkeit von den Umständen des Einzelfalls stehende, mehr oder weniger starke Einbeziehung des Agreements in die jeweilige Entscheidung erfolgen. Die Gefahr eines ungerechten Vertrages wird insbesondere in paternalistischen Systemen als zu groß empfunden und wirkt sich deshalb negativ zulasten der Vertragsfreiheit aus.
Nach deutschem Recht steht es den Parteien offen, einen Vertrag zur Regelung des Güterrechts, des Versorgungsausgleichs sowie des nachehelichen Unterhalts zu schließen, sodass sie die Möglichkeit haben, das gesetzliche Scheidungsfolgenrecht vollständig abzuwählen. Im Falle der Scheidung ist das Gericht grundsätzlich an den Inhalt des Vertrages gebunden. Nur unter besonderen Umständen ist es Folge einer richterlichen Überprüfung, dass dem Vertrag nur teilweise bzw. keine Geltung zukommt. Bereits an dieser Stelle wird deutlich, dass sich das nationale Verständnis im Hinblick auf Vertragsfreiheit sowie Vertragsgerechtigkeit und dem damit eng verbundenen Gedanken der Rechtssicherheit und Einzelfallgerechtigkeit zumindest strukturell, nicht notwendigerweise auch inhaltlich, inkongruent gestaltet. ← 6 | 7 →
Trotz der strukturellen Divergenzen ist seit der Entscheidung des Supreme Courts16 in Radmacher v Granatino („Radmacher“) im Oktober 201017 und den Reformbestrebungen der Law Commission18 für das englische Recht einerseits sowie seit der Entscheidung des BVerfG aus dem Jahre 200119 und des BGH aus dem Jahre 200420 für das deutsche Recht andererseits eine Entwicklung in Richtung einer Sachrechtsannäherung der beiden Rechtsordnungen zu verzeichnen.21 Denn während das englische Recht privatautonomen Entscheidungen von Ehegatten steigende Bedeutung auf der Grundlage des Two-Stage-Tests of Fairness beimisst, ist entgegengesetzt dazu im deutschen Recht eine Zunahme von richterlichen Inhaltskontrollen von Eheverträgen am Maßstab der Wirksamkeits- und Ausübungskontrolle nach §§ 138 Abs. 1, 242 BGB festzustellen. Inhaltlich besteht Einigkeit insoweit, als für die richterlichen Prüfverfahren der Zeitpunkt des Abschlusses sowie der spätere Zeitpunkt der Geltendmachung der Vereinbarung entscheidend sind. Dieser zeitliche Ansatz der Prüfverfahren kann mehrheitlich mit der besonderen emotionalen Verbundenheit der Ehegatten und der Langfristigkeit der Vertragsbeziehung begründet werden, die eine rationale Einschätzung der Lage und eine realistische Einbeziehung zukünftiger Entwicklungen erschwert. Die Vereinbarung als „statisches Instrument“ kann insbesondere auf den „dynamischen Verlauf“ der Beziehung nicht angemessen reagieren, sodass hierauf mithilfe der richterlichen Prüfverfahren individuell und den Gegebenheiten der jeweiligen Rechtsordnung entsprechend eingegangen werden muss.22 ← 7 | 8 →
III. Internationale Dimension – Internationale Zuständigkeit und Kollisionsrecht
Eheverträge werden vor dem Hintergrund einer bestimmten Rechtsordnung geschlossen. Sie beziehen sich inhaltlich auf ein konkretes Scheidungsfolgensystem und passen dieses den individuellen Gegebenheiten an. Liegt jedoch ein Sachverhalt mit Auslandsberührung (internationale Ehepaare)23 vor, kann das in Bezug genommene Scheidungsfolgensystem durch die anwendbaren Vorschriften zur internationalen Zuständigkeit und zum Kollisionsrecht aus dem Blick geraten und die in den nationalen Rechtsordnungen bestehenden materiell-rechtlichen Unterschiede hervortreten. Gerade das Verhältnis von Privatautonomie und Schutzmechanismen ist vom Gerechtigkeitsverständnis des jeweiligen Sachrechts abhängig und soll hiermit weniger einer Kritik ausgesetzt, als vielmehr einer Konterkarierung mithilfe von Lücken auf internationaler Ebene entzogen werden.
Die Wahrscheinlichkeit für eine rechtlich relevante Verbindung zu einer anderen Rechtsordnung steigt mit zunehmender Migration;24 es findet eine stete Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse im Hinblick auf die im internationalen Familienrecht entscheidenden Elemente des gewöhnlichen Aufenthaltes und der Staatsangehörigkeit bzw. des Domiciles25 statt. Im Jahr 2007 hatten 16 Millionen der insgesamt 122 Millionen Ehen in der EU grenzüberschreitenden Charakter.26 Jährlich werden in der EU 2,2 Millionen neue Ehen geschlossen und rund 45 % wieder geschieden.27 Allein in Deutschland sind 11,4 % aller jährlich geschlossenen Ehen solche zwischen einem deutschen Staatsangehörigen und einem Ausländer.28 ← 8 | 9 →
1. Forum Shopping und internationale Zuständigkeit (Lokalproblem)
Details
- Pages
- XX, 303
- Publication Year
- 2015
- ISBN (Hardcover)
- 9783631660386
- ISBN (PDF)
- 9783653053227
- ISBN (MOBI)
- 9783653971538
- ISBN (ePUB)
- 9783653971545
- DOI
- 10.3726/978-3-653-05322-7
- Language
- German
- Publication date
- 2015 (February)
- Keywords
- Forum Shopping Richterliche Inhaltskontrolle materielles Familienrecht
- Published
- Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2015. XX, 303 S., 3 s/w Abb.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG