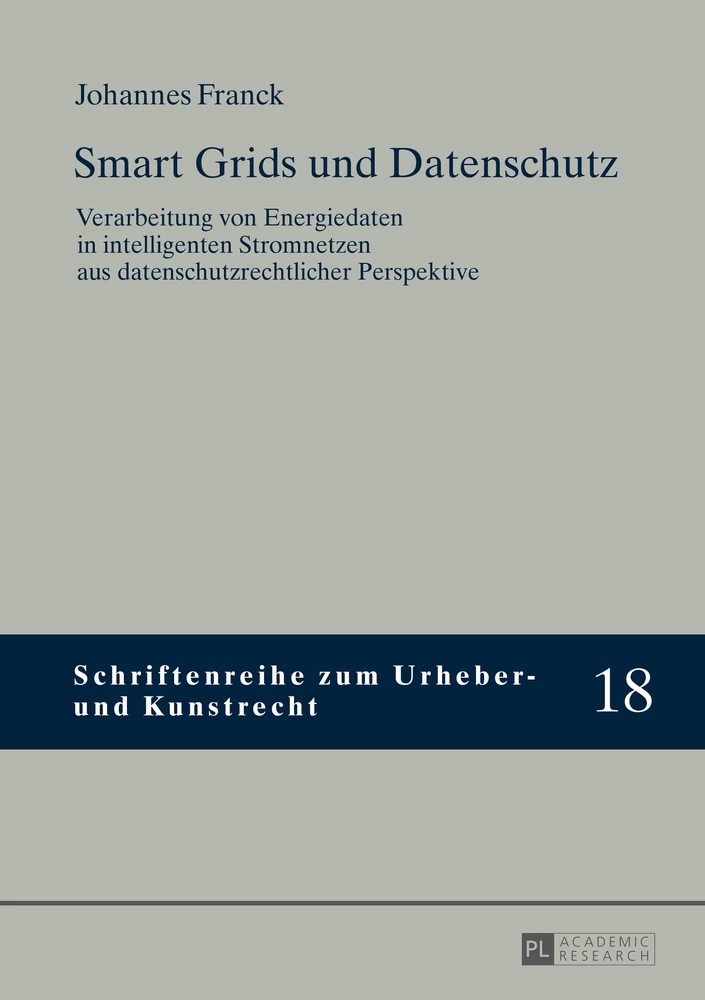Smart Grids und Datenschutz
Verarbeitung von Energiedaten in intelligenten Stromnetzen aus datenschutzrechtlicher Perspektive
Summary
Excerpt
Table Of Contents
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Danksagung
- Inhaltsübersicht
- Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Kapitel 1: Einleitung
- A. Problemaufriss
- B. Ziel der Arbeit
- C. Gang der Untersuchung
- Kapitel 2: Das (intelligente) Stromnetz
- A. Netzspezifische Terminologie
- B. Historische Entwicklung und derzeitiger Zustand des Strommarktes und des konventionellen Stromnetzes in Deutschland
- I. Entstehung und Entwicklung des Strommarktes
- 1. Historische Entwicklung des Stromnetzes
- 2. Entwicklung der nationalen gesetzlichen Rahmenbedingungen
- II. Technische Beschaffenheit des Stromnetzes und struktureller Aufbau des Strommarktes
- 1. Technische Netzstruktur nach Hierarchieebenen
- a) Übertragungsnetz
- b) Verteilernetz
- 2. Wertschöpfungskette im Energiesektor
- a) Stromerzeugung
- b) Stromtransport
- c) Stromvertrieb
- 3. Oligopolistische Marktstruktur
- III. Aktuelle Herausforderungen für den Energiesektor
- 1. Wachsender Energieverbrauch
- 2. Abkehr von fossilen und Hinwendung zu regenerativen Energiequellen
- 3. Strommengenplanung
- a) Lastmanagement
- b) Energiespeicherung
- c) Dezentrale Einspeisung und multidirektionale Netznutzung
- C. Strommarkt im Wandel und Entwicklung eines intelligenten Stromnetzes
- I. Politische Maß;nahmen
- 1. Legislative und exekutive Schritte zur Einführung der Energiewende
- a) Europa
- b) Deutschland
- 2. Netzausbau
- II. Das intelligente Stromnetz (Smart Grid)
- 1. Begriff und technische Grundlagen
- a) Begriffsdefinition
- b) Technischer Aufbau
- 2. Sonstige Komponenten des Smart Grid
- a) Smart Home
- b) Smart Life
- c) Forschungsprojekte
- III. Intelligente Verbrauchserfassung (Smart Metering)
- 1. Rechtliche Rahmenbedingungen
- a) Europäischer Rechtsrahmen
- b) Nationale Rechtsvorschriften
- aa) EnWG
- bb) MessZV
- cc) BSI-Schutzprofil
- dd) Verordnungspaket Intelligente Netze
- ee) Sonstige Regelungen
- c) Beschlüsse der Bundesnetzagentur
- 2. Begriff des Smart Metering
- a) Intelligentes Messsystem und Smart Meter
- b) Intelligenter Zähler
- c) Smart Meter Gateway und Gateway Administrator
- 3. Vorteile des Smart Metering
- Kapitel 3: Datenschutzrechtliche Einordnung
- A. Anwendbarkeit des Datenschutzrechts
- I. Anwendbarkeit des Datenschutzrechts auf den Smart-Meter-Rollout
- II. Subsidiarität gegenüber sektorspezifischem Recht (§ 1 Abs. 3 BDSG)
- 1. EnWG
- a) § 21c EnWG
- b) § 21g EnWG
- c) §§ 21h und 21i EnWG
- 2. MessZV und StromGVV
- 3. Telekommunikations- und Telemedienrecht
- III. Räumlicher Anwendungsbereich (§ 1 Abs. 5 BDSG)
- B. Normadressat: Verantwortliche Stelle
- I. Öffentliche und nicht-öffentliche Stellen (§ 2 BDSG)
- II. Verantwortliche Stellen im Energiesektor
- 1. Verantwortlichkeit kommunaler Energieversorgungsunternehmen
- 2. Verantwortlichkeit im Rahmen einer Konzernstruktur
- 3. Auftragsdatenverarbeitung
- 4. Private Einspeiser (Prosumer)
- III. Zwischenergebnis
- C. Betroffenheit
- D. Personenbezogene Daten im Smart Grid
- I. Einzelangaben über persönliche und sachliche Verhältnisse (§ 3 Abs. 1 BDSG)
- 1. Abrechnungsrelevante Daten
- a) Bestandsdaten
- b) Verbrauchsdaten
- 2. Steuerungsrelevante Daten
- 3. Technische Daten
- II. Bestimmtheit/Bestimmbarkeit der Energiedaten
- 1. Einpersonenhaushalt
- 2. Mehrpersonenhaushalt und gewerbliche Einrichtungen
- 3. Aufhebung des Personenbezugs durch Anonymisierung und Pseudonymisierung
- III. Zwischenergebnis
- E. Die Verarbeitungsschritte personenbezogener Energiedaten beim Smart Metering
- I. Erfassung der Energiedaten
- II. Weitergabe der Energiedaten
- III. Aufbereitung und Verwendung der Energiedaten
- Kapitel 4: Datenschutzrechtliche Beurteilung von Smart Grid und Smart Metering
- A. Datenschutzrechtliche Herausforderungen
- I. Datenproliferation und moderne Datenverarbeitungsmöglichkeiten
- 1. Ausgangslage
- 2. Konflikt mit dem Datensparsamkeitsgebot
- II. Zweckfremde Nutzung von Energiedaten
- 1. Ausforschbarkeit von Lebensgewohnheiten
- 2. Bildung von Persönlichkeitsprofilen
- a) Verfahren
- b) Predictive Analysis
- c) Einbeziehung externer Quellen
- d) Ökonomischer Wert
- 3. Verwendung der Energiedaten zu kommerziellen Zwecken
- a) Optimierung von Produkten und Dienstleistungen
- b) Zielgerichtete Werbung
- c) Nutzungsbezogene Versicherungstarife
- 4. Sonstige Verwendungsmöglichkeiten
- a) Nutzung durch öffentliche Einrichtungen
- b) Verwendung durch Arbeitgeber
- c) Interesse von Privatpersonen
- 5. Gefahren der Zweckentfremdung und Auswirkungen auf die Betroffenen
- a) Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts
- b) Konflikt mit dem datenschutzrechtlichen Zweckbindungsgrundsatz
- aa) Zweckbindung bei Energieversorgungsverträgen
- bb) Folgen fehlender Zweckfestlegung
- c) Erwartungsorientierte Verhaltensanpassung des Einzelnen
- d) Wirtschaftliche Auswirkungen und finanzielle Benachteiligung
- e) Nachteile durch fehlerhafte Entscheidungen
- aa) Inhaltlich fehlerhafte Daten
- bb) Methodisch fehlerhafte Daten
- cc) Konkrete Folgen für die Betroffenen
- dd) Kontrollverlust der Betroffenen über personenbezogene Daten
- ee) Problematik der „veralteten“ Datensätze
- ff) Delegation von Entscheidungen auf IT-Systeme
- f) Soziale Effekte und Diskriminierung
- 6. Zwischenergebnis
- III. Datendiversifikation
- 1. Problemdarstellung
- 2. Auswirkungen
- IV. Ubiquitous Computing
- 1. Problemdarstellung
- 2. Auswirkungen beim Betroffenen
- 3. Konflikt mit dem datenschutzrechtlichen Transparenz- und Direkterhebungsgrundsatz
- a) Vereinbarkeit mit dem Transparenzgebot
- b) Vereinbarkeit mit dem Direkterhebungsgrundsatz
- aa) Mitwirkung des Betroffenen
- bb) Ausnahme vom Direkterhebungsgebot beim „Pull-Betrieb“
- 4. Zwischenergebnis
- V. Bedrohung der Informationssicherheit
- 1. Schutzziele der Informationssicherheit
- 2. Bedrohung der Schutzziele
- 3. Konkrete Bedrohungsszenarien im Smart Grid
- B. Rechtmäß;igkeit der Datenverarbeitungsvorgänge im Smart Grid nach einfachgesetzlichem Datenschutzrecht
- I. Rechtfertigung durch gesetzliche Erlaubnistatbestände
- 1. Rechtmäß;igkeit des Datenumgangs mit abrechnungsrelevanten Daten nach § 28 BDSG
- a) Datenerfassung durch den Messstellenbetreiber
- aa) Szenario 1: Netzbetreiber ist Messstellenbetreiber
- (1) Bestehender Netznutzungsvertrag zwischen Netzbetreiber und Anschlussnutzer
- (a) Eigener Geschäftszweck
- (b) Erforderlichkeit für die Vertragserfüllung
- (2) Kein Netznutzungsvertrag zwischen Netzbetreiber und Anschlussnutzer
- (a) § 28 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BDSG
- (b) § 28 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 BDSG
- (aa) Wahrung berechtigter Interessen des Netzbetreibers
- (bb) Schutzwürdige Interessen des Betroffenen
- (3) Zwischenergebnis
- bb) Szenario 2: Energielieferant ist Messstellenbetreiber
- cc) Szenario 3: Dritter ist Messstellenbetreiber
- b) Datenweitergabe vom Messstellenbetreiber an den Netzbetreiber
- aa) Berechtigtes Interesse der verantwortlichen Stelle
- bb) Schutzwürdige Interessen des Betroffenen
- c) Datenweitergabe vom Netzbetreiber an den Energielieferanten
- aa) Berechtigtes Interesse der verantwortlichen Stelle oder des Dritten
- bb) Schutzwürdige Interessen der Betroffenen
- 2. Rechtmäß;igkeit des Datenumgangs mit steuerungsrelevanten Daten
- a) Datenerhebung durch und Weitergabe an den Netzbetreiber
- b) Datenweitergabe an Energielieferant
- 3. Rechtmäß;igkeit des Datenumgangs zu sonstigen Zwecken
- II. Rechtfertigung durch Einwilligung
- 1. Konflikt mit § 21g Abs. 2 S. 1 EnWG
- 2. Freiwilligkeit
- a) Koppelungsverbot
- b) Anforderungen an die Freiwilligkeit
- c) Ergebnis
- 3. Informiertheit des Betroffenen
- 4. Formelle Anforderungen
- a) Zeitpunkt der Einwilligung
- b) Schriftformerfordernis
- 5. Widerrufsmöglichkeit
- 6. Einwilligung bei mehreren Haushaltsmitgliedern
- a) Höchstpersönlichkeit oder Vertretung
- aa) Höchstpersönlicher Charakter der Einwilligung
- bb) Stellvertretung bei Einwilligung möglich
- b) Einwilligungsfähigkeit Minderjähriger
- c) Ergebnis
- 7. Einwilligung trotz gesetzlicher Erlaubnis
- III. Ergebnis
- C. Verfassungsrechtliche Bewertung
- I. Beeinträchtigung von Grundrechten und Bindung privater Akteure an das Verfassungsrecht
- II. Tangierte Grundrechte der Betroffenen
- 1. Unverletzlichkeit der Wohnung (Art. 13 GG)
- a) Eingriff in den Schutzbereich
- aa) Kein Wohnungsbezug
- bb) Ausspähung durch Smart Metering
- cc) Stellungnahme
- b) Rechtfertigung des Eingriffs
- c) Ergebnis
- 2. Allgemeines Persönlichkeitsrecht und Recht auf informationelle Selbstbestimmung (Art. 2 Abs. 1 i. V. m. Art. 1 Abs. 1 GG)
- 3. Recht auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme (Art. 2 Abs. 1 i. V. m. Art. 1 Abs. 1 GG)
- a) Rechtsprechung zur Online-Durchsuchung
- b) Einschränkung bzgl. „informationstechnischer Systeme“
- c) Anwendung auf Smart Metering
- d) „Anvertrauen“
- e) Vernetzung von IT-Systemen im Haushalt
- f) Subsidiarität
- 4. Fernmeldegeheimnis (Art. 10 GG)
- 5. Eigentumsfreiheit (Art. 14 GG)
- a) Energiedaten als eigentumsfähige Rechte i. S. v. Art. 14 GG
- aa) Vermögenswerte Rechtsposition
- bb) Zuordnung durch einfaches Recht
- (1) Zivilrechtliche Zuordnung einer Eigentumsposition
- (2) Entsprechende Anwendung der strafrechtlichen Vorschriften
- (3) Übertragung auf das Zivilrecht
- b) Ergebnis
- III. Ergebnis
- Kapitel 5: Lösungsvorschläge
- A. Regulierungsbedarf
- I. Regulierungsbedarf beim Rollout
- II. Datenschutzrechtlicher Regulierungsbedarf
- B. Rechtliche Lösungsansätze
- I. Einhaltung des Grundsatzes der Datenvermeidung und Datensparsamkeit
- 1. Begrenzung der Datenverarbeitung
- a) Länge der Messintervalle (Datengranularität)
- b) Begrenzung der verantwortlichen Stellen
- 2. Aufhebung des Personenbezugs
- a) Anonymisierung
- b) Pseudonymisierung
- c) Aggregation
- 3. Speicher- und Löschkonzepte
- II. Stärkung der Betroffenenrechte
- 1. Definition von Begrifflichkeiten
- 2. Transparenz der Vorgänge im Smart Grid
- a) Auskunftsrechte und Informationspflichten
- b) Steuerungs- und Eingriffsmöglichkeiten
- c) Regelung der Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten der datenverarbeitenden Stellen
- 3. Datensouveränität
- a) Interventionsmöglichkeiten
- b) (Digitale) Selbstbestimmung vs. Bevormundung
- 4. Datenschutzaufsicht
- III. Einwilligung als (un)wirksames Instrumentarium im Energierecht
- IV. Technologieoffenheit und Technikneutralität
- V. Ergebnis
- C. Technische und organisatorische Lösungsansätze
- I. Schutz der IT-Sicherheit
- II. Technischer Datenschutz
- 1. Privacy by Design/by Default
- 2. Datenschutzfolgenabschätzung (Privacy Impact Assessment, PIA)
- III. Standardisierung
- IV. Ergebnis
- Kapitel 6: Abschließ;ende Betrachtung und Ausblick
- A. Abschließ;ende Betrachtung
- I. Einführung von Smart Grids als Herausforderung
- II. Datenschutzrechtliche Bewertung
- B. Ausblick
- Literaturverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 2: Das (intelligente) Stromnetz
A. Netzspezifische Terminologie
I. Entstehung und Entwicklung des Strommarktes
1. Historische Entwicklung des Stromnetzes
2. Entwicklung der nationalen gesetzlichen Rahmenbedingungen
II. Technische Beschaffenheit des Stromnetzes und struktureller Aufbau des Strommarktes
1. Technische Netzstruktur nach Hierarchieebenen
2. Wertschöpfungskette im Energiesektor
3. Oligopolistische Marktstruktur
III. Aktuelle Herausforderungen für den Energiesektor
1. Wachsender Energieverbrauch
2. Abkehr von fossilen und Hinwendung zu regenerativen Energiequellen
c) Dezentrale Einspeisung und multidirektionale Netznutzung
C. Strommarkt im Wandel und Entwicklung eines intelligenten Stromnetzes
1. Legislative und exekutive Schritte zur Einführung der Energiewende
II. Das intelligente Stromnetz (Smart Grid)
1. Begriff und technische Grundlagen
2. Sonstige Komponenten des Smart Grid
III. Intelligente Verbrauchserfassung (Smart Metering)
1. Rechtliche Rahmenbedingungen
b) Nationale Rechtsvorschriften
dd) Verordnungspaket Intelligente Netze
c) Beschlüsse der Bundesnetzagentur
a) Intelligentes Messsystem und Smart Meter
c) Smart Meter Gateway und Gateway Administrator
3. Vorteile des Smart Metering
Kapitel 3: Datenschutzrechtliche Einordnung
A. Anwendbarkeit des Datenschutzrechts
I. Anwendbarkeit des Datenschutzrechts auf den Smart-Meter-Rollout
II. Subsidiarität gegenüber sektorspezifischem Recht (§ 1 Abs. 3 BDSG)
3. Telekommunikations- und Telemedienrecht
III. Räumlicher Anwendungsbereich (§ 1 Abs. 5 BDSG)
B. Normadressat: Verantwortliche Stelle
I. Öffentliche und nicht-öffentliche Stellen (§ 2 BDSG)
II. Verantwortliche Stellen im Energiesektor
1. Verantwortlichkeit kommunaler Energieversorgungsunternehmen
2. Verantwortlichkeit im Rahmen einer Konzernstruktur
4. Private Einspeiser (Prosumer)
D. Personenbezogene Daten im Smart Grid
I. Einzelangaben über persönliche und sachliche Verhältnisse (§ 3 Abs. 1 BDSG)
II. Bestimmtheit/Bestimmbarkeit der Energiedaten
2. Mehrpersonenhaushalt und gewerbliche Einrichtungen
3. Aufhebung des Personenbezugs durch Anonymisierung und Pseudonymisierung
E. Die Verarbeitungsschritte personenbezogener Energiedaten beim Smart Metering
II. Weitergabe der Energiedaten
III. Aufbereitung und Verwendung der Energiedaten
Kapitel 4: Datenschutzrechtliche Beurteilung von Smart Grid und Smart Metering
A. Datenschutzrechtliche Herausforderungen
I. Datenproliferation und moderne Datenverarbeitungsmöglichkeiten
2. Konflikt mit dem Datensparsamkeitsgebot
II. Zweckfremde Nutzung von Energiedaten
1. Ausforschbarkeit von Lebensgewohnheiten
2. Bildung von Persönlichkeitsprofilen
c) Einbeziehung externer Quellen
3. Verwendung der Energiedaten zu kommerziellen Zwecken
a) Optimierung von Produkten und Dienstleistungen
c) Nutzungsbezogene Versicherungstarife
4. Sonstige Verwendungsmöglichkeiten
a) Nutzung durch öffentliche Einrichtungen
b) Verwendung durch Arbeitgeber
c) Interesse von Privatpersonen
5. Gefahren der Zweckentfremdung und Auswirkungen auf die Betroffenen
a) Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts
b) Konflikt mit dem datenschutzrechtlichen Zweckbindungsgrundsatz
aa) Zweckbindung bei Energieversorgungsverträgen
bb) Folgen fehlender Zweckfestlegung
c) Erwartungsorientierte Verhaltensanpassung des Einzelnen
d) Wirtschaftliche Auswirkungen und finanzielle Benachteiligung
e) Nachteile durch fehlerhafte Entscheidungen
aa) Inhaltlich fehlerhafte Daten
bb) Methodisch fehlerhafte Daten
cc) Konkrete Folgen für die Betroffenen
dd) Kontrollverlust der Betroffenen über personenbezogene Daten
ee) Problematik der „veralteten“ Datensätze
ff) Delegation von Entscheidungen auf IT-Systeme
f) Soziale Effekte und Diskriminierung
2. Auswirkungen beim Betroffenen
3. Konflikt mit dem datenschutzrechtlichen Transparenz- und Direkterhebungsgrundsatz
a) Vereinbarkeit mit dem Transparenzgebot
b) Vereinbarkeit mit dem Direkterhebungsgrundsatz
aa) Mitwirkung des Betroffenen
bb) Ausnahme vom Direkterhebungsgebot beim „Pull-Betrieb“
V. Bedrohung der Informationssicherheit
1. Schutzziele der Informationssicherheit
3. Konkrete Bedrohungsszenarien im Smart Grid
I. Rechtfertigung durch gesetzliche Erlaubnistatbestände
1. Rechtmäßigkeit des Datenumgangs mit abrechnungsrelevanten Daten nach § 28 BDSG
Details
- Pages
- XXVI, 236
- Publication Year
- 2016
- ISBN (Hardcover)
- 9783631667187
- ISBN (PDF)
- 9783653062748
- ISBN (MOBI)
- 9783653960013
- ISBN (ePUB)
- 9783653960020
- DOI
- 10.3726/978-3-653-06274-8
- Language
- German
- Publication date
- 2015 (December)
- Keywords
- IntelligenVerbrauchserfassung Intelligenter Stromzähler Privacy by Design Energiedatenschutz Digitalisierung der Energiewende Smart Metering
- Published
- Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2016. XXVI, 236 S.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG