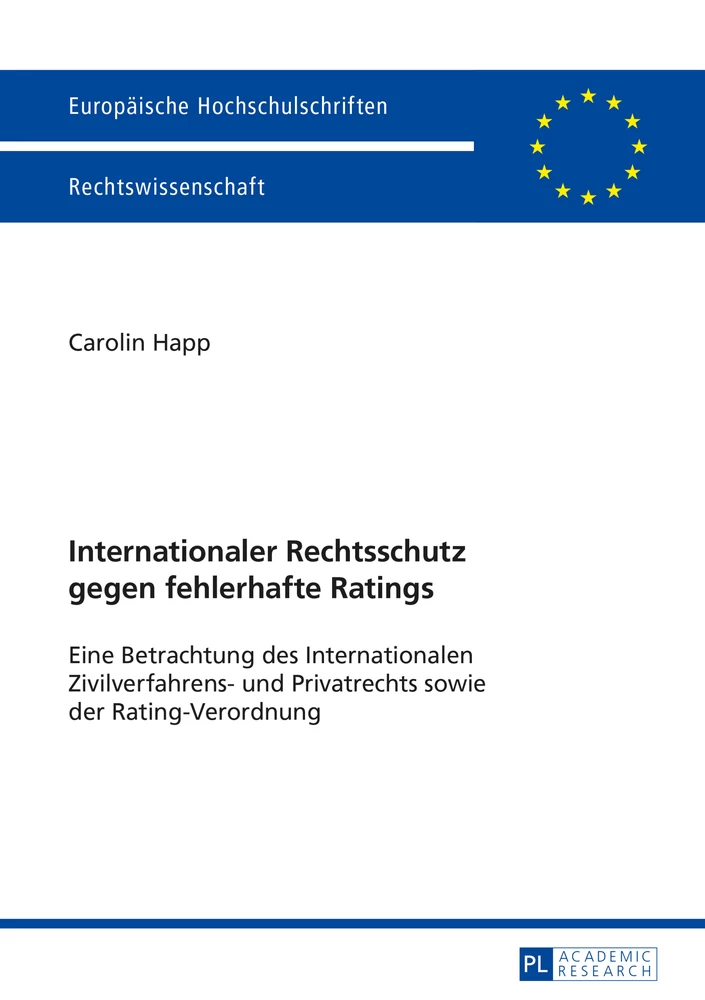Internationaler Rechtsschutz gegen fehlerhafte Ratings
Eine Betrachtung des Internationalen Zivilverfahrens- und Privatrechts sowie der Rating-Verordnung
Summary
Excerpt
Table Of Contents
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Vorwort
- Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Einleitung
- A. Grundlagen
- I. Das Rating
- 1. Das Rating im Allgemeinen
- 2. Das unbeauftragte Länderrating
- II. Normative Bezugnahme auf Ratings
- 1. IOSCO-Kodex
- 2. Basel Akkorde und Reduktion der normativen Bezugnahme auf Ratings
- 3. Die Rating-Verordnung
- III. Ratingagenturen
- 1. Der Begriff der Ratingagentur
- 2. Wirtschaftliche Bedeutung von Ratingagenturen
- a) Relevanz des Ratings für Kreditkosten und Nominalzinsen
- b) Ratingagenturen als Informationsintermediäre
- 3. Marktmacht der „großen Drei“
- 4. Konzernverhältnis der marktführenden Ratingagenturen
- 5. Schaffung einer europäischen Ratingagentur
- IV. Historie des Ratingmarktes
- 1. Die Entwicklung des Ratingmarktes bis 2010/2011
- 2. Aktueller Paradigmenwechsel
- V. Fehlerhafte Ratings
- 1. Krisen im Zusammenhang mit Ratings
- a) Enron
- b) WorldCom und Parmalat
- c) Die Finanzmarktkrise
- 1) Im Vorfeld der Krise
- 2) Die Rolle der Ratingagenturen
- d) Haushaltskrise USA
- 2. Problematik der Interessenkonflikte
- a) Finanzierungsmodelle
- 1) Issuer pays Modell
- 2) Investor pays Modell
- b) Beratung bei strukturierten Finanzprodukten
- VI. Ratingverfahren
- 1. Vorbereitungsphase
- 2. Analyse- und Bewertungsphase
- 3. Kommunikationsphase
- 4. Wiederholungsphase
- VII. Prozesse gegen Ratingagenturen
- 1. Jefferson City vs. Moody’s
- 2. Ohio Police vs. S&P Financial Services LLC u.a.
- 3. Bathurst Regional Council vs. Local Government Financial Services
- 4. Privater Anleger vs. S&P
- VIII. Haftungsbegründende Rechtsverhältnisse
- 1. Ratingagentur/Unternehmen
- 2. Ratingagentur/Staat
- 3. Ratingagentur/privater Anleger
- B. Die Rating-Verordnung
- I. Situation vor Änderung der Rating-VO im Juni 2013
- II. Einbettung der Rating-VO in das System des Internationalen Privatrechts
- 1. Konsequenzen der jeweils möglichen Einordnung der Rating-VO
- 2. Europäische Regelungsmodelle zur Einführung europäischer Standards
- 3. Anwendungsbereich der Rating-VO in rechtsvergleichender Betrachtung
- a) Vergleichende Betrachtung – Vorschaltprinzip
- b) Vergleichende Betrachtung – Einheitsrecht
- c) Ergebnis
- 4. Anwendbarkeit und Anwendungsbereich der Rating-VO
- a) Mitgliedstaatliches Gericht
- 1) Beschränkung auf registrierte Ratingagenturen
- aa) Registrierung nach Maßgabe der Rating-VO
- bb) Übernahme von Ratings
- 2) Fazit
- b) Drittstaatliches Gericht
- III. Raum für das Kollisionsrecht
- 1. Qualifikation der Haftung nach Art. 35a Rating-VO
- 2. Bestimmung des anwendbaren Rechts
- 3. Anknüpfung ausschließlich an den Herkunftsmitgliedstaat der Ratingagentur
- IV. Haftungsvoraussetzungen nach Art. 35a Rating-VO
- 1. Zuwiderhandlung
- 2. Auswirkung der Zuwiderhandlung
- 3. Verschulden der Ratingagentur
- 4. Kein Mitverschulden des Anspruchstellers
- a) Kein Mitverschulden des Anlegers
- b) Kein Mitverschulden des Emittenten
- 5. Schaden
- 6. Darlegungs- und Beweislast
- V. Rechtsfolgen
- 1. Haftungsumfang
- a) Mitverschulden
- b) Haftungsbegrenzung der Ratingagentur
- c) Überlegungen zu einer generellen Haftungsbegrenzung de lege ferenda
- 2. Verjährung
- VI. Bewertung
- C. Die Zuständigkeit deutscher Gerichte
- I. Anwendbarkeit der EuGVO auf internationale Ratingagenturen
- II. Anwendbarkeit der ZPO auf internationale Ratingagenturen
- III. Rechtsverhältnis Ratingagentur/Unternehmen bzw. Staat
- 1. Gerichtsstandsvereinbarung
- a) Art. 25 EuGVO
- 1) Vereinbarung über die Zuständigkeit eines drittstaatlichen Gerichts
- 2) Wirksamkeitsvoraussetzungen
- b) § 38 ZPO
- 2. Gerichtsstand der Niederlassung
- a) Art. 7 Nr. 5 EuGVO
- 1) Streitigkeit aus dem Betrieb der Niederlassung
- 2) Niederlassung
- 3) Ergebnis
- b) § 21 ZPO
- 1) Niederlassung
- 2) Selbstständigkeit
- 3) Beziehung zum Geschäftsbetrieb der Niederlassung
- c) Zusammenfassung
- 3. Gerichtsstand des Erfüllungsortes
- a) Art. 7 Nr. 1 EuGVO
- 1) Vertrag oder Ansprüche aus einem Vertrag
- aa) Freiwillige Verpflichtung einer Partei
- bb) Brogsitter und die Qualifikation „deliktischer“Ansprüche
- (1) Sachverhalt Brogsitter
- (2) Entscheidung des EuGH
- (3) Allgemeine Konsequenzen
- (4) Auswirkungen bei Bestehen eines Rating- oder Abonnementvertrages
- 2) Bestimmung des Erfüllungsortes
- aa) Rechtsnatur des Ratingvertrages i.S.d. EuGVO
- bb) Erfüllungsort beim Ratingvertrag nach Art. 7 Nr. 1 lit. b) EuGVO
- (1) Color Drack
- (2) Air Baltic
- (3) Wood Floor/Silva Trade
- (4) Übertragung der Grundsätze auf Ratingverträge
- (5) Erfüllungsort außerhalb eines Mitgliedstaats
- cc) Rechtsnatur des Abonnementvertrages
- (1) Kaufvertrag
- (2) Dienstleistungsvertrag
- (3) Vertrag sui generis
- dd) Erfüllungsort nach Art. 7 Nr. 1 lit. a) EuGVO
- ee) Fazit
- b) § 29 ZPO
- 1) Rechtsnatur des Ratingvertrages
- 2) Rechtsnatur des Abonnementvertrages
- aa) Kaufvertrag
- bb) Dienstleistungsvertrag
- cc) Typengemischter Vertrag
- dd) Stellungnahme
- 3) Zusammenfassung
- 4) Erfüllungsort
- aa) Erfüllungsort des Ratingvertrages
- bb) Erfüllungsort des Abonnementvertrages
- cc) Ergebnis
- c) Zusammenfassung
- 4. Deliktsgerichtsstand
- a) Art. 7 Nr. 2 EuGVO
- 1) Ansprüche aus einer unerlaubten Handlung
- 2) Ort des schädigenden Ereignis
- aa) Der maßgebliche Schaden und die Verletzungshandlung
- bb) Shevill sowie eDate Advertising und Martinez
- cc) Anwendung auf Reputationsverletzung durch Ratingveröffentlichung
- 3) Konkurrierende Ansprüche
- b) § 32 ZPO
- 1) Handlungsort
- 2) Erfolgsort
- c) Zusammenfassung
- 5. Gerichtsstand der Streitgenossenschaft
- a) Drittstaatenproblematik
- b) Konnexität
- c) Zusammenfassung
- 6. Gerichtsstand des Vermögens
- 7. Allgemeiner Gerichtsstand
- IV. Rechtsverhältnis Ratingagentur/privater Anleger
- 1. Verbrauchergerichtsstand
- a) Vertragliche Bindung
- 1) Vertragliche Bindung gegenüber allgemeinem Anlegerpublikum
- 2) Vertragliche Bindung gegenüber registriertem Benutzer
- b) Weitere Voraussetzungen des Verbrauchergerichtsstands
- 1) Erkennbarkeit der Verbrauchereigenschaft
- 2) Ausüben oder Ausrichten der Tätigkeit
- 3) Keine Kausalität zwischen Ausrichten und Vertragsschluss erforderlich
- c) Ergebnis
- 2. Gerichtsstandsvereinbarung
- a) Art. 19 EuGVO
- b) § 38 ZPO
- 3. Gerichtsstand des Erfüllungsortes
- a) Art. 7 Nr. 1 EuGVO
- 1) Qualifikation des Vertrages mit Schutzwirkung zugunsten Dritter
- 2) Ergebnis
- b) § 29 ZPO
- c) Zusammenfassung
- 4. Deliktsgerichtsstand
- a) Art. 7 Nr. 2 EuGVO
- 1) Der Erfolgsort bei reinen Vermögensschäden
- aa) Ausschluss des Erfolgsortes bei reinen Vermögensschäden
- bb) Vertretene Lösungsansätze zur Bestimmung des Erfolgsortes
- (1) Belegenheitsort des Vermögens
- (2) Vermögensschwerpunkt und Klägerwohnsitz
- (3) Nach Deliktstypen differenzierende Anknüpfung
- cc) Ergebnis
- 2) Der Handlungsort bei reinen Vermögensschäden
- b) § 32 ZPO
- 1) Erfolgsort
- 2) Handlungsort
- c) Zusammenfassung
- 5. Gerichtsstand der Niederlassung
- a) Zum Betrieb einer Niederlassung gehörig i.S.v. Art. 7 Nr. 5 EuGVO
- b) Bezug zum Geschäftsbetrieb der Niederlassung i.S.v. § 21 ZPO
- 6. Weitere konkurrierende Gerichtsstände
- V. Kein Gerichtsstand kraft Sachzusammenhang
- D. Die Bestimmung des anwendbaren Rechts
- I. Rechtsverhältnis Ratingagentur/Unternehmen bzw. Staat
- 1. Das Herkunftslandprinzip – keine Kollisionsnorm
- a) Dienste der Informationsgesellschaft
- b) Niedergelassener Diensteanbieter
- c) Koordinierter Bereich
- d) Rechtsfolgen
- 2. Anwendbares Recht nach Maßgabe der Rom I-VO
- a) Subjektive Anknüpfung
- 1) Ausdrückliche Rechtswahl
- 2) Konkludente Rechtswahl
- 3) Einschränkungen nach Art. 3 Abs. 3 und Abs. 4 Rom I-VO
- b) Objektive Anknüpfung
- 1) Qualifizierung des Rating- und Abonnementvertrages
- aa) Dienstleistungsvertrag
- bb) Kaufvertrag
- 2) Gewöhnlicher Aufenthalt der Ratingagentur
- 3) Objektive Anknüpfung des Abonnementvertrages
- c) Keine offensichtlich engere Verbindung
- d) Eingriffsnormen und ordre public
- 3. Anwendbares Recht nach Maßgabe der Rom II-VO
- a) Reputationsschädigung als Persönlichkeitsrechtsverletzung i.S.d. Rom II-VO
- 1) Wortlaut „Verletzung der Persönlichkeitsrechte“
- 2) Gesetzeshistorie
- 3) Teleologische Erwägungen
- b) Ergebnis
- 4. Anwendbares Recht nach Maßgabe des EGBGB
- a) Subjektive Anknüpfung
- b) Objektive Anknüpfung
- 1) Art. 40 EGBGB
- aa) Gemeinsamer gewöhnlicher Aufenthalt, Art. 40 Abs. 2 EGBGB
- bb) Tatortregelung, Art. 40 Abs. 1 EGBGB
- cc) Bestimmung des Erfolgsorts
- (1) Diskutierte Anknüpfungspunkte zur Einschränkung des Erfolgsortes
- (2) Ständige Rechtsprechung des BGH seit 2010
- dd) Ausübung des Optionsrechts als Sachnormverweisung
- 2) Art. 41 EGBGB, wesentlich engere Verbindung
- 3) Einschränkung des ausländischen Schadensersatzanspruchs
- c) Eingriffsnormen und ordre public, Art. 6 EGBGB
- 5. Zusammenfassung
- II. Rechtsverhältnis Ratingagentur/privater Anleger
- 1. Vertragliche Ansprüche
- a) Verbrauchervertrag
- b) Rechtswahl
- 1) Günstigkeitsvergleich
- 2) Verhältnis von Art. 3 Abs. 3 und Abs. 4 Rom I-VO zu Art. 6 Abs. 2 Rom I-VO
- 2. Deliktische Ansprüche
- a) Subjektive Anknüpfung
- 1) Antizipierte Rechtswahl
- 2) Nachträgliche Rechtswahl
- b) Objektive Anknüpfung
- 1) Gemeinsamer gewöhnlicher Aufenthalt
- 2) Erfolgsort
- 3) Offensichtlich engere Verbindung, Art. 4 Abs. 3 Rom II-VO
- aa) Art. 4 Abs. 3 S. 2 Rom II-VO
- bb) Art. 4 Abs. 3 S. 1 Rom II-VO
- 3. Der Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter
- a) Widerspruch zwischen Verfahrens- und Kollisionsrecht
- b) Offensichtlich engere Verbindung i.S.v. Art. 4 Abs. 3 Rom II-VO
- 4. Ordre public, Eingriffsnormen sowie Sicherheits- und Verhaltensregeln
- 5. Zusammenfassung
- Gesamtwürdigung
- Literaturverzeichnis
← XVIII | XIX → Abkürzungsverzeichnis
← XXII | 1 → Einleitung
Ratings haben einen enormen Einfluss auf den Kapitalmarkt. Ein negatives Rating eines Unternehmens führt für dieses zu erheblich höheren Refinanzierungskosten; im schlimmsten Fall droht die Insolvenz.1 Anleger, auf der Suche nach einer sicheren Investitionsmöglichkeit, verlassen sich bei ihren Entscheidungen auf das Vorliegen positiver Ratings.2 Ist nun ein derartiges Rating fehlerhaft – sei es zu positiv oder zu negativ – hat dies eklatante Auswirkungen für die Betroffenen, die sich im Ergebnis in einem Vermögensschaden niederschlagen.3 Hier beginnen die Probleme des Geschädigten, die für das fehlerhafte Rating Verantwortlichen, namentlich die Ratingagenturen, erfolgreich zu verklagen.
Im Dezember 2012 hatte der BGH zur Frage der Zulässigkeit einer Klage gegen eine US-amerikanische Ratingagentur Stellung zu nehmen.4 Der Kläger machte einen Anspruch gegen die Ratingagentur wegen eines zu positiven Ratings geltend.5 In der Folge überschlugen sich die Berichterstattungen. Überall war die „Neuigkeit“ zu lesen, dass Klagen gegen US-amerikanische Ratingagenturen vor deutschen Gerichten „erstmalig“ zulässig seien.6 Die diesbezügliche Berichterstattung suggerierte, dass der BGH mit diesem Urteil völlig neue Grundsätze aufgestellt hätte und dass eine zulässige Klage gegen US-amerikanische Ratingagenturen – die letztendlich nichts anderes als ein privatrechtlich organisiertes, international agierendes Unternehmen sind7 – vor deutschen Gerichten absolut überraschend sei.
Die Berichterstattung der Tagespresse erweckte den Eindruck, bei Ratingagenturen handle es sich um ein absolut neues und daher noch weitestgehend unreguliertes Phänomen. Wie zu zeigen sein wird, stellen Ratingagenturen jedoch vielmehr alteingesessene Institutionen dar, die den Kapitalmarkt seit gut einem Jahrhundert begleiten und nicht erstmalig im Rahmen der Finanzmarktkrise ← 1 | 2 → für Aufruhr sorgten.8 Die Finanzmarktkrise und die sich anschließende Staatsschuldenkrise haben allerdings dafür gesorgt, dass die – ebenfalls nicht neue – Regulierungsdebatte auch auf europäischer Ebene zu konkreten Ergebnissen führte.9
Insbesondere die in Teil B. darzustellende Rating-Verordnung10 aus dem Jahre 2010 ist dieser Regulierungsdebatte entsprungen.11 Die überwiegend aufsichtsrechtlichen Regelungen der Rating-Verordnung enthalten seit dem Jahre 2013 einen zivilrechtlichen Haftungstatbestand für fehlerhafte Ratings.12 Bevor dessen Haftungsvoraussetzungen überprüft werden können, stellen sich allerdings diverse Fragen, die vorrangig zu beantworten sind. So gilt es zu klären, ob der Rating-Verordnung als Einheitsrecht vor einer kollisionsrechtlichen Prüfung Vorrang zukommt oder ob sie erst nach kollisionsrechtlicher Bestimmung des anwendbaren Rechts Anwendung finden kann.13 Gerade der scheinbar so deutlich formulierte Anwendungsbereich der Rating-Verordnung gibt bei näherer Betrachtung Probleme auf.14 Die Haftungsvoraussetzungen des zivilrechtlichen Haftungstatbestandes stellen den Rechtsanwender ebenfalls vor eine nicht geringe Anzahl rechtlicher wie auch tatsächlicher Probleme.15
Bevor ein deutscher Kläger Ansprüche – sei es nach Maßgabe der Rating-Verordnung oder nach nationalen Regelungen – gegen eine im Ausland ansässige Ratingagentur geltend machen kann, sieht er sich mit den Regelungen des Internationalen Zivilverfahrens- und Privatrechts konfrontiert. Ziel dieser Arbeit ist, zu zeigen, dass eine Klage gegen ausländische Ratingagenturen nicht erst seit dem Urteil des BGH von Dezember 2012 möglich ist. Es ist in Teil C. darzustellen, dass mit den Regelungen des europäischen sowie deutschen Zuständigkeitsrechts eine Klage vor deutschen Gerichten gegen ausländische Ratingagenturen in diversen Sachverhaltskonstellationen möglich ist und dabei nicht nur einer, sondern regelmäßig mehrere Gerichtsstände eröffnet sein werden.
Ist eine Klage vor deutschen Gerichten zulässig, wird ein deutscher Kläger wohl auch regelmäßig die Anwendung deutschen Rechts – als ihm vertraute ← 2 | 3 → Rechtsordnung – anstreben.16 Ein weiteres Ziel dieser Arbeit ist daher, zu erörtern, unter welchen Voraussetzungen und nach Maßgabe welcher Normen dies möglich ist. In Teil D. wird diesem Ziel Rechnung getragen.
Zum Zwecke der Darstellung dieser erklärten Ziele werden die verschiedenen möglichen Rechtsverhältnisse betrachtet. Als solche kommen die Rechtsverhältnisse Ratingagentur/Unternehmen, Ratingagentur/Staat sowie Ratingagentur/privater Anleger in Betracht.17 Darüber hinaus ist auch noch ein wettbewerbsrechtliches Verhältnis zwischen zwei Ratingagenturen möglich.18 Dieses wird jedoch keinen Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit darstellen.
Keinen Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit bildet darüber hinaus die Frage, ob und wie Ratingagenturen außerhalb bzw. neben der Rating-Verordnung für fehlerhafte Ratings haften. Diese Frage ist nur durch die Erörterung nationaler Haftungsgrundlagen zu beantworten. Mit dieser Arbeit werden ausschließlich die international zivilprozessualen und privatrechtlichen Anforderungen aufgezeigt, die ein geschädigtes Unternehmen oder ein geschädigter privater Anleger erfüllen muss, um eine Klage vor deutschen Gerichten und nach Maßgabe des deutschen Rechts anstrengen zu können. Damit wird insbesondere die Frage, ob die Ratingagenturen letztendlich für die Schäden der jeweiligen Betroffenen nach Maßgabe des deutschen Rechts einzustehen haben, nicht beantwortet. Probleme des nationalen materiellen Rechts sind kein Gegenstand dieser Arbeit.19
Die Fälle, in denen es tatsächlich um die Frage der Klage gegen eine außereuropäische Ratingagentur geht, dürften künftig an praktischer Relevanz verlieren. Nicht zuletzt aufgrund der erst kürzlich wesentlich überarbeiteten Vorgaben der Rating-Verordnung unterhalten die marktführenden Ratingagenturen allesamt Tochtergesellschaften in den EU-Mitgliedstaaten, die dort grundsätzlich eigenständig und eigenverantwortlich für europäische Unternehmen Ratings erstellen.20 Das heißt, obgleich eine Ratingagentur zum Konzern einer US-amerikanischen Ratingagentur gehört, stellt sie eine deutsche Ratingagentur dar. Wenn also beispielsweise Moody’s Deutschland GmbH als eigenständige ← 3 | 4 → Ratingagentur ein Rating erstellt und ein deutscher Kläger sich gegen dieses Rating wendet, ist der Frage eines grenzüberschreitenden Bezugs besondere Beachtung zu schenken. So können sich die Themen des Internationalen Zivilverfahrens- und Privatrechts auch in zunächst scheinbar reinen Inlandssachverhalten stellen.
Verklagt also ein deutscher Kläger die Tochtergesellschaft einer ausländischen Ratingagentur in ihrer Funktion als eigenständige deutsche Ratingagentur, so ist der grenzüberschreitende Bezug etwa dann gegeben, wenn Gerichtsstands- oder Rechtswahlklauseln zugunsten eines ausländischen Rechts bestehen.21 Sofern in vorliegender Arbeit von einer solchen Konstellation ausgegangen wird, wird dies im Text entsprechend kenntlich gemacht. In allen anderen Fällen meint der Begriff „Ratingagentur“ eine im Ausland ansässige Ratingagentur, mithin keine deutsche Tochtergesellschaft einer eben solchen Ratingagentur.
Jedoch wird es auch zukünftig Fälle geben, in denen ein Rating von einer beispielsweise US-amerikanischen Ratingagentur abgegeben wurde bzw. die US-amerikanische Muttergesellschaft verklagt werden soll, etwa weil die europäische Tochtergesellschaft nur als Stellvertreter fungierte. Die Lösung jener Fälle, im Hinblick auf die Probleme des Internationalen Zivilverfahrens- und Privatrechts, ist Anliegen dieser Arbeit.
_________
1 Siehe unten A.III.2.a).
2 Siehe unten A.III.2.b) sowie zum privaten Anleger unten A.VIII.3.
3 Siehe unten A.III.2. und A.VIII.
4 BGH, Beschl. v. 13.12.2012, III ZR 282/11, NJW 2013, 386.
5 Zum Sachverhalt m.w.N. siehe unten A.VII.4.
6 Siehe etwa Amort, NZG 2013, 859; ohne Autor, Handelsblatt Online v. 16.01.2013, Anleger können in Deutschland gegen Ratingagenturen klagen; Beecken, Frankfurter Rundschau-online v. 17.01.2013, Klagen gegen Standard & Poor’s zulässig.
7 Siehe sogleich unten A.III.1.
8 Zur Historie des Ratingmarktes und zu fehlerhaften Ratings siehe unten A.IV. sowie A.V.
9 Siehe unten A.II.3. und A.IV. sowie B.
10 VO (EG) Nr. 1060/2009, geändert durch VO (EU) Nr. 513/2011, RL 2011/61/EU und VO (EU) Nr. 462/2013 sowie RL 2014/51/EU.
11 Zur Rating-Verordnung siehe unten A.II.3. und B.
12 Deipenbrock, WM 2013, 2289, 2290.
Details
- Pages
- XXII, 299
- Publication Year
- 2015
- ISBN (Softcover)
- 9783631669785
- ISBN (PDF)
- 9783653061130
- ISBN (MOBI)
- 9783653954562
- ISBN (ePUB)
- 9783653954579
- DOI
- 10.3726/978-3-653-06113-0
- Language
- German
- Publication date
- 2015 (August)
- Keywords
- Gerichtsstände Ratingagentur Rating-Verordnung Abonnementvertrag Ratingvertrag
- Published
- Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2015. XXII, 299 S.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG