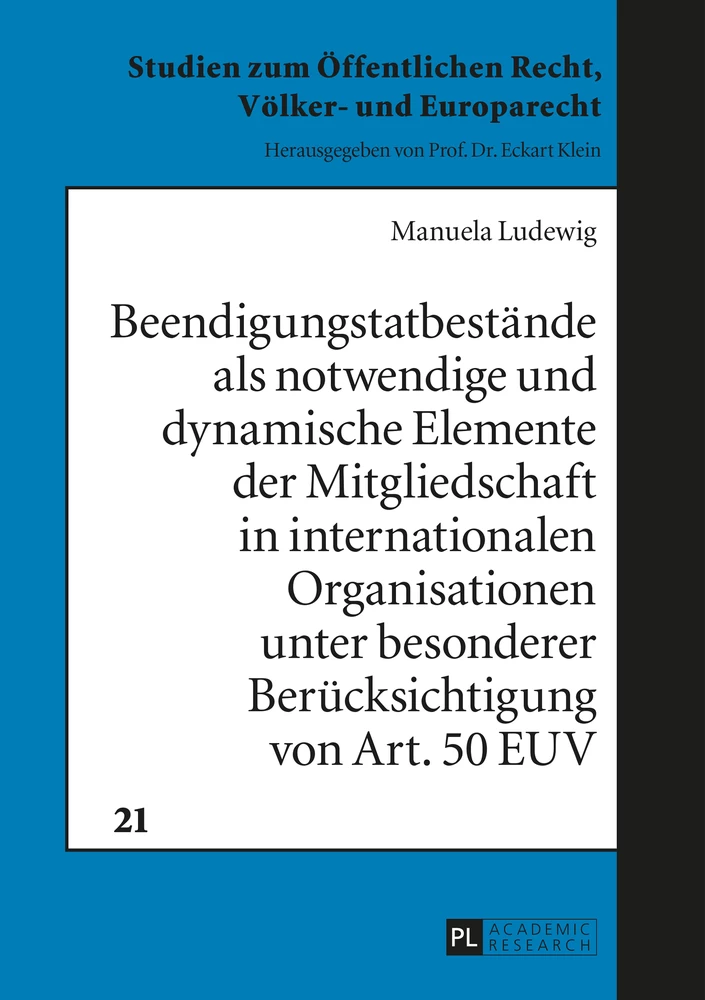Beendigungstatbestände als notwendige und dynamische Elemente der Mitgliedschaft in internationalen Organisationen unter besonderer Berücksichtigung von Art. 50 EUV
Summary
Excerpt
Table Of Contents
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Abkürzungsverzeichnis
- A. Einleitung
- I. Ausgangspunkt
- II. Problemstellung
- III. Gang der Untersuchung
- B. Grundlagen
- I. Das mitgliedschaftliche Rechtsverhältnis
- II. Der Begriff des Beendigungstatbestandes
- III. Die Arten von Beendigungstatbeständen
- 1. Der Austritt
- a) Der Begriff des Austritts
- b) Die Abgrenzung zu anderen Erscheinungsformen
- i. Der Ausschluss
- ii. Die Nichtannahme einer Änderung des Gründungsvertrages
- iii. Die partielle Bindung
- 2. Der Ausschluss
- a) Der Begriff des Ausschlusses
- b) Die Abgrenzungen zu anderen Erscheinungsformen
- i. Die Sanktionen
- ii. Die Suspendierung
- 3. Der Untergang eines Mitglieds
- 4. Die Auflösung der Organisation
- IV. Das Funktionspotential von Beendigungstatbeständen
- C. Die völkerrechtlichen Beendigungstatbestände als notwendige und dynamische Elemente der Mitgliedschaft in internationalen Organisationen
- I. Der normative Rahmen völkerrechtlicher Beendigungstatbestände
- 1. Die Beendigungstatbestände des partikulären Völkerrechts
- a) Die Austrittsklauseln in Gründungsverträgen
- i. Die Häufigkeit von Austrittsklauseln und Austritten
- ii. Die Voraussetzungen der Austrittsklauseln
- (1) Die Austrittserklärung
- (2) Der Fristablauf vor Abgabe der Austrittserklärung
- (3) Der Fristablauf nach Abgabe der Austrittserklärung
- (4) Die Erfüllung von Verpflichtungen
- b) Die Ausschlussklauseln in Gründungsverträgen
- i. Die Voraussetzungen der Ausschlussklauseln
- ii. Das Ausschlussverfahren
- 2. Die Beendigungstatbestände des allgemeinen Völkerrechts
- a) Das Völkervertragsrecht: Die Wiener Vertragsrechtskonventionen
- i. Die Anwendbarkeit der WVK auf Gründungsverträge internationaler Organisationen
- ii. Die Regelungssystematik der WVK bezüglich des Fortfalls der Vertragsbindung
- b) Der Austritt aus dem Gründungsvertrag
- i. Art. 56 WVK
- (1) Anwendbarkeit
- (2) Voraussetzungen
- (a) Die Absicht der Vertragsparteien, Art. 56 Abs. 1 lit. a WVK
- (b) Die Natur des Vertrages, Art. 56 Abs. 1 lit. b WVK
- (3) Verfahren
- ii. Art. 62 WVK
- (1) Anwendbarkeit
- (2) Voraussetzungen
- (3) Verfahren
- c) Der Ausschluss eines Mitglieds gem. Art. 60 Abs. 2 lit. a WVK
- i. Anwendbarkeit
- (1) Der Anwendungsausschluss von Gegenmaßnahmen
- (2) Die spezielle Subsidiaritätsklausel des Art. 60 Abs. 4 WVK
- (3) Art. 60 Abs. 5 WVK und ius cogens
- ii. Die Voraussetzung der „erheblichen Vertragsverletzung“
- iii. Die Beschränkungen der Rechtsausübung
- (1) Das Verhalten der vertragstreuen Partei
- (2) Der Verlust des Rechts
- (3) Die Verhältnismäßigkeit
- iv. Verfahren
- d) Völkergewohnheitsrecht
- e) Allgemeine Rechtsgrundsätze
- 3. Zusammenfassung
- II. Die Beendigungstatbestände als notwendige Elemente der Mitgliedschaft
- 1. Die Notwendigkeit des Austrittstatbestandes
- 2. Die Notwendigkeit des Ausschlusstatbestandes
- 3. Die normative Umsetzung der notwendigen Wirkung
- a) Austrittstatbestände
- i. Institutionalisierung der Austrittsmöglichkeit
- ii. Beschränkung der Austrittsmöglichkeit
- iii. Prozeduralisierung des Austrittsverfahrens
- b) Ausschlusstatbestände
- i. Institutionalisierung der Ausschlussmöglichkeit
- ii. Beschränkung der Ausschlussmöglichkeit
- iii. Prozeduralisierung des Ausschlussverfahrens
- III. Die Beendigungstatbestände als dynamische Elemente der Mitgliedschaft?
- 1. Dynamik aufgrund der Möglichkeit der Mitgliedschaftsbeendigung
- a) Instrumentalisierung des Austrittsrechts
- b) Instrumentalisierung des Ausschlussrechts
- 2. Dynamik aufgrund der Verwirklichung des Beendigungstatbestandes
- a) Beendigung der Mitgliedschaft des unfähigen Mitglieds
- b) Beendigung der Mitgliedschaft des dem Organisationszweck widersprechenden Mitglieds
- 3. Die normative Umsetzung der dynamischen Wirkung
- IV. Zusammenfassung
- D. Der Austrittstatbestand als notwendiges und dynamisches Element der Mitgliedschaft in der Europäischen Union?
- I. Die Frage nach der Mitgliedschaftsbeendigung im Spiegel verfassungsrechtlicher Krisen der Union
- 1. Frankreichs „Politik des leeren Stuhls“
- 2. Referendum in Großbritannien
- 3. Das Ausscheiden Grönlands als bisher einzige Verkleinerung der Union
- 4. Referenda in Dänemark
- 5. Würdigung
- II. Funktionspotential im integrationspolitischen Kontext?
- 1. Potentielle Notwendigkeit im integrationspolitischen Kontext
- a) Notwendigkeit des Austrittstatbestands aufgrund der Unsicherheit über das Bestehen eines Austrittsrechts im EG/EU-Recht
- i. Auf Grundlage von Europarecht
- ii. Auf Grundlage von Völkerrecht
- (1) Art. 56 WVK
- (2) Art. 60 WVK
- (3) Art. 61 WVK
- (4) Art. 62 WVK
- (5) Bestehen einer Rückgriffsmöglichkeit auf das Völkerrecht?
- (a) Integrationsrechtliche Sicht
- (b) Völkerrechtliche Sicht
- (6) Streitentscheid
- b) Notwendigkeit des Austrittstatbestands aufgrund einer „Waffengleichheit“ i.V.m. Sanktionen gem. Art. 7 EUV?
- c) Würdigung
- 2. Potentielle Dynamik im integrationspolitischen Kontext?
- a) Potentielle Dynamik aufgrund der Existenz von Art. 50 EUV
- b) Potentielle Dynamik durch die (Teil-)Verwirklichung von Art. 50 EUV
- III. Der normative Rahmen für den Austritt eines Mitgliedstaates aus der Europäischen Union
- 1. Entstehungsgeschichte: Art. 50 EUV als Novität im europäischen Vertragsrecht
- a) Das Austrittsrecht und der Verfassungskonvent
- i. Art. 46 des Vorentwurfs und die Austrittsdebatte im Konvent
- (1) Änderungsvorschläge in Bezug auf materiell-rechtliche Voraussetzungen des Austritts
- (2) Änderungsvorschläge in Bezug auf verfahrensrechtliche Voraussetzungen des Austritts
- (3) Änderungsvorschläge in Bezug auf die Rechtsfolgen des Austritts
- ii. Das Ergebnis des Konvents: Art. 59 VVE
- iii. Zusammenfassung: Entwicklung des Austrittsrechts im Konvent
- b) Die Regierungskonferenz und Art. I-60 EVV
- c) Das Scheitern des Verfassungsvertrages und der Lissabonner Reformprozess
- d) Würdigung
- i) Erleichterung des Beitritts für die neuen Mitgliedstaaten
- ii) Anwendung der Konventsmethode
- iii) Einfluss der Bewerberländer im Rahmen der Konventsdebatte
- 2. Der Austrittstatbestand des Art. 50 EUV
- a) Systematische Stellung
- b) Materiell-rechtliche Voraussetzungen?
- i. Die Einhaltung von Verfassungsvorschriften
- ii. Der Abschluss eines Austrittsabkommens
- c) Einschränkungen der Rechtsausübung
- i. Verfahrenspflichten gem. Art. 50 EUV
- (1) Mitteilungspflicht
- (2) Verhandlungspflicht
- ii. Verfahrenspflichten aufgrund unionsrechtlicher Solidaritäts- und Loyalitätspflichten
- (1) Konsultationspflicht
- (2) Begründungspflicht
- (3) Abschlusspflicht
- iii. Integrativer Charakter der Union und unbegrenzte Vertragsdauer
- iv. Zwischenergebnis
- d) Der Ablauf des Austrittsverfahrens
- i. Der Austritt mit Austrittsabkommen
- (1) Beschluss des Mitgliedstaates, aus der Union auszutreten
- (2) Austrittserklärung
- (3) Leitlinien des Europäischen Rates
- (4) Verhandlungen über das Austrittsabkommen
- (5) Rechtsnatur und Inhalt des Austrittsabkommens
- (a) „Einzelheiten des Austritts“
- (b) „zukünftige Beziehungen“ zur Union
- (6) Annahme des Austrittsabkommens
- (7) Rechtskontrolle durch den EuGH
- ii. Der Austritt ohne Austrittsabkommen
- iii. Wirksamwerden des Austritts
- iv. Rechtsfolgen des Austritts
- v. Wiedereintritt nach Austritt
- 3. Partieller Austritt aus der Europäischen Währungsunion?
- a) Partieller Austritt aus der Währungsunion auf europarechtlicher Grundlage
- i. Die Verwirklichung der Wirtschafts- und Währungsunion
- ii. Art. 50 EUV als Rechtsgrundlage für einen partiellen Austritt
- iii. Gegenargumentation
- (1) Einheitlichkeit der Mitgliedschaft
- (2) Unterschiedlichkeit der Beitrittsvoraussetzungen
- (3) Verstoß gegen den Grundsatz von der Unumkehrbarkeit der WWU
- (4) Keine vertragliche Notwendigkeit eines partiellen Austrittsrechts
- iv. Streitentscheid
- b) Partieller Austritt aus der Währungsunion aufgrund völkerrechtlicher Kündigungsgründe
- i. Anwendbarkeit völkerrechtlicher Kündigungsgründe
- ii. Der völkerrechtliche Austrittstatbestand
- iii. Teilungspotential i.S.v. Art. 44 WVK
- c) Zwischenergebnis
- IV. Art. 50 EUV als notwendiges Element der Unionsmitgliedschaft
- 1. Institutionalisierungsfunktion
- 2. Beschränkungsfunktion
- 3. Prozeduralisierungsfunktion
- a) Der Austritt ohne Austrittsabkommen und der Sunset-clause
- b) Der Austritt mit Austrittsabkommen
- i. Die inhaltliche Determinierung des Austrittsabkommens durch Art. 50 EUV
- ii. Der Abschluss und das Zustandekommen des Austrittsabkommens
- iii. Der Zeitplan zur Verwirklichung des Austritts
- iv. Die Aufnahme weiterer prozeduralisierender Bestimmungen?
- (1) Die rechtliche Verantwortung des Austrittsstaates
- (2) Die Einführung einer Wartezeit vor Wiedereintritt
- (3) Vorkehrungen für die Änderung der primärrechtlichen Verträge
- (4) Der Austritt von Eurostaaten
- c) Zwischenergebnis
- V. Art. 50 EUV als dynamisches Element der Unionsmitgliedschaft
- 1. Die dynamische Instrumentalisierung von Art. 50 EUV
- a) Die rechtspolitische Diskussion
- i. Legitimationssteigerung
- ii. Beitrittswilligkeit
- iii. Abschreckung
- iv. Integrationsschub
- b) Die konstitutionenökonomische Diskussion
- i. Gegendruck zu Zentralisierung
- ii. Symmetrie
- 2. Dynamik durch die Verwirklichung des Art. 50 EUV?
- a) Der Austritt des integrationsunwilligen Mitglieds
- b) Der Austritt des (partiell) unfähigen Mitglieds
- VI. Das Gefahrenpotential eines unionsrechtlichen Austrittstatbestands
- 1. Die Gefahren in Bezug auf die Verwirklichung des Austritts
- 2. Die Gefahren infolge der Instrumentalisierung des Austrittsrechts
- 3. Die Gefahren infolge des Bestehens eines Austrittsrechts
- a) Identitätsverlust?
- b) Integrationsrechtlicher Paradigmenwechsel?
- VII. Abschließende Bewertung
- 1. Bewertung der Verwirklichung des Austrittstatbestands des Art. 50 EUV
- 2. Bewertung der Existenz des Rechts zum Austritt gem. Art. 50 EUV
- E. Die Implikationen des Art. 50 EUV für das Funktionspotential einer Ausschlussklausel
- F. Schluss
- Literaturverzeichnis
Internationale Organisationen sind aufgrund ihrer fundamentalen Bedeutung für die internationale Zusammenarbeit aus dem gegenwärtigen völkerrechtlichen Verkehr nicht mehr wegzudenken.1 Der Erfolg der internationalen Organisationen ist zu einem großen Teil darauf zurückzuführen, dass sie „dynamische“ Völkerrechtssubjekte sind.2 Dies bedeutet einerseits, dass sie von den hinter ihnen stehenden Rechtspersonen nach Belieben zu den verschiedensten Zwecken gegründet werden können und ihre Tätigkeitsfelder daher so vielseitig sind, dass sie sich auf alle Gebiete menschlichen Wirkens erstrecken.
Andererseits können internationale Organisationen wieder aufgelöst werden und ihr Mitgliederbestand kann sich verändern, weil es jederzeit zu einem Mitgliederzuwachs oder zu einem Mitgliederschwund kommen kann.
Im Gegensatz zum Mitgliederzuwachs durch die Aufnahme neuer Mitglieder ist die Notwendigkeit von Mitgliedschaftsbeendigungen für die Existenz und den Fortschritt der Organisation nicht evident. Vielmehr wird darin eine immanente Gefahr für die Verwirklichung des Organisationszwecks gesehen. Trifft der entsprechende Gründungsvertrag in Bezug auf Mitgliedschaftsbeendigungen keine präzisen Aussagen, wird meist auch die Frage ihrer Rechtmäßigkeit hoch umstritten und von einem Spannungsverhältnis zwischen staatlichem Souveränitätskonzept und Internationalisierung der Rechtsordnung geprägt sein.3 Dies traf bis vor Kurzem auch auf die EG/EU zu.
Der Lissabonner Reformprozess brachte eine Neuerung mit sich, die obwohl sie einen jahrzehntelang geführten Meinungsstreit beendete in der Öffentlichkeit weitgehend unbeachtet blieb.4 Mit Einführung des Art. 50 EUV in der Fassung des Vertrages von Lissabon5 haben Mitgliedstaaten zum ersten Mal in der Geschichte der europäischen Integration ein Recht zum einseitigen Austritt aus der Union.
Das Austrittsrecht war bereits im 2004 gescheiterten Verfassungsvertrag enthalten, dessen Vertragstext erstmals im Wege der sogenannten Konventsmethode ← 1 | 2 → entstand. Die Einfügung der Austrittsregelung war im Konvent heftig umstritten gewesen. In einigen der zwölf neuen Mitgliedstaaten, die in den Jahren 2004 und 2007 der Europäischen Union beigetreten sind, wurde mit innenpolitischen Schwierigkeiten gerechnet, sollte der parallel zu den Beitrittsverhandlungen erarbeitete Verfassungsvertrag keine Austrittsklausel enthalten.6 Nach Scheitern des Verfassungsvertrages durch die ablehnenden Referenden in Frankreich und den Niederlanden, entschied man sich im Lissabonner Reformprozess zur Erhöhung der Akzeptanz europäischer Verträge und Institutionen für die Vermeidung jedweder staatlicher Elemente. Die Europäische Union sollte eine „normale“ internationale Organisation sein, jedenfalls soweit, als die Mitgliedschaft auf Freiwilligkeit beruht.7 Auch die Austrittsklausel des Verfassungsvertrages wurde in den Vertrag von Lissabon übernommen.
Es verwundert nicht, dass in der bisherigen Erfolgsgeschichte der europäischen Integration die Normierung eines Austrittsrechts keine Priorität hatte. Die Europäische Union unterscheidet sich von normalen internationalen Organisationen der völkerrechtlichen Praxis erheblich. Sie ist eine Integrationsgemeinschaft, deren entscheidendes Merkmal der weitgehende staatliche Souveränitätsverlust ihrer Mitglieder ist.8 Daraus resultierten über ein halbes Jahrhundert Frieden und Wohlstand für Europa.
Art. 50 EUV unterstreicht indessen die staatliche Souveränität und bestärkt eine neue Finalitätsdebatte. Das Bundesverfassungsgericht sah sich aufgrund von Art. 50 EUV dazu veranlasst, das Rechtsverhältnis zwischen Union und Mitgliedstaaten kontraktuell zu deuten.9 Der Staatenverbund sei nunmehr eine „Vertragsunion souveräner Staaten“10. Die Norm des Art. 50 EUV und ein damit einhergehendes kontraktuelles Verständnis der Europäischen Union weichen aus Sicht des Europarechts eklatant von den in der Präambel und in Art. 1 EUV enthaltenen Vertragszielen ab, aus denen sich ein integrativer Charakter des Europarechts ergibt. Die Beendigung der Unionsmitgliedschaft scheint somit in einem immanenten Widerspruch zur Integration als Quasi-Geschäftsgrundlage der Europäischen Union zu stehen.
Von einer Norm wie Art. 50 EUV geht ferner ein erhöhtes Gefahrenpotential für die Stabilität der Gemeinschaft aus. Dabei ist es insbesondere der Erfolg der EU, welcher dieser Gefahr zugrunde liegt. Die Organisation befindet sich in einem Prozess sich erweiternder Integration, der durch eine zunehmende Übertragung von Hoheitsrechten gekennzeichnet ist. Durch den Vertrag von Lissabon vermehren sich diejenigen Politikfelder, in denen Entscheidungen nach dem Prinzip der ← 2 | 3 → qualifizierten Mehrheit getroffen werden. Auch die politischen und wirtschaftlichen Verbindungen der Mitgliedstaaten werden dadurch immer enger. Unter diesen Bedingungen erhöht die erklärte Zielsetzung der Union, neue Mitgliedstaaten aufzunehmen, nicht nur bereits bestehende Spannungen.11 Auch der gegenwärtige wirtschaftliche Kontext wird von Europakritikern genutzt, um die Frage der Mitgliedschaftsbeendigung für sich zu instrumentalisieren.
Im Gegensatz zum Europarecht stellt das Völkerrecht im Rahmen der Mitgliedschaft in internationalen Organisationen die Notwendigkeit von Beendigungstatbeständen wie Austritt und Ausschluss nicht grundsätzlich in Frage, sondern erkennt sie als Rechte souveräner Staaten in den meisten Fällen an. Obwohl durch Mitgliedschaftsbeendigungen mannigfaltige praktische, finanzielle und rechtliche Probleme entstehen, können sowohl die Realisierung als auch die bloße Existenz von Beendigungstatbeständen dazu beitragen, dass die Organisation ihren status quo aufrecht erhält oder sogar ihre durch den Gründungsvertrag gesetzten Ziele effektiver verwirklicht. Diese unter Umständen zweckdienlichen Eigenschaften von Beendigungstatbeständen werden im Rahmen der Untersuchung als „notwendige“ und „dynamische“ Elemente bezeichnet.
Es stellt sich die Frage, inwiefern derartige für normale internationale Organisationen geltende Überlegungen in Bezug auf die Notwendigkeit und Dynamik von Beendigungstatbeständen auch für eine supranationale Organisation wie die Europäische Union zutreffen.
Welche Bedeutung haben die letztlich doch unauffällige Norm des Art. 50 EUV im Besonderen sowie Beendigungstatbestände im Allgemeinen für den europäischen Integrationsprozess? Stellen sie insbesondere im gegenwärtigen politischen und wirtschaftlichen Kontext eine grundlegende Gefährdung oder aber eine Chance für das europäische Projekt dar? Sind sie notwendige oder sogar dynamische Elemente der Mitgliedschaft?
In einem ersten grundlegenden Teil wird beschrieben, was im Rahmen der Untersuchung unter den Begriffen „Mitgliedschaft“ und „Beendigungstatbestände“ sowie „notwendiger“ und „dynamischer“ Wirkung zu verstehen ist.
Details
- Pages
- XXI, 384
- Publication Year
- 2015
- ISBN (Hardcover)
- 9783631658413
- ISBN (PDF)
- 9783653050622
- ISBN (MOBI)
- 9783653974836
- ISBN (ePUB)
- 9783653974843
- DOI
- 10.3726/978-3-653-05062-2
- Language
- German
- Publication date
- 2015 (February)
- Keywords
- Völkerrecht europäische Währungsunion Austritt aus der Europäischen Union Europarecht
- Published
- Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2015. XXI, 384 S.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG