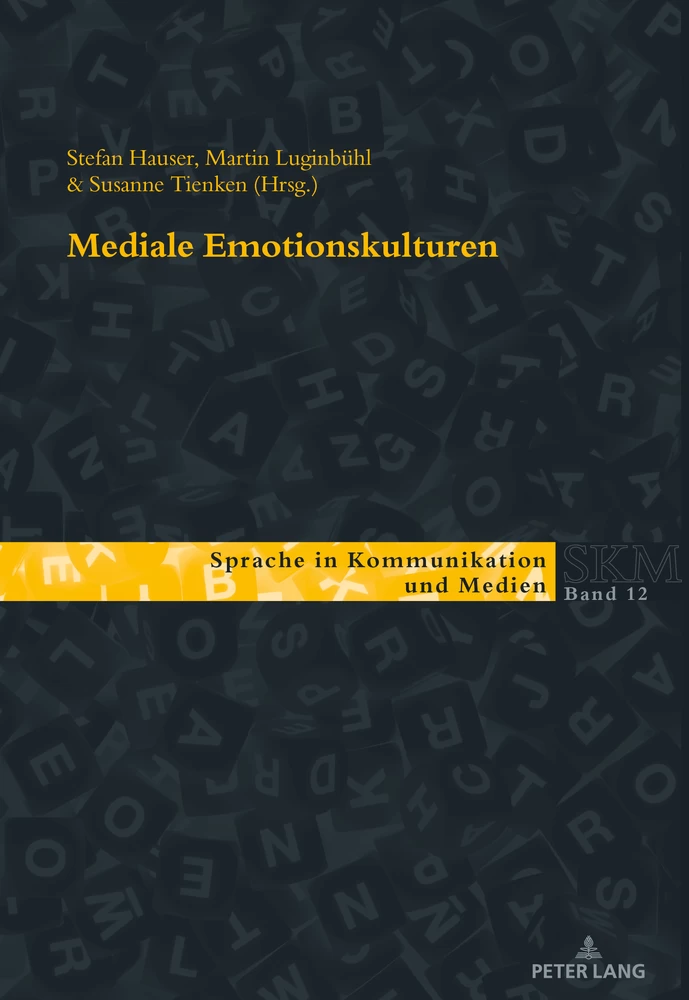Mediale Emotionskulturen
Summary
Excerpt
Table Of Contents
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autoren-/Herausgeberangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Inhaltsverzeichnis
- «Mediale Emotionskulturen»
- Mediale Emotionskulturen. Einführende Bemerkungen (Stefan Hauser / Martin Luginbühl / Susanne Tienken)
- „Lassen nicht ausreden, hören nicht zu, unsachlich, emotional….. Wahnsinnig schlecht, ich möchte abschalten!!!!“ Emotion und emotional in Wissenschaftssprache und Alltagsdiskurs (Georg Albert)
- Die Spur der Gefühle – Kulturanalytische Überlegungen zum emotionalen Wert der Handschrift (Andi Gredig)
- Zwischen Hatespeech und Deliberation: affektive Öffentlichkeiten und politische Kommunikation in den sozialen Medien (Hans-Jürgen Bucher / Christof Barth)
- Emotionalisierung in TV-Wissensdokus. Eine multimodale Analyse englischer und deutscher archäologischer Sendungen (Sylvia Jaki)
- Über Nachrichten reden, „aber hart!“ Emotionalisierung, multimodale Inszenierung und kommunikative Aneignung von Nachrichtentexten in Videoblogs auf YouTube (Daniel Pfurtscheller)
- Von Schafen im Wolfspelz – Shitstorms als Symptome einer medialen Emotionskultur (Konstanze Marx)
- mitfiebern – Mediatisierte emotionale Kommunikationspraktiken in Fußball-Livetickern und Livetweets (Simon Meier)
- #RIP – kollektive Fan-Trauer auf Twitter (Karina Frick)
- «Und hab total den Heulanfall bekommen » – Emotionskulturen im Netz am Beispiel der Selbsthilfeplattform <www.hungrig-online.de> (Sandra Reimann)
- Reihenübersicht
Mediale Emotionskulturen. Einführende Bemerkungen
1. Sprache, Emotion und Medien
Die Art und Weise, wie Emotionen zur Darstellung gebracht und in öffentlichen Zusammenhängen zu einem diskursiv relevanten Gegenstand gemacht werden, kennt historisch gesehen eine breite Palette an medialen Verfahrensweisen (vgl. Althoff 1996, Bösch/Borutta 2006, Ciompi/Endert 2011, Elias 1976, Linke 2001). Ob und inwiefern sich die Entwicklungen der jüngeren Zeit als Ausdruck einer neuen medialen Emotionskultur verstehen lassen, die sich kategorial von bisherigen Praktiken der Darstellung von Emotionen unterscheidet, oder ob es sich um eine Fortführung mit teilweise anderen Mitteln handelt, ist der Ausgangspunkt für die Beiträge dieses Sammelbands.
Als Zeichen einer solchen neuen medialen Emotionskultur könnten beispielsweise Casting- und Dating-Shows, die multimodale Narrativierung in der Nachrichten-Berichterstattung in den traditionellen Medien sowie aber auch ein erhöhtes Ausleben und Display von Emotionen etwa in Selbsthilfe-Onlineforen, Sport-Livetickern oder Trauertweets gelten. Auch am Beispiel von Phänomenen wie Shitstorms oder Cybermobbing sind Aspekte einer medialen Emotionskultur erkennbar, die als Indikatoren – oder gegebenenfalls auch als Katalysatoren – einer neuen medialen Emotionskultur verstanden werden könn(t)en. Dabei sind höchst unterschiedliche sprachliche und soziale Praktiken der Emotionalisierung (wie Abwertung, Übertreibung, Vorwurf, Sarkasmus, Ironie, Zuspitzung, Mobilisierung etc.) beobachtbar, die aus kulturanalytisch-medienlinguistischer Perspektive die Frage aufwerfen, inwiefern diese Phänomene als Ausdruck einer neuartigen medialen Emotionskultur zu werten sind. Die Aufsätze des vorliegenden Sammelbands sollen einen Beitrag zu dieser Diskussion leisten. ← 9 | 10 →
2. Mediale Emotionskulturen
Was den Zusammenhang von Sprache und Emotion betrifft, hat man sich in der Linguistik zunächst mit der Frage beschäftigt, welche sprachlichen Formen für den Ausdruck von Emotionen zur Verfügung stehen (Marty 1908, Ochs/Schieffelin 1989, Fussell 2002)1. Sprache und Emotion sind schließlich in verschiedenen linguistischen Teildisziplinen thematisiert worden, etwa im Bereich der Semantik (Wierzbicka 1999), der kognitiven Linguistik (Schwarz-Friesel 2007) oder der Gesprächsforschung (Fiehler 2002, 2008).
In der traditionellen Medienlinguistik, welche sich journalistische Massenmedien zum Gegenstand macht, spielen Emotionen vor allem im Kontext der Diskussion um die Emotionalisierung der Berichterstattung eine Rolle (Burger/Luginbühl 2014), wobei damit in der Regel emotionale Aspekte fokussierende Darstellungsformen gemeint sind. Ein analytisches Problem bleibt in diesem Zusammenhang, dass die Rede von der Emotionalisierung insinuiert, dass die mediale Darstellung ‚emotionaler‘ als das berichtete, außermediale Ereignis ist. Inwiefern dies aber der Fall ist und vergleichbare Berichte nicht einfach emotionale Aspekte ausblenden, ist analytisch kaum überprüfbar. Theoretisch wird das Konzept der Emotionalisierung in der deutschsprachigen Medienlinguistik höchstens am Rande diskutiert, meist im Kontext des Begriffs Infotainment (Wittwen 1995, Greule/Burghardt 2002, Santulli 2012, Weidner 2017).
In medienlinguistischen Arbeiten zu „neuen“ Medien sind Aspekte wie Display und Aushandlung von Emotion(en) in letzter Zeit stärker in den Fokus gerückt (z.B. Langlotz/Locher 2012). Im Zentrum rezenter Arbeiten steht die Frage, mit welchen sprachlichen Ressourcen Emotionen in einem digitalen Forum schriftlich zum Ausdruck gebracht werden (z.B. durch konzeptuelle Implikation, expliziten Ausdruck, emotionale Beschreibung). Hinzu kommen neuerdings Arbeiten, welche das Potenzial einer automatischen Erkennung von verbalen Beiträgen ausloten, die in Bezug auf Emotionen relevant sind (Sentimentanalyse, vgl. Ortner 2014, Liu 2015, Pozzi et al. 2017).
Erste Studien dieser Art zeigen also, inwiefern Emotionen in verschiedenen Medien als kommunikative Ressourcen eingesetzt oder überhaupt erst hervorgebracht werden. Zentral bleiben Fragen danach, welche Emotionen ← 10 | 11 → in welchen medialen Kontexten relevant gesetzt werden, ohne dass dabei ausschliesslich berichtend auf Emotionen Bezug genommen wird. In der soziologischen Theoriebildung wird angenommen, dass kulturelle Normen regulieren, welche Gefühle in welchen Situationen angemessen sind und welche Ausdrucksformen Emotionen haben können (Hochschild 1979, Gerhards 1988, Hochschild 1997). Unterschiedliche mediale Kontexte bedeuten immer auch unterschiedliche Situationen – und es ist deshalb unter dieser medialen Perspektive nach kulturellen Normen des Emotionalitätsausdrucks zu fragen.
Ziel dieses Sammelbandes ist es, an die oben erwähnten Fragestellungen anzuknüpfen, darüber hinaus aber den Fokus in doppelter Hinsicht zu erweitern: Erstens soll der These einer zur Zeit beobachtbaren Emotionskultur in ihrer ganzen Breite und Tiefe nachgegangen werden, zweitens soll dies mit einem Fokus auf die medialen Ausformungen dieser Kultur geschehen. Emotionskultur soll hier (vorläufig) als ein Phänomen verstanden werden, das sich durch eine intensivierte, aber z.T. auch qualitativ neuartige Ausgestaltung von emotional geprägten und emotional prägenden Praktiken auszeichnet. Wie die Beiträge zeigen, gestaltet sich ein Teil dieser emotionalen Praktiken innerhalb ganz spezifischer Medialitäten aus; damit sind die entsprechenden Praktiken an mediale Affordanzen (Gibson 1977, Pentzold/Fraas/Meier 2013, Tienken 2015) gebunden. Medien (hier verstanden als medial durchformte Formen der Zeichenprozessierung, vgl. Schneider 2017, Luginbühl i. Dr.) strukturieren kommunikative Praktiken vor, indem sie bestimmte Verwendungsweisen zur Verfügung stellen, gleichzeitig sind diese Praktiken aber auch als geronnene Muster konkreter Nutzungsformen zu verstehen, die auf dem Erkennen und Ausnutzen ganz bestimmter Handlungsmöglichkeiten basieren. Affordanzen sind somit nicht einfach durch ein Medium gegeben, es handelt sich immer um relationale Phänomene: Spezifische Möglichkeiten werden von Nutzenden erkannt und ausgewählt, die sie auf ganz bestimmte Art und Weise einsetzen und verstehen. Diese Nutzungen können sich dann auch wieder auf das Medium auswirken. Akzeptiert man diese Interdependenz von medialen Ermöglichungen und konkreter Nutzung, so sind grundsätzlich alle kommunikativen Praktiken und damit auch jegliche Verfahrensweisen des Emotionsdisplays immer medial durchformt; dasselbe gilt dann für Emotionskultur(en), die sich innerhalb spezifischer Medialitäten ausprägen – ohne dabei medial determiniert zu sein. Basierend auf diesen Überlegungen befassen sich die Beiträge des Sammelbands mit Fragen der folgenden Art: ← 11 | 12 →
• Wie lässt sich aus einer medienlinguistischen Makroperspektive das Phänomen medialer Emotionskulturen theoretisieren?
• Welche unterschiedlichen Formen von Emotionskulturen lassen sich unterscheiden?
• Wie lassen sich diese Formen einordnen bezüglich Vorstellungen wie „zunehmende Emotionskontrolle“, „(In)Formalisierung der Emotionen“, „Kommerzialisierung von Emotionen“ etc. und damit verbundenen Fragen nach Emotions- und Identitätskonzepten? Wichtig werden hier auch Fragen zum Verhältnis von sprachlichen zu bildlichen und musikalischen Zeichenressourcen
• Inwiefern entstehen neue emotionale Kommunikationspraktiken in den digitalen Medien als Folge neuer medialer Bedingungen und damit einhergehender Rekonfigurierungen bekannter Formen?
• Welche kulturwissenschaftlichen Deutungsansätze können genutzt werden, um mediale Emotionskulturen zu verstehen?
3. Zu den Beiträgen dieses Bandes
Georg Albert nähert sich der Thematik des Bandes vor allem aus lexikologischer Perspektive. Der Beitrag diskutiert zunächst unterschiedliche Definitionen von Emotion, Gefühl und Affekt in unterschiedlichen Disziplinen und schlägt eine terminologische Differenzierung vor, um der Kulturalität von Gefühlen und Gefühlsausdrücken analytisch gerecht werden zu können. In einer empirischen Studie von Online-Kommentaren zur Talkshow ‚Anne Will‘ zeigt Albert, dass Gefühl in positiv konnotierten Komposita erscheint, Emotion und emotional jedoch negativ konnotiert sind, was diskursiv besonders zur Diskreditierung vertretener Positionen eingesetzt wird.
Andig Gredig geht in seinem Beitrag der Frage nach dem emotionalen Mehrwert von Handschrift aus kulturanalytischer Perspektive nach. In einem ideengeschichtlichen Rückblick zeigt er, dass die Authentizität von Gefühlen mit der unmittelbaren Nachvollziehbarkeit des Körperausdrucks gleichzusetzen ist. Die Handschrift vermittelt nach Gredig als indexikalische Körperspur diese Unmittelbarkeit und Nähe, wobei neuere Entwicklungen ← 12 | 13 → in der Liebes- und Trauerkommunikation in sozialen Medien zeigen, dass auch maschinengeschriebene Formen zunehmend als angemessen wahrgenommen werden.
Hans-Jürgen Bucher und Christof Barth plädieren in ihrem Beitrag dafür, Emotionalisierungen als performative Diskurspraktiken in der politischen Kommunikation zu verstehen und zu beschreiben. In ihrer Analyse des Facebook-Profils der rechtspopulistischen Alternative für Deutschland zeichnen sie u.a. die diskursive Dynamik von Eskalation und die dazugehörigen Interaktionsmuster nach. Sie zeigen, dass sich die (weitgehend negativen) Emotionalisierungen jeweils auf einen bestimmten Gegenstand (z.B. Fahrerlaubnis für Geflüchtete, Angela Merkel etc.) beziehen. Dabei legen sie dar, dass sich die Äußerungen in den Posts nach emotionaler Valenz und Intensität spezifizieren lassen. Der häufig präsupponierte Dualismus von Deliberation bzw. Rationalität und Emotionalität erscheint daher im Kontext politischer Meinungsbildung obsolet.
Strategien der Emotionalisierung stehen auch im Beitrag von Silvia Jaki im Zentrum der Analyse. Anhand einer multimodalen Analyse von 8 populärwissenschaftlichen archäologischen Fernsehdokus (BBC und ZDF) arbeitet Jaki heraus, wie Sprache, Bild, Musik und Geräusche eingesetzt werden, um das Publikum nicht nur mit historischem Sachwissen zu versehen, sondern auch auf einer affektiven Ebene anzusprechen. Der Beitrag macht deutlich, dass dem Modus Sprache eine Vorrangstellung gegenüber den anderen Modi bei der Informationsübermittlung eingeräumt werden kann, dass jedoch Emotionen, insbesondere starke Emotionen wie Ekel oder Furcht durch den Gebrauch weiterer Modi evoziert werden.
Der Beitrag von Daniel Pfurtscheller befasst sich mit Praktiken der Emotionalisierung im YouTube-Nachrichtenkanal von LeFloid, der vor allem von Jüngeren genutzt wird. In einer qualitativen, multimodalen Analyse zeigt Pfurtscheller, wie emotionalisierende Verfahren bereits bei der Einbettung eines Videoblogs in die Online-Umgebung genutzt werden. Gemeinsam mit dem Titel sind Thumbnail-Bilder von Bedeutung, um zum Anklicken zu reizen. Ferner wird analysiert, wie die persönliche Ansprache des Publikums, Scherze und moralische Appelle den Kontext emotionaler Nähe und Verbindlichkeit herstellen und Nachrichtentexte quasi-narrativ rahmen. ← 13 | 14 →
Der Beitrag von Konstanze Marx beleuchtet das mediale Phänomen Shitstorm, das sich aus dem Zusammenwirken von Kommentaren zu Personen in sozialen Medien und boulevardjournalistischer Berichterstattung ergibt. Marx zeichnet zum einen den Aufbau von Shitstorms mit den typischen Elementen von Verspottung, Verunglimpfung, Gewaltandrohung und ständiger Redundanz nach, zeigt zum anderen aber auch, dass das Label Shitstorm erst in der sensationsorientierten Berichterstattung über die Interaktionen vergeben wird. Daraus ergeben sich die Generatoren für eine mediale Emotionskultur, in der Empörung, Beleidigung und Aggression sozialer Medien in traditionelle Medien nicht nur Eingang finden, sondern dort sogar aktiv perpetuiert werden.
Die Bedeutsamkeit von Communities für die Herausbildung von medialen Emotionskulturen tritt schließlich in den Beiträgen von Simon Meier, Karina Frick und Sandra Reimann deutlich hervor.
Simon Meier befasst sich Mitfiebern als mediatisierter, emotionaler kommunikativer Praktik in (Männer)Fußball-Livetickern und Livetweets. Die Analyse beider Gattungen zeigt, inwiefern expressive Elemente und Exklamativ-Konstruktionen sowie die Thematisierung von Emotionen eine indexikalische Funktion innehaben und zum einen den Kontext des Mitfieberns konstituieren, zum anderen die Positionierung in der Fußballfan-Community ermöglichen.
Karina Frick widmet sich der kollektiven Online-Trauer über den Tod von prominenten Personen auf Twitter. Anhand von Tweets anlässlich des Todes des Schauspielers Götz George legt Frick dar, welche Verbalisierungsmuster für kollektive Online-Trauer signifikant sind. In der Analyse zeigt Frick, dass #RIP sowie die Bezugnahme auf weitere Todesfälle im gleichen Jahr der (zeitlichen) Einordnung in einen allgemeinen Trauerdiskurs dient, die weitere Namensnennung dann das aktuelle Todesereignis zu spezifizieren vermag. Der Beitrag illustriert, dass einerseits auf herkömmliche Formen des Trauerausdrucks zurückgegriffen wird, andererseits ein kreativer Umgang mit Medienzitaten und Humor zu verzeichnen ist, was auf ein verändertes Angemessenheitsverständnis im Kontext von Tod und Trauer schließen lässt.
Sandra Reimann befasst sich mit dem Gebrauch von expressiven Sprachelementen in einem Selbsthilfe-Onlineforum für Patientinnen mit Magersucht. Der ← 14 | 15 → Beitrag zeigt, wie der Tagesverlauf oder einzelne Erlebnisse von Patientinnen im Forum beständig emotional evaluiert werden. Dies erfolgt zum einen über verbale Mittel, zum anderen aber auch über graphematische Mittel und Emojis. Reimann verweist schliesslich auf die Notwendigkeit einer interdisziplinären Zusammenarbeit von Sprachwissenschaft, Psychologie und Medizin, um Zusammenhänge zwischen expressivem Sprachgebrauch und Krankheitsentwicklung weiter zu untersuchen.
Details
- Pages
- 220
- Publication Year
- 2019
- ISBN (Softcover)
- 9783034336512
- ISBN (PDF)
- 9783034336703
- ISBN (ePUB)
- 9783034336710
- ISBN (MOBI)
- 9783034336727
- DOI
- 10.3726/b14988
- Language
- German
- Publication date
- 2019 (May)
- Keywords
- Sprache und Emotion Kulturanalytische Sprachwissenschaft Medienlinguistik Medialität Digitale Kommunikation
- Published
- Bern, Berlin, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 2019. 220 S., 26 farb. Abb., 5 Tab., 1Graf.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG