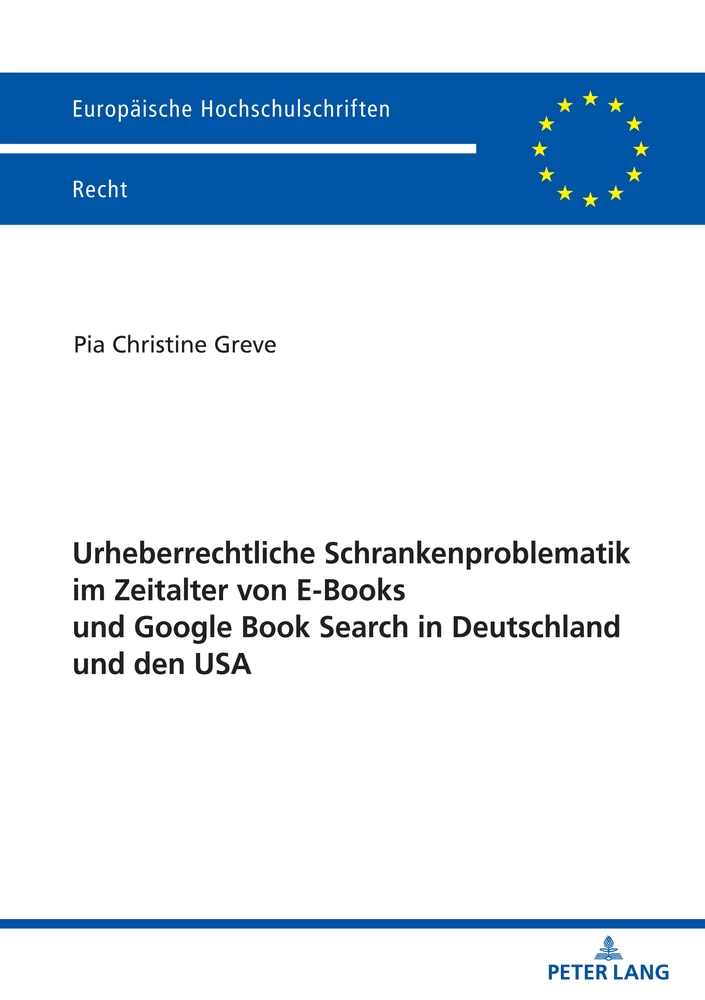Urheberrechtliche Schrankenproblematik im Zeitalter von E-Books und Google Book Search in Deutschland und den USA
Summary
Excerpt
Table Of Contents
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Vorwort
- Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- 1. Teil: Untersuchungsgegenstand
- 2. Teil: Problematik des Urheberrechts im digitalen Zeitalter
- I. Krise der Urheberrechtsschranken
- 1. Kurze Skizzierung von Lösungsansätzen
- 2. Wandlung zum Investitionsschutz?
- 3. Finanzielles (Nicht)Auskommen des Urhebers
- 4. Schutz der Urheberrechte / Schutz des Nutzers
- II. Geschichtliche und philosophische72 Entwicklung des Urheberrechts
- 1. Antike bis Spätmittelalter
- 2. Privilegienzeitalter
- 3. Gedanke des Verlagseigentums
- 4. Vorgehen gegen Plagiate
- 5. Konzepte zum Recht am immateriellen Gut bis zum Ende des 19. Jahrhunderts
- a) Philosophische Grundlagen
- b) Deutschland
- c) Europa
- d) International
- III. Verschiedene Rechtfertigungsbemühungen
- 1. Individualistische Rechtfertigung228
- a) Arbeits-basierte Rechtfertigung
- b) Persönlichkeits-basierte Rechtfertigung
- c) Werk-basierte Rechtfertigung
- d) Bewertung
- 2. Kollektivistische Rechtfertigung260
- a) Schranken-basierte Rechtfertigung
- b) Effizienz-basierte Rechtfertigung
- c) Demokratie-basierte Rechtfertigung
- 3. Universalistisch-transzendentale Rechtfertigung
- 4. Zwischenergebnis
- IV. Dogmatische Grundlagen
- 1. Grundsatz der Unübertragbarkeit des Urheberrechts, § 29 UrhG
- 2. Einräumung von Nutzungsrechten, § 31 UrhG
- a) Einfaches / ausschließliches Nutzungsrecht
- b) Creative Commons (CC)
- 3. Verwertungsrechte
- a) Reiner Werkgenuss
- b) Vervielfältigung
- c) Verbreitungsrecht
- d) Erschöpfung
- aa) Begriff
- bb) Computerprogramme („UsedSoft“-Entscheidung)
- cc) Übertragbarkeit der „UsedSoft“-Entscheidung auf andere Werke
- (1) Computerimplementierte E-Books
- (2) Buchpreisbindungsgesetz (BuchPrG)
- (3) „Self-Publishing“
- dd) Zwischenergebnis
- ee) Wirksamkeit von Weitergabeverboten
- ff) Erschöpfung bei Creative Commons (CC)
- e) Gemeinfreie Werke
- 4. Leistungsschutzrechte
- 3. Teil: Spezifische Anwendungsfälle
- I. Funktionsweise von E-Books
- 1. Begriff „E-Book“
- 2. Gegenüberstellung von Buch und E-Book
- 3. Vorteile des E-Books
- 4. Nachteile des E-Books
- 5. Urheberrechtliche Problematik bei E-Books
- 6. Möglichkeiten der Rechtsdurchsetzung
- a) Abmahnung
- b) Endbenutzer-Lizenzvertrag
- c) Unzureichende Versuche einer technischen Lösung
- aa) Standardisierung
- bb) Peer-To-Peer (P2P)673
- II. Digital Rights Management
- 1. Grundlagen der Kryptografie
- a) Probleme der Kryptographie bei DRM-Systemen
- b) Verschlüsselung
- aa) Symmetrische Verschlüsselung
- bb) Asymmetrische Verschlüsselung
- cc) Digitale Signatur
- dd) Public-Key-Infrastruktur
- ee) Identifikation bzw. Identifizierung
- ff) Zero-Knowledge-Verfahren
- c) Digitale Wasserzeichen
- 2. Strukturbedingte Schwächen von DRM-Systemen
- 3. Gefahren der DRM-Systeme
- 4. § 95c und § 95a UrhG
- 5. Umsetzung der WIPO-Verträge
- a) USA
- b) WIPO-Verträge / Info-Richtlinie – Umsetzung in Europa
- c) Zugangskontrolldiensteschutz-Gesetz (ZKDSG) aus dem Jahr 2002
- 6. Tatbestandsmerkmale des § 95c UrhG
- a) Schutzmaßnahmen
- aa) Digitale Wasserzeichen
- bb) Passwortabfragen
- cc) Software
- dd) Kryptografie
- ee) Hardware
- b) Wirksamkeit der technischen Maßnahmen, § 95a UrhG
- c) Probleme technischer Schutzmaßnahmen
- d) Tathandlung des § 95c UrhG
- e) Abgrenzung von § 95c und § 95a UrhG
- 7. Der Erschöpfungsgrundsatz in DRM-Systemen
- 8. Strafrechtliche Sanktionen
- 9. Zusammenfassung
- a) DRM als sinnvolle Alternative?
- b) Vorteile des Digital Rights Managements
- c) Nachteile des Digital Rights Managements
- III. Zusätzliche durch Digitalisierung bedingte urheberrechtliche Aspekte
- 1. Internationale Gerichtszuständigkeit – (kein) „fliegender Gerichtsstand“
- 2. Kollisionsrecht
- 3. Zwischenergebnis
- 4. Datenschutz und Privatsphäre
- 5. Urheberverlagsvertrag – neue Nutzungsarten
- 4. Teil: Schrankendogmatik Deutschland / USA
- I. Schrankenregelung in Deutschland
- 1. § 51 UrhG – Zitate
- 2. Auslegung der deutschen Urheberrechtsschranken
- 3. Zusätzliche Schranken (außerhalb des UrhG)
- II. Einführung in den Sachverhalt Google Book Search
- 1. Alternativen zu Google Book Search
- a) Amazon „Search Inside“/ „Blick ins Buch“
- b) Archive.org928
- c) Europeana930
- d) Digital Public Library of America (DPLA)931
- e) Libreka932
- f) Zusammenfassende Betrachtung
- g) Ergebnis
- 2. Mögliche Urheberrechtsverletzung durch Google Book Search nach deutschem Recht
- 3. Rechtfertigungsmöglichkeiten nach deutschem Recht
- a) § 44a UrhG – Vorübergehende Vervielfältigungshandlungen
- b) § 51 UrhG – Zitate
- c) §§ 60a, 60c UrhG – Unterricht und Lehre & Wissenschaftliche Forschung
- d) § 53 UrhG – Vervielfältigung zum privaten und sonstigen Gebrauch
- e) § 60e UrhG – Bibliotheken, Vervielfältigung auf Bestellung
- f) (konkludente) Einwilligung des Rechteinhabers
- III. Copyright Law in den USA
- 1. Entwicklung des Copyright Law
- 2. Entstehung des Urheberrechtsschutzes in den USA
- a) Originality
- b) Works of authorship
- c) Fixation
- IV. Anwendung der US-amerikanischen Schranke („fair use“) auf Google Book Search
- 1. Begriff des „fair use“ (17 U.S.C. § 107)
- 2. Dogmatische Einordnung von „fair use“
- 3. Die „fair use“-Faktoren
- a) Erster Faktor: „purpose and character of the use“
- b) Zweiter Faktor: „nature of the copyrighted work“
- c) Dritter Faktor: „amount and substantiality of the portion used“
- d) Vierter Faktor: „effect of the use upon the potential market“
- e) Gewichtung / Rangfolge der „fair use“-Faktoren
- 4. Google Books Project
- a) Googles „Partner Program“ (zuvor „Google Print“)
- b) Googles „Library Project“
- 5. Mögliche Copyright-Verletzung durch Google Book Search nach US-amerikanischem Recht
- 6. US-amerikanisches (Gerichts-)Verfahren
- a) „class action“
- b) Settlement Agreement
- aa) Deutsche Urheber betroffen?
- bb) Opt out
- cc) Amended Settlement Agreement
- c) Klageabweisung aufgrund von „fair use“
- d) Appeal der Authors Guild
- e) Antrag auf Supreme Court Review
- V. Vergleich deutsche Schrankenregelung und „fair use“
- 5. Teil: Anwendbarkeit der „fair use“-Doktrin in Deutschland?
- I. Vereinbarkeit mit europarechtlichen Regelungen, insb. der Info-Richtlinie
- II. Verfassungsmäßige Grenzen in Deutschland
- III. Möglichkeit der Einführung einer neuen Schranke bzw. Schrankengeneralklausel
- 1. Mittelbare Drittwirkung der Grundrechte
- 2. Institutsgarantie
- 3. Verhältnismäßigkeit
- a) Vergütung
- b) § 52a UrhG a.F.1207, jetzt §§ 60a, 60c UrhG
- c) Richtlinie über das Urheberrecht und die verwandten Schutzrechte im digitalen Binnenmarkt
- 4. Bestimmtheitsgebot
- IV. Möglichkeit der Einführung einer ökonomisch motivierten Schranke
- V. Kann der Dreistufentest einer Schrankengeneralklausel wie „fair use“ standhalten?
- 1. Erste Stufe
- a) Bestimmtheitsgebot
- b) Zwischenergebnis
- 2. Zweite Stufe
- a) Historische Auslegung
- b) „Normale“ Auslegung
- 3. Dritte Stufe
- 4. Rechtliche Problematik einer Einführung einer Schrankengeneralklausel
- a) Stand der Harmonisierung des Urheberrechts in der EU
- b) Harmonierungsprojekte
- c) Ergebnis
- VI. Anwendungsmöglichkeiten der „fair use“-Doktrin – denkbare Optionen
- 1. Abschaffung der bestehenden Schranken
- 2. Einführung einer Generalklausel nur für Bildung, Wissenschaft und Kultur
- 3. Verabschiedung des Urheberrechts-Wissensgesellschafts-Gesetz (UrhWissG)
- 4. Flexiblere Ausgestaltung bestehender Schranken
- 5. Einführung einer Schrankengeneralklausel als Auffangtatbestand
- a) Problem der Rechtssicherheit
- b) Änderung bzw. Einführung einer Richtlinie
- c) Urheberrechtsverordnung
- d) European Copyright Code
- e) Auffangtatbestand in Anlehnung an die „fair use“-Doktrin
- 6. Vergleichbare Anwendung von „fair use“ durch Nutzung des Dreistufentests
- VII. Schlussthesen
- Rechtsprechungsverzeichnis
- I. Europäische Rechtsprechung
- II. US-amerikanische Rechtsprechung
- Literaturverzeichnis
Abs. |
Absatz |
AER |
American Economic Review |
Art. |
Artikel |
Berkeley Tech. L.J. |
Berkeley Technology Law Journal |
BGB |
Bürgerliches Gesetzbuch |
BGBl. |
Bundesgesetzblatt |
BGH |
Bundesgerichtshof |
BGHZ |
Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Zivilsachen |
BR-Drucks. |
Bundesrats-Drucksache |
BT-Drucks. |
Bundestags-Drucksache |
BVerfG |
Bundesverfassungsgericht |
BVerfGE |
Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts |
Cal. L. Rev. |
California Law Review |
Chi.-Kent. L. Rev. |
Chicago-Kent Law Review |
Colum. L. Rev. |
Columbia Law Review |
CR |
Computer und Recht |
d. h. |
das heißt |
Diss. iur. |
Juristische Dissertation |
DStR |
Deutsches Steuerrecht |
DuD |
Datenschutz und Datensicherheit |
EG |
Europäische Gemeinschaft |
EGBGB |
Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch |
EGV |
Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft |
EGVO |
EG-Verordnung |
EJ |
The Economic Journal |
EU |
Europäische Union |
EuZ |
Zeitschrift für Europarecht |
f., ff. |
folgende |
Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J. |
Fordham Intellectual Property, Media & Entertainment Law Journal |
Fordham L. Rev. |
Fordham Law Review |
FuR |
Film und Recht |
GEMA |
Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte |
GG |
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland |
grds. |
grundsätzlich |
GRUR |
Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (Zeitschrift) |
GRUR Int |
Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil |
GRUR Prax |
Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Praxis im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht |
GRUR-RR |
Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Rechtsprechungs-Report |
Hamline L. Rev. |
Hamline Law Review |
Harv. J.L. & Pub. Pol’y |
Harvard Journal of Law & Public Policy |
Harv. J.L. & Tech. |
Harvard Journal of Law & Technology |
Harv. L. Rev. |
Harvard Law Review |
Hrsg. |
Herausgeber |
IIC |
International Review of Intellectual Property and Competition Law |
Int. J. Inf. Secur. |
International Journal of Information Security |
Iowa L. Rev. |
Iowa Law Review |
ITRB |
Der IT-Rechts-Berater |
IPQ |
Intellectual Property Quarterly |
JEL |
Journal of Economic Literature |
JIPITEC |
Journal of Intellectual Property, Information Technology and Electronic Commerce Law |
J. Intell. Prop. L. |
Journal of Intellectual Property Law |
J.L. & Econ. |
Journal of Law & Economics |
J. Legal Stud. |
Journal of Legal Studies |
J. Copyright Soc’y U.S.A. |
Journal of the Copyright Society of the U.S.A. |
JR |
Juristische Rundschau |
JuS |
Juristische Schulung |
JZ |
Juristenzeitung |
K&R |
Kommunikation & Recht |
Law & Contemp. Probs. |
Law and Contemporary Problems |
Lewis & Clark L. Rev. |
Lewis & Clark Law Review |
LNCS |
Lecture Notes in Computer Science |
Marq. Intell. Prop. L. Rev. |
Marquette Intellectual Property Law Review |
Mich. L. Rev. |
Michigan Law Review |
MüKo |
Münchener Kommentar |
Neb. L. Rev. |
Nebraska Law Review |
N.C. L. Rev. |
North Carolina Law Review |
Nw. U. L. Rev. |
Northwestern University Law Review |
Ohio St. L.J. |
Ohio State Law Journal |
RIDA |
Revue Internationale du Droit d’Auteur |
RL |
Richtlinie |
S. |
Seite |
SSRN |
Social Science Research Network |
Stan. L. Rev. |
Stanford Law Review |
u.a. |
und andere |
U. Chi. Legal F. |
University of Chicago Legal Forum |
U. Pa. L. Rev. |
University of Pennsylvania Law Review |
UrhG |
Urheberrechtsgesetz |
UrhWissG |
Urheberrechts-Wissensgesellschafts-Gesetz |
Va. J. Int’l L. |
Virginia Journal of International Law |
Vand. L. Rev. |
Vanderbilt Law Review |
vgl. |
vergleiche |
WM |
Wertpapier-Mitteilungen, Zeitschrift für Wirtschafts- und Bankrecht |
Wm. & Mary L. Rev. |
William and Mary Law Review |
Yale L.J. |
Yale Law Journal |
z.B. |
zum Beispiel |
ZIIR |
Zeitschrift für Informationsrecht |
ZJS |
Zeitschrift für das Juristische Studium |
ZVglRWiss |
Zeitschrift für Vergleichende Rechtswissenschaft |
ZUM |
Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht |
1. Teil: Untersuchungsgegenstand
Tempora mutantur1 – der Dynamik gesellschaftlicher Veränderungen kann sich auch das Recht nicht entziehen. Gerade das Urheberrecht steht vor der ständigen Aufgabe, sich parallel zur Entwicklung menschlicher Grundanschauungen und insbesondere technischer Innovationen wie der Digitalisierung weitreichender Bereiche des Lebens neu zu erfinden und urheberrechtliche Regelungen (insbesondere der Schranken) fortzuentwickeln.
Von Vorteil könnte es zudem sein, bestehende, teilweise sehr divergierende Schrankenregelungen verschiedener Staaten einander anzunähern.
Im Spannungsverhältnis zwischen dem Wunsch nach möglichst umfassendem Schutz des Urhebers und seiner Verwertungsrechte einerseits und gesellschaftlich erwünschten Ausnahmemöglichkeiten zur Nutzung andererseits, die nicht gleich mit Verletzungen des bestehenden Rechts einhergehen sollen, sind in Deutschland vom Gesetzgeber enge Beschränkungen eingeführt, die auch nach Vorgabe der EU2 keinesfalls weit auszulegen sind. Durch derartige Schranken sind Eingriffe in urheberrechtliche Verwertungsrechte immerhin möglich, sodass im vorgegebenen kleinen Rahmen Nutzungen ohne vorherige Zustimmung des Urhebers nicht unzulässig sind.3
Die Urheberrechtsschranken sind auch nach der deutschen Rechtsprechung grundsätzlich eng auszulegen und nicht analogiefähig.4 Dieser Ansatz wäre ausreichend, gäbe es keine fundamentalen technischen Neuerungen, die bislang gänzlich unbekannte Nutzungsarten geschützter Werke durch Digitalisierung ermöglichten.
Welche Zielsetzung soll die daher zwingend erforderliche Weiterentwicklung der urheberrechtlichen Schranken konkret verfolgen? Sollen Schranken grundsätzlich in Anpassung an den technischen Fortschritt einzeln weiterentwickelt werden oder soll mittels des Dreistufentests eine Methode genutzt werden, die Schranken nach Sinn und Zweck durch die Rechtsprechung weniger eng ←19 | 20→auszulegen – zumal dieses Instrumentarium den europäischen Vorgaben entspricht, da die geltenden Schranken auf diese Weise nicht geändert werden?
Oder soll eine Schrankengeneralklausel als Auffangtatbestand durch Änderung des europäischen Rechts eingeführt werden, oder soll gar in einem ganz großen Wurf eine Harmonisierung der recht weit divergierenden Schrankendogmatik innerhalb der gesamten westlichen Welt angedacht werden?
Die aktuelle digitale Revolution mit früher undenkbaren neuen Nutzungsoptionen von Werken und Gedanken im weltweit zur Verfügung stehenden Internet stellt geltende Urheberrechtsschranken vor bis dahin unbekannte Aufgaben; die Analyse der daraus erwachsenden Problematik und das Aufzeigen denkbarer Lösungsansätze sollen Themen der vorliegenden Arbeit sein.
In einer Analyse der aktuellen Situation des Urheberrechts in Deutschland wird die Krise der Urheberrechtsschranken im digitalen Zeitalter beleuchtet.
Ausgehend von der Betrachtung der historischen Entwicklung und verschiedener Rechtfertigungsversuche des Urheberrechts, aus denen sich sehr unterschiedliche Dogmatiken entwickeln, die einer Harmonisierung urheberrechtlicher Schranken im Wege stehen, sollen zunächst die dogmatischen Grundlagen des Urheberrechts in Deutschland dargestellt werden.
Schwerpunktmäßig sind anschließend spezifische Anwendungsfälle zu skizzieren, welche konkreten digitalen Gegebenheiten zu Herausforderungen des bisherigen Urheberrechts werden, um die Notwendigkeit der Weiterentwicklung der Urheberrechtsschranken verständlich werden zu lassen, da sich ohne das Wissen spezieller technischer Details die Komplexität urheberrechtlicher Fragen diesbezüglich nur unzureichend erschließen dürfte. Insbesondere auf die Durchsetzung urheberrechtlicher Ansprüche – etwa im Sinne von Digital Rights Management (DRM) – soll eingegangen werden.
Dem Ausmaß der bestehenden Differenzen der in der westlichen Welt geltenden Urheberrechtsschranken und damit den Problemen auf dem Weg zu einer möglichen Harmonisierung soll sich ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit widmen: dem Vergleich zwischen deutschen und US-amerikanischen Grundsätzen der Schrankenregelung des Urheberrechts anhand des Google-Urheberrechtsstreits. Diesem Gerichtsverfahren wurde weltweit Aufmerksamkeit zuteil, es wurde überaus kontrovers diskutiert, wie konkret Schrankenregelungen zu fassen sind, um auslegungsfähig und zugleich ausreichend rechtssicher zu sein.
Die erheblichen aktuellen Differenzen mit Vor- und Nachteilen angesichts der digitalen Herausforderung des Urheberrechts werden vorgestellt.
Schließlich sollen verschiedene Lösungsansätze einer Fortentwicklung bzw. Harmonisierung geltender Urheberrechtsschranken thematisiert werden:
←20 | 21→Soll das Ziel sein, eine weitreichende Harmonisierung der Schranken in der westlichen Welt mit Anlehnung an die US-amerikanische „fair use“-Doktrin als Schrankengeneralklausel zu verfolgen, was allerdings aktuell an europäischen Vorgaben (Info-Richtlinie 2001/29/EG) scheitert und deren Änderung voraussetzen würde?
Oder kann an die Einführung einer Schrankengeneralklausel als Auffangtatbestand gedacht werden, was aber ebenfalls erst nach Abänderung des europäischen Rechts möglich wäre?
Oder kann im Sinne eines kleineren Wurfes innerhalb des geltenden Rechts die deutsche Rechtsprechung durch stetige Anwendung des bislang kaum genutzten Dreistufentests zu einer praktikablen Lösung bei der Auslegung der Schranken beitragen, gleichzeitig zu einer gewissen Harmonisierung führen und damit Elemente der US-amerikanischen „fair use“-Doktrin mit einbeziehen?
←21 | 22→←22 | 23→1 Jahrhundertealtes Sprichwort, zurückgehend wohl auf Ovid, vergleichbar mit Heraklits „panta rhei“, im Sinne von „beständig ist nur der Wandel“.
2 Besonders die Info-Richtlinie 2001/20/EG und der notwendige Dreistufentest.
3 Rehbinder/Peukert, Urheberrecht, Rn. 477.
4 Ständige Rechtsprechung BGHZ 50, 147 (152) – Kandinsky I; BGHZ 58, 262 (265) – Landesversicherungsanstalt.
Details
- Pages
- 364
- Publication Year
- 2020
- ISBN (Softcover)
- 9783631821954
- ISBN (PDF)
- 9783631833261
- ISBN (ePUB)
- 9783631833278
- ISBN (MOBI)
- 9783631833285
- DOI
- 10.3726/b17475
- Language
- German
- Publication date
- 2020 (September)
- Keywords
- Urheberrechtsschranken Fair Use Schrankengeneralklausel Dreistufentest Schrankendogmatik Urheberrechtsharmonisierun
- Published
- Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 2020. 364 S.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG