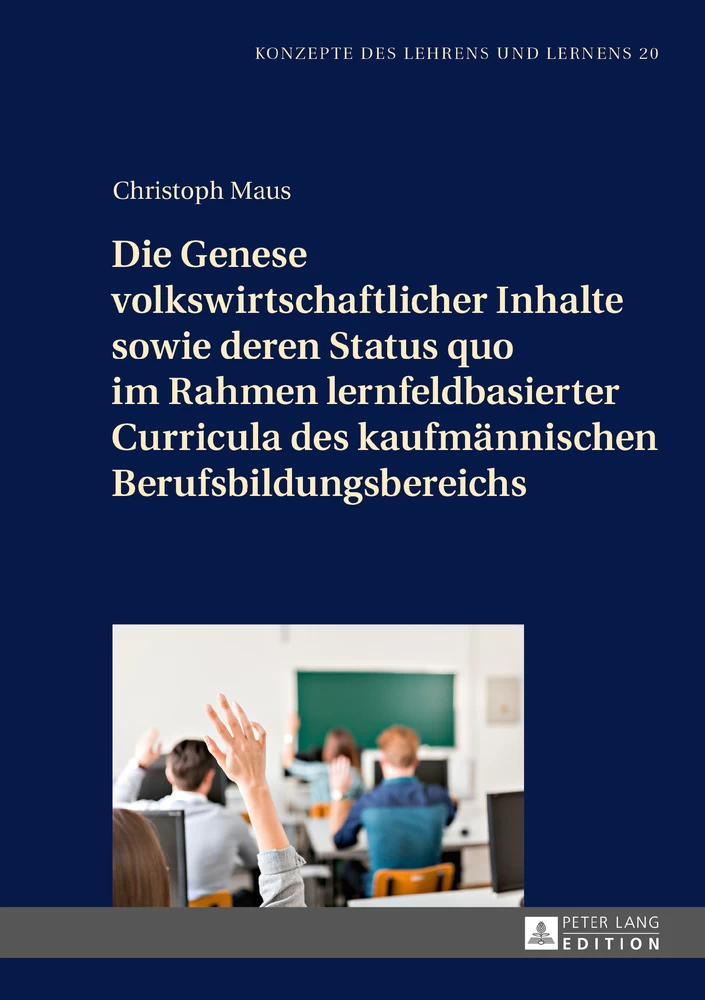Die Genese volkswirtschaftlicher Inhalte sowie deren Status quo im Rahmen lernfeldbasierter Curricula des kaufmännischen Berufsbildungsbereichs
Summary
Excerpt
Table Of Contents
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Danksagung
- Inhaltsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
- Anhangsverzeichnis
- 1 Einführung
- 1.1 Forschungsgegenstand
- 1.1.1 Lernfeldbasierte Curricula als Grundlage berufsbegleitenden Schulunterrichts
- 1.1.2 Bipolare Strukturen volkswirtschaftlicher Bildungsinhalte
- 1.2 Diskussionsstand lernfeldbasierter Curricula
- 1.3 Forschungsbedarf und Hypothesenformulierung
- 1.3.1 Hypothesengenerierung zur volkswirtschaftlichen Curriculargenese
- 1.3.2 Hypothesengenerierung zur Dimensionierung volkswirtschaftlicher Inhalte innerhalb lernfeldbasierter Curricula
- 1.3.3 Modelltheoretische Fundierung zur Hypothesengenerierung – der Einfluss personenbezogener Merkmale auf die subjektive Inhaltsbewertung
- 1.3.3.1 Hypothesengenerierung zu geschlechtsspezifischen Merkmalen
- 1.3.3.2 Hypothesengenerierung zu ausbildungsspezifischen Merkmalen
- 1.3.3.3 Hypothesengenerierung zu berufserfahrungsspezifischen Merkmalen
- 1.3.3.4 Hypothesengenerierung zu fachstudienspezifischen Merkmalen
- 1.3.3.5 Hypothesengenerierung zur subjektiven Bewertung zeitlicher Rahmenbedingungen
- 1.3.4 Hypothesengenerierung zur inhaltskonstituierenden Wirkung der IHK-Abschlussprüfung
- 1.4 Forschungsaufbau und Struktur der Arbeit
- 2 Die volkswirtschaftliche Curriculargenese aus wirtschaftshistorischer Sicht
- 2.1 Heterogene Themenimplementierung im schulischen und akademischen Bildungsbereich während des Merkantilismus
- 2.2 Die Ausrichtung kaufmännischer Bildungsinhalte im Kontext neuhumanistischer Geistesströmungen
- 2.3 Kaufmännische Curricularentwicklungen im Kontext aufkommender institutioneller Berufsbildung im frühen 20. Jahrhundert
- 2.4 Die Inhalte kaufmännischen Unterrichts während des Ersten Weltkriegs
- 2.5 Strukturelle Entwicklung des kaufmännischen Schulsystems während der Weimarer Republik
- 2.6 Die Volkswirtschaftslehre als Ideologieträger während der nationalsozialistischen Zeit
- 2.7 Die Entwicklung eines eigenständigen volkswirtschaftlichen Fachs während der Nachkriegszeit
- 3 Zwischenergebnis: Die Bedingungsfaktoren volkswirtschaftlicher Curriculargenese
- 4 Die strukturelle Neuorganisation in Form handlungsorientierter Lernfeldcurricula
- 5 Die empirische, fragebogengestützte Überprüfung aktueller Rahmenlehrpläne
- 5.1 Begründung der Methodenwahl
- 5.2 Beschreibung der Zielgruppe
- 5.2.1 Zielgruppenbeschreibung anhand der curricularen Auswahl
- 5.2.2 Quantitative Zielgruppenbeschreibung
- 5.3 Aufbau und Struktur des Fragebogens
- 5.3.1 Auswahl der Fragestellung
- 5.3.2 Auswahl der Frageform
- 5.3.3 Auswahl der Skalierung
- 5.3.4 Gütekriterienermittlung des Erhebungsinstruments
- 5.3.5 Exkurs: Messniveau der Variablen und die ‚undermeasurement-Kontroverse‘
- 5.4 Zeitlicher Verlauf der empirischen Studie
- 6 Ergebnisse der Studie
- 6.1 Deskriptive Verteilungsgrößen
- 6.1.1 Personelle Verteilung
- 6.1.2 Inhaltsbezogene Relevanzbewertung
- 6.1.3 Bewertung der zeitlichen Vorgaben
- 6.1.4 Sozialform und Medieneinsatz
- 6.2 Induktive Auswertung zur Hypothesenüberprüfung
- 6.2.1 Korrelationen zu fachinhaltlichen Bewertungen basierend auf Persönlichkeitsmerkmalen
- 6.2.1.1 Geschlechtsspezifische Ergebnisse
- 6.2.1.2 Ausbildungsspezifische Ergebnisse
- 6.2.1.3 Erfahrungsspezifische Ergebnisse
- 6.2.1.4 Fachstudienbezogene Ergebnisse
- 6.2.2 Soziodemographisch basierte Korrelationsbeziehungen unterrichtlicher Faktoren
- 6.2.2.1 Soziodemographische Einflüsse auf zeitliche Unterrichtsfaktoren
- 6.2.2.2 Soziodemographische Einflüsse auf die Unterrichtsorganisation
- 7 Die Abschlussprüfung der IHK als inhaltskonstituierender Faktor
- 8 Einordnung der quantitativen Ergebnisse
- 9 Studienergebnisse und -restriktionen
- 9.1 Untersuchungsrestriktionen und weitergehender Forschungsbedarf
- 9.2 Ergebnis und Ausblick
- 10 Anhang
- 11 Literaturverzeichnis
Abbildung 1: Handlungskompetenz: Dimensionen und deren Akzentuierung
Abbildung 2: Exemplarischer Aufbau eines Lernfelds anhand des Lernfelds Nr. 8 des Ausbildungsberufs ‚Industriekaufmann/Industriekauffrau‘
Abbildung 3: Zusammenhang zwischen Handlungsfeldern, Lernfeldern und Lernsituationen
Abbildung 4: Unterscheidung zwischen lerngebiets- und lernfeldorientierter Lehrplankonstruktion (1999)
Abbildung 5: Das didaktische Dreieck
Abbildung 6: Angebots-Nutzungs-Modell der Unterrichtswirksamkeit nach Helmke
Abbildung 7: Angebots-Nutzungs-Modell der Unterrichtsqualität und -wirksamkeit nach Reusser/Pauli
Abbildung 8: Übersicht zur Lehrerexpertise und Unterrichtsqualität nach Helmke
Abbildung 9: Definition subjektiver Theorien
Abbildung 10: Problemfelder didaktischer Theoriebildung nach Achtenhagen/Heidenreich/Sembill
Abbildung 11: Hemmnisse einer Ausweitung der Handlungsorientierung im kaufmännischen Unterricht nach Seifried
Abbildung 12: Eignung des Frontalunterrichts aus der Sicht (angehender) Handelslehrer nach Seifried
Abbildung 13: Schematische Darstellung der durchgeführten Studie
Abbildung 14: Stundentafel der Hamburger Handelsakademie (1778)
Abbildung 15: Stundenplan der Wiener Realakademie 1814
Abbildung 16: Stundentafel der Handelsschule der Vereinigung „kaufmännische Innungshalle“ Gotha (1818)
Abbildung 17: Stundentafel der Lehrlingsabteilung der Öffentlichen Handelslehranstalt Leipzig von 1832 bis 1836 ← xi | xii →
Abbildung 18: Lehrgegenstände der Öffentlichen Lehranstalt Leipzig (1832)
Abbildung 19: Tätigkeit von Groß- und Einzelhandelslehrlingen (um 1898)
Abbildung 20: Stoffauswahl und Verteilung des handelskundlichen Fachs in Preußen und Baden
Abbildung 21: Stundenverteilung der Einjährigen-Lehrlings-Fachkurse in Sachsen (Schuljahr 1913/14)
Abbildung 22: Stundentafel der städtischen Handelsschule Nürnberg (Schuljahr 1914/15)
Abbildung 23: Stundentafel der städtischen Handelsschule für Mädchen in Fürth (Schuljahr 1913/14)
Abbildung 24: Stundenverteilung an der Höheren Handelsschule in Preußen
Abbildung 25: Lehrplan des zweijährigen Kursus für die Höhere Handelsschule für Mädchen
Abbildung 26: Stundentafel der Zweijährigen Höheren Handelsschule für Mädchen in Köln
Abbildung 27: Handelshochschule Mannheim – Zusammensetzung der Studierenden nach Studienziel
Abbildung 28: Inhalte vertiefender volkswirtschaftlicher Vorlesungen (1911)
Abbildung 29: Auszug aus den Ausführbestimmungen zu der Ordnung für die Handelslehrerprüfung an der Handelshochschule zu Berlin
Abbildung 30: Inhalte des volkswirtschaftlichen Vortragskurs der Vereinigung für Wirtschafts- und Gewerbekunde zu Berlin (Sommerhalbjahr 1910)
Abbildung 31: Stundentafel der Wirtschaftsoberschule Dresden (~1925)
Abbildung 32: Bildungsplan der kaufmännischen Berufsschule in Berlin (~1925)
Abbildung 33: Lehrplan der Verkäuferinnenschule in Witten (1928)
Abbildung 34: Stundentafel der zweijährigen Handelsschule Bielefeld
Abbildung 35: Stundentafel der zweijährigen Höheren Handelsschule (~1932) ← xii | xiii →
Abbildung 36: Diplomprüfung für Kaufleute und Handelslehrer in Preußen (1925)
Abbildung 37: Prüfungsthemen der Kaufmannsgehilfenprüfung (1935)
Abbildung 38: Aufsatzthemen der schriftlichen Kaufmannsgehilfenprüfung (1935)
Abbildung 39: Die Verteilungsfunktion des Güterhandels (1935)
Abbildung 40: Aufgaben eines Lehrlings innerhalb des Berufsbildungsplans (1939/40)
Abbildung 41: Stundentafel für die Einzelhandelsklassen der kaufmännischen Berufsschule (1939)
Abbildung 42: Stundentafel für Großhandelslehrlinge in der kaufmännischen Berufsschule (1942)
Abbildung 43: Stundentafel einer Mädchenklasse für Großhandelslehrlinge in der kaufmännischen Berufsschule (1942)
Abbildung 44: Stoffplan des Fachs ‚Reichskunde‘ (1942)
Abbildung 45: Lehrstoff des dritten Lehrjahres für Großhandelskaufmänner (1942, Auszug)
Abbildung 46: Stundentafel der kaufmännischen Berufsschule in Bayern (1948)
Abbildung 47: Stundentafel kaufmännischer Berufsschulen in der sowjetischen Besatzungszone (1946)
Abbildung 48: Lehrplan einer Bank- und Sparkassenklasse aus Saarbrücken (1962)
Abbildung 49: Berufsbild ‚Bankkaufmann‘ (1961)
Abbildung 50: Stundentafel für den Lehrberuf ‚Bankkaufmann‘ (1969)
Abbildung 51: Volkswirtschaftliche Unterrichtseinheiten innerhalb des Fachs ‚Wirtschaftslehre‘ für Industriekaufleute (1968)
Abbildung 52: Stundentafel für die Ausbildungsgänge ‚Kaufmann im Groß- und Außenhandel‘, ‚Bankkaufmann‘ und ‚Industriekaufmann‘ (1975)
Abbildung 53: Stundentafel für den Ausbildungsgang ‚Versicherungskaufmann‘ (1975)
Abbildung 54: Stundentafel des Ausbildungsgangs ‚Bürogehilfin‘ (1975)
Abbildung 55: Inhalte des Fachs ‚Volkswirtschaftslehre‘ innerhalb der Ausbildungsgänge ‚Kaufmann im Groß- und ← xiii | xiv → Außenhandel‘, ‚Versicherungskaufmann‘ und ‚Industriekaufmann‘ (1975)
Abbildung 56: Themenkreise des Fachs ‚Volkswirtschaftslehre‘ im Ausbildungsgang ‚Bankkaufmann‘ (1975)
Abbildung 57: Lerngebiete und Lernabschnitte des länderübergreifenden Rahmenlehrplans ‚Kaufmann/Kauffrau im Groß- und Außenhandel‘ (1978)
Abbildung 58: Stundentafel im Ausbildungsberuf ‚Industriekaufmann/Industriekauffrau‘ (1982)
Abbildung 59: Übersicht über die Themenkreise und -sektoren des gemeinsamen Lehrplans ‚Volkswirtschaftslehre‘ (1982)
Abbildung 60: Gegenüberstellung der volkswirtschaftlichen Themenkreise des Lehrplans ‚Bankkaufmann‘ (1975) und des übergreifenden Lehrplans ‚Volkswirtschaftslehre‘ (1982)
Abbildung 61: Stundentafel für den Teilzeitunterricht ‚Industriekaufmann/Industriekauffrau‘ (Schuljahr 1995/1996)
Abbildung 62: Lerngebietsübersicht mit Zeitrichtwerten des länderübergreifenden Rahmenlehrplans ‚Industriekaufmann/-frau‘ (1995)
Abbildung 63: Stundentafel im Bildungsgang ‚Industriekauffrau/Industriekaufmann‘ (ab 1997)
Abbildung 64: Lernfeld 4 des Lehrplans zur Erprobung ‚Industriekauffrau/Industriekaufmann‘ (ab Schuljahr 1997/1998)
Abbildung 65: Zeitrichtwerte der volkswirtschaftlich geprägten Lernfelder innerhalb des Erprobungsverfahrens
Abbildung 66: Zeitrichtwerte aktueller volkswirtschaftlich geprägter Lernfelder
Abbildung 67: Exemplarischer Fragebogenaufbau im Lernfeld 6 des Ausbildungsgangs ‚Bankkauffrau/-mann‘ (Auszug)
Abbildung 68: Übersicht über den zeitlichen Ablauf der Studie
Abbildung 69: Studienabschluss der Teilnehmer
Abbildung 70: Erfahrungswerte der Teilnehmer
Abbildung 71: Rücklaufquoten einzelner Bildungsgänge
Abbildung 72: Verteilung wertbeimessender Antworten ← xiv | xv →
Abbildung 73: Verteilung der gesamten Antworten
Abbildung 74: Vergleich hoher gegenüber niedriger Bewertungen innerhalb einzelner Bildungsgänge in %
Abbildung 75: Die Bewertung des Grundlagenthemas ‚Preisstabilität‘
Abbildung 76: Vergleich ausgewählter Grundlagenthemen (Einzelitems) innerhalb ausgewählter Bildungsgänge
Abbildung 77: Einschätzung des tatsächlich zur Verfügung stehenden Zeitumfangs
Abbildung 78: Einschätzung des Verhältnisses zwischen curricularen Zeitrichtwerten und vorgesehenen Inhalten
Abbildung 79: Mittelwertverteilung der Sozialformen
Abbildung 80: Antwortverteilung der Sozialformen, Angaben in %
Abbildung 81: Mittelwertverteilung der gewählten Medien
Abbildung 82: Antwortverteilung der Mediennutzung, Angaben in %
Abbildung 83: Antwortverteilung zwischen den Teilnehmergruppen differenziert nach Berufserfahrung (gerundete Werte)
Abbildung 84: Exemplarische volkswirtschaftliche Prüfungsaufgabe aus der Abschlussprüfung des Bildungsgangs ‚Industriekaufmann/-frau‘
Abbildung 85: Überblick über schulische Fächer innerhalb Höherer Handelsschulen (1916)
Abbildung 86: Unterrichtseinheiten aus dem Lehrplan ‚Industriekaufmann‘ (1968)
Abbildung 87: Unterrichtseinheit aus dem Lehrplan ‚Bankkaufmann‘ (1969)
Abbildung 88: Unterrichtseinheiten aus dem Lehrplan ‚Kaufmann im Groß- und Außenhandel‘ (1969)
Abbildung 89: Unterrichtseinheiten aus dem Lehrplan ‚Speditionskaufmann‘ (1970)
Abbildung 90: Unterrichtseinheiten aus dem Lehrplan ‚Versicherungskaufmann‘ (1971)
Abbildung 91: Unterrichtseinheiten aus dem Lehrplan ‚Bürokaufmann‘ (1972)
Abbildung 92: Ausbildungsberufsbild ‚Bankkaufmann‘ vom 10. Mai 1973 ← xv | xvi →
Abbildung 93: Ausbildungsberufsbild ‚Industriekaufmann‘ vom 10. Mai 1973
Abbildung 94: Ausbildungsberufsbild ‚Versicherungskaufmann‘ vom 10. Mai 1973
Abbildung 95: Ausbildungsberufsbild ‚Kaufmann im Groß- und Außenhandel‘ vom 10. Mai 1973
Abbildung 96: Volkswirtschaftliche Themenkreise (1975)
Abbildung 97: Lerngebiete und Lernabschnitte des länderübergreifenden Rahmenlehrplans ‚Industriekaufmann/Industriekauffrau‘ (1978)
Abbildung 98: Lerngebiete und Lernabschnitte des länderübergreifenden Rahmenlehrplans ‚Speditionskaufmann/Speditionskauffrau‘ (1981)
Abbildung 99: Lerngebiete und Lernabschnitte des länderübergreifenden Rahmenlehrplans ‚Bankkaufmann/Bankkauffrau‘ (1978)
Abbildung 100: Lerngebiete und Lernabschnitte des länderübergreifenden Rahmenlehrplans ‚Versicherungskaufmann/Versicherungskauffrau‘ (1977)
Abbildung 101: Lerngebiete und Lernabschnitte des länderübergreifenden Rahmenlehrplans ‚Kaufmann/Kauffrau in der Grundstücks- und Wohungswirtschaft‘
Abbildung 102: Stundentafel im Ausbildungsberuf ‚Kaufmann/Kauffrau im Groß- und Außenhandel‘ (1982)
Abbildung 103: Stundentafel im Ausbildungsberuf ‚Speditionskaufmann/Speditionskauffrau‘ (1987)
Abbildung 104: Stundentafel im Ausbildungsberuf ‚Versicherungskaufmann/Versicherungskauffrau‘ (1982)
Abbildung 105: Stundentafel im Ausbildungsberuf ‚Bankkaufmann/Bankkauffrau‘ (1982)
Abbildung 106: Stundentafel im Ausbildungsberuf ‚Kaufmann/Kauffrau in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft‘ (1983)
Abbildung 107: Gemeinsamer Lehrplan für das Fach ‚Volkswirtschaftslehre‘ in der Berufsschule (1982)
Abbildung 108: Stundentafel im Bildungsgang ‚Speditionskauffrau/Speditionskaufmann‘ (ab 1997) ← xvi | xvii →
Abbildung 109: Stundentafel im Bildungsgang ‚Kauffrau/Kaufmann im Groß- und Außenhandel‘ (ab 1997)
Abbildung 110: Stundentafel im Bildungsgang ‚Automobilkauffrau/Automobilkaufmann‘ (ab 1999)
Abbildung 111: Stundentafel im Bildungsgang ‚Bankkauffrau/Bankkaufmann‘ (ab 1999)
Abbildung 112: Lernfeld 4 des Lehrplans zur Erprobung im Bildungsgang ‚Speditionskauffrau/Speditionskaufmann‘ (ab Schuljahr 1997/1998)
Abbildung 113: Lernfeld 4 des Lehrplans zur Erprobung im Bildungsgang ‚Kauffrau/Kaufmann im Groß- und Außenhandel‘ (ab Schuljahr 1997/1998)
Abbildung 114: Lernfeld 9 des Lehrplans zur Erprobung im Bildungsgang ‚Automobilkauffrau/Automobilkaufmann‘ (1998)
Abbildung 115: Lernfeld 6 des Lehrplans zur Erprobung im Bildungsgang ‚Bankkauffrau/Bankkaufmann‘ (1998)
Abbildung 116: Lernfeld 12 des Lehrplans zur Erprobung im Bildungsgang ‚Bankkauffrau/Bankkaufmann‘ (1998)
Abbildung 117: Lernfeld 9 des Bildungsgangs ‚Automobilkaufmann/Automobilkauffrau‘
Abbildung 118: Lernfeld 6 des Bildungsgangs ‚Bankkaufmann/Bankkauffrau‘
Details
- Pages
- XXX, 494
- Publication Year
- 2016
- ISBN (Hardcover)
- 9783631700778
- ISBN (PDF)
- 9783631705667
- ISBN (ePUB)
- 9783631705674
- ISBN (MOBI)
- 9783631705681
- DOI
- 10.3726/b10403
- Language
- German
- Publication date
- 2016 (October)
- Keywords
- IHK-Abschlussprüfung Historie Curricula VWL Curricula Unterrichtliche Einflussfaktoren Volkswirtschaftliche Schulinhalte Lernfeldcurricula
- Published
- Frankfurt am Main, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 2016. XXX, 494 S., 123 s/w Abb., 167 s/w Tab.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG