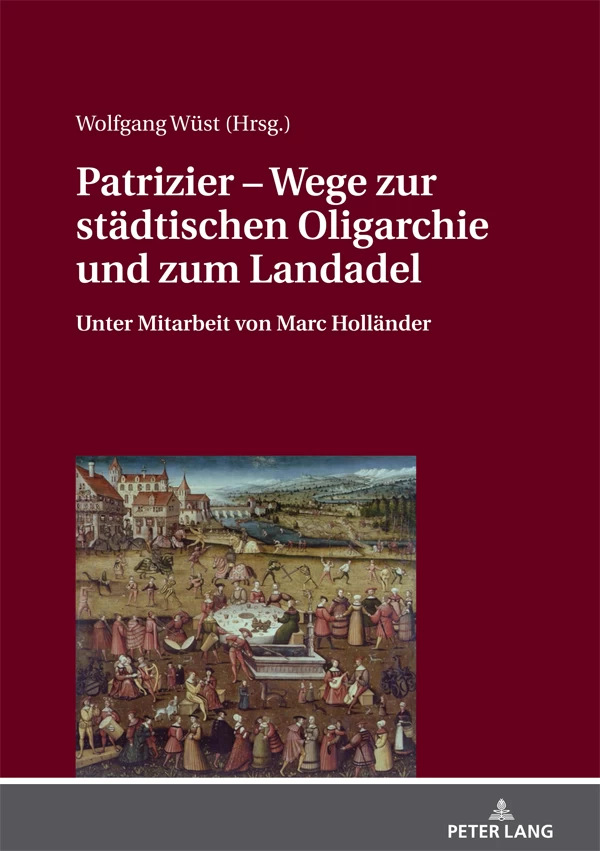Patrizier – Wege zur städtischen Oligarchie und zum Landadel
Süddeutschland im Städtevergleich. Unter Mitarbeit von Marc Holländer
Summary
Excerpt
Table Of Contents
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Grußwort der Dr. Lorenz Tucher’schen Stiftung von 1503
- Vorwort
- Inhaltsverzeichnis
- Verzeichnis der Autoren und Mitarbeiter
- Abkürzungsverzeichnis
- Themeneinführung und Zusammenfassung
- Einführung
- Zusammenfassung
- Sektion I: Nürnberg – Eldorado der Patrizier
- Patrizier – Zum Selbstverständnis reichsstädtischer Oligarchen in Süddeutschland
- Distanzierte Nähe. Patriziat und Exulantenadel im Nürnberg des 17. Jahrhunderts
- Patriziat und Memoria im Spätmittelalter. Totenschilde in Nürnberg und anderen Reichsstädten
- Patrizische Archive und Sammlungen im Germanischen Nationalmuseum
- Sektion II: Der Städtevergleich
- Zu „Patriziat“ und Ehrbarkeit in Rothenburg ob der Tauber
- Patrizier in der Königs- und Reichsstadt Frankfurt am Main
- Das Patriziat der Reichsstadt Kempten
- Das Ulmer Patriziat
- Patriziat und Ratsverfassung in München
- Die Geschlechtergesellschaft „Zur Katz“ in Konstanz
- Patriziat der Hansestädte im Staat des Deutschen Ordens und seine politischen Eliten (bis 1453). Ein Überblick
- Fugger, Welser, Langenmantel als Vorfahren – das Patriziat als spannendes Entdeckungsfeld eines Laienforschers
- Spätmittelalterliche Literatur der Patrizier. Augsburg, Nürnberg und Frankfurt am Main im Städtevergleich
- Orts- und Personenregister
Wolfgang Wüst (Hrsg.)
Patrizier – Wege zur städtischen Oligarchie und zum Landadel
Süddeutschland im Städtevergleich Referate der internationalen und interdisziplinären Tagung, Egloffstein’sches Palais zu Erlangen, 7.–8. Oktober 2016
Unter Mitarbeit von Marc Holländer

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Gedruckt mit freundlicher Unterstützung der Friedrich Freiherr von Haller’schen Forschungsstiftung, des Zentralinstituts für Regionenforschung, Sektion Franken, an der FAU und der Forschungsstiftung Bayerische Geschichte.
Umschlaggestaltung: © Olaf Gloeckler, Atelier Platen, Friedberg
Umschlagabbildung:
Ölgemälde von Wilhelm Ziegler: Rothenburger Patrizierfest, 1538
Bildnachweis: Oberösterreichischen Landesmuseum, Linz, SIK-ISEA
Inventarnummer 1601040004; fotografiert von Alexandra Bruckböck
ISBN 978-3-631-74325-6 (Print)
E-ISBN 978-3-631-74655-4 (E-PDF)
E-ISBN 978-3-631-74656-1 (EPUB)
E-ISBN 978-3-631-74657-8 (MOBI)
DOI 10.3726/b13301
© Peter Lang GmbH
Internationaler Verlag der Wissenschaften
Berlin 2018
Alle Rechte vorbehalten.
Peter Lang – Berlin · Bern · Bruxelles
New York · Oxford · Warszawa · Wien
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Diese Publikation wurde begutachtet.
Wolfgang Wüst (Hrsg.)
Patrizier – Wege zur städtischen Oligarchie und zum Landadel
Die Beiträge dieses Tagungsbandes untersuchen das Phänomen der Patrizier auf dem Weg zur städtischen Oligarchie und zum Landadel. Der Schwerpunkt liegt auf der Stadt Nürnberg, wobei auch die Führungsschichten anderer süddeutscher Städte betrachtet werden. Mit Hilfe der komparatistischen Methode und damit dem Vergleich als landeshistorischer Tradition beleuchten und definieren die Beiträger den Begriff der „Patricii“ als Bezeichnung der Geschlechter kritisch, wobei sie auch auf die mittelalterliche Bezeichnung der „Herren“ und „vornehmen Geschlechter“ eingehen.
Zitierfähigkeit des eBooks
Diese Ausgabe des eBooks ist zitierfähig. Dazu wurden der Beginn und das Ende einer Seite gekennzeichnet. Sollte eine neue Seite genau in einem Wort beginnen, erfolgt diese Kennzeichnung auch exakt an dieser Stelle, so dass ein Wort durch diese Darstellung getrennt sein kann.← 4 | 5 →

Grußwort der Dr. Lorenz Tucher’schen Stiftung von 1503
Im Rahmen der am 7.11.2016 im Egloffstein’schen Palais in Erlangen veranstalteten Tagung mit dem Titel „Patrizier – Wege zur städtischen Oligarchie und zum Landadel. Süddeutschland im Städtevergleich“ konnten wir über die historische Entwicklung der Dr. Lorenz Tucher’schen Stiftung von 1503 und die heutige Praxis berichten.
Bei der Familie von Tucher handelt es sich ohne Zweifel um eine der bedeutendsten Patrizierfamilien der ehemaligen Reichsstadt Nürnberg. Erstmalig erwähnt im 14. Jahrhundert erlebte die Familie ihre Blütezeit im 16. Jahrhundert mit Handelsaktivitäten in ganz Europa, vornehmlich mit Gewürzen, Metallwaren, Tuchen und Pelzen. Im 17. Jahrhundert betrieben die Tucher zusammen mit der Familie Imhoff die letzte im größeren Umfang aktive Handelsgesellschaft des Nürnberger Patriziats. Im Jahre 1503 errichtete Lorenz I. Tucher (1447–1503) die Dr. Lorenz Tucher’sche Stiftung, welche inzwischen zu den ältesten Familienstiftungen Deutschlands gehört.
Die Tucher waren mit kurzen Unterbrechungen ab 1340 bis zum Ende der Reichsstädtischen Zeit im Jahre 1806 im kleinen Rat der Reichsstadt vertreten und gehörten nach dem sogenannten Tanzstatut zu den 20 alten ratsfähigen Geschlechtern. 1806 endete das Patriziat. 1855 erwarb Siegmund von Tucher aus Mitteln der Stiftung das vormalige „Reichstädtische Weizenbräuhaus“ und gründete daraus die „Freiherrlich von Tucher’sche Brauerei“, die lange im Besitz der Familie war, inzwischen aber zum Bielefelder Oetker-Konzern gehört.
Bei der Dr. Lorenz Tucher’schen Stiftung handelt es sich um eine nicht gemeinnützige Familienstiftung. Der Stiftungszweck besteht darin, „zu beschließen was Noth tut“. In der heutigen Zeit bedeutet dies, notleidende Familienmitglieder zu unterstützen und die Ausbildung junger Tucher zu fördern. Als Regelungswerk dient dabei eine umfassende Geschlechtsordnung in der Fassung von 1860.
Heute hat sich die Familie eine moderne Stiftungsstruktur mit einem Verwaltungs-und Familienrat gegeben, in dem Entscheidungen vorbereitet und je nach Bedeutung beziehungsweise Wert getroffen werden. Weltweit sind zirka 55 Familienmitglieder Destinatäre der Stiftung. Nur noch wenige Familienmitglieder leben ← 5 | 6 →heute in Nürnberg; dort befindet sich der Stiftungssitz im historischen Anwesen Schoppershof, welches seit 1885 zum Stiftungsvermögen gehört.
Die Stiftung ist in den Bereichen Immobilien- und Grundstücksverwaltung, Projektentwicklung und Bebauung eigener Flächen, Forstwirtschaft und im Betrieb von Freizeiteinrichtungen tätig. Über die erst 2012 errichtete gemeinnützige Tucher’sche Kulturstiftung werden kulturelle Aktivitäten der Familie gebündelt und die Familiengeschichte gepflegt.
Die Heranführung der nächsten Generationen an die große Tradition der Familie und der Stiftung in Anbetracht der seit Jahren anhaltenden „Nürnberg-Flucht“ wird neben der Erbersatzsteuer eine der großen Herausforderungen sein.
Es bleibt zu hoffen, dass es der Familie auch in Zukunft gelingt, traditionelle Werte mit moderner Fortentwicklung zu kombinieren, um den Fortbestand der Stiftung langfristig zu sichern.
Wir danken an dieser Stelle nochmals für die Einladung zu dieser Tagung, die für alle Teilnehmer sicherlich wertvolle Erkenntnisse erbracht hat.
Mit vorzüglicher Hochachtung

Dr. Thomas Hörlbacher
Vorwort
In Kooperation mit dem Verein für Geschichte der Stadt Nürnberg, dem Historischen Verein für Schwaben, dem Bayerischen Landesverein für Familienkunde e.V., der Gesellschaft für Familienforschung in Franken e.V. und der Dr. Lorenz Tucher’schen Stiftung luden der Lehrstuhl für Landesgeschichte und das Zentralinstitut für Regionenforschung (Sektion Franken) an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg im Oktober 2016 ein zu einer mehrtägigen, interdisziplinären Tagung im repräsentativen Egloffstein’schen Palais in Erlangen. Das Thema lautete: Patrizier – Wege zur städtischen Oligarchie und zum Landadel. Süddeutschland im Städtevergleich.
*
Es ist dem großen Interesse des Peter Lang Verlags – hier insbesondere des Leitenden Lektors Herrn Dr. Hermann Ühlein –, den meist willigen Autorinnen und Autoren – nicht alle Referenten konnten oder wollten allerdings ihr Manuskript zeitnah zur Druckreife bringen –, der ebenso emsigen wie disziplinierten Buchredaktion unter Federführung von Herrn Marc Holländer, B.A., und last but not least der Unbeirrbarkeit des Herausgebers und vormaligen Tagungsleiters geschuldet, dass der Band in relativ kurzer Zeit vollendet werden konnte. Erschwerend kam hinzu, dass unser wunderbares Thema eine breite inhaltliche wie räumliche Streuung im Sinne europäischer Kulturgeschichte zuließ, die ein sorgfältig gearbeitetes Register unverzichtbar machten. Ein großer Dank geht auch an Frau Lisa Bauereisen, M.A., für umfangreiche Korrekturen und Hilfestellungen sowie an Herrn Christian Gürtler für die Erstellung des Registers.
Für die finanzielle Förderung des Drucks danke ich als Herausgeber im Namen aller Autorinnen und Autoren der Forschungsstiftung für Bayerische Geschichte, der Friedrich Freiherr von Haller’schen Forschungsstiftung in Nürnberg, der Lorenz Tucher’schen Stiftung, dem Historischen Verein für Schwaben, der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und der Sektion Franken des Zentralinstituts für Regionenforschung an der FAU.
*
Unser oft aufgerufener Tagungsbericht im Online-Portal H/Soz/Kult (Kommunikation und Fachinformation für die Geschichtswissenschaften) vom ← 7 | 8 →28. Januar 20171 mag ein kleiner Vorgeschmack gewesen sein auf das nun vorliegende Buch. Ich wünsche dem ansprechend gestalteten Band als Ganzem und den Einzelbeiträgen der Autoren eine gute Aufnahme in den Medien und im Buchhandel sowie eine nachhaltige Rezeption in Wissenschaft und Öffentlichkeit.
Erlangen, am Reformationstag und dem dabei oft vernachlässigten Namensfest des heiligen Wolfgang, 31.10.2017
Wolfgang Wüst
1 Tagungsbericht: Patrizier – Wege zur städtischen Oligarchie und zum Landadel. Süddeutschland im Städtevergleich, 7.10.2016 – 8.10.2016 Erlangen, in: H-Soz-Kult, 28.1.2017, www.hsozkult.de/ceonferencereport/id/tagungsberichte-6954.← 8 | 9 →
Inhaltsverzeichnis
Grußwort der Dr. Lorenz Tucher’schen Stiftung von 1503
Verzeichnis der Autoren und Mitarbeiter
Themeneinführung und Zusammenfassung
Wolfgang Wüst
Marina Heller unter Mitarbeit von Lisa Bauereisen, Theresa Lind, Martin Seeburg, Benjamin Schmid
Sektion I: Nürnberg – Eldorado der Patrizier
Wolfgang Wüst
Patrizier – Zum Selbstverständnis reichsstädtischer Oligarchen in Süddeutschland
Werner Wilhelm Schnabel
Distanzierte Nähe. Patriziat und Exulantenadel im Nürnberg des 17. Jahrhunderts
Katja Putzer
Patriziat und Memoria im Spätmittelalter. Totenschilde in Nürnberg und anderen Reichsstädten
Matthias Nuding
Patrizische Archive und Sammlungen im Germanischen Nationalmuseum
Sektion II: Der Städtevergleich
Karl Borchardt
Zu „Patriziat“ und Ehrbarkeit in Rothenburg ob der Tauber
Andreas Hansert
Patrizier in der Königs- und Reichsstadt Frankfurt am Main
Franz-Rasso Böck
Das Patriziat der Reichsstadt Kempten← 9 | 10 →
Stefan Lang
Michael Stephan
Patriziat und Ratsverfassung in München
Christoph Heiermann
Die Geschlechtergesellschaft „Zur Katz“ in Konstanz
Renata Skowrońska
Manfred Wegele
Klaus Wolf
Orts- und Personenregister← 10 | 11 →
Verzeichnis der Autoren und Mitarbeiter
Lisa Bauereisen, M.A., Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
Dr. Franz-Rasso Böck, Stadtarchiv Kempten
Prof. Dr. Karl Borchardt, München, Monumenta Germaniae Historica
Christian Gürtler, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
Dr. Andreas Hansert, Frankfurt am Main
Dr. Christoph Heiermann, Dresden, Landesamt für Archäologie
Marina Heller, M.A., Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
Dr. Thomas Hörlbacher, Tucher Stiftung Management GmbH
Marc Holländer, B.A., Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
Dr. Stefan Lang, Landratsamt Göppingen, Kreisarchiv
Theresa Lind, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
Dr. Matthias Nuding, Germanisches Nationalmuseum
Dr. des. Katja Putzer, Germanisches Nationalmuseum
Martin Seeburg, B.A., Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
Benjamin Schmid, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
Dr. Renata Skowrońska, Nikolaus-Kopernikus-Universität Toruń
Heiner Stauder, M.A., Stadtarchiv Lindau und ehemals reichsstädtische Bibliothek
Dr. Michael Stephan, Archiv der Landeshauptstadt München
Prof. Dr. Werner W. Schnabel, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
Manfred Wegele, Bayerischer Landesverein für Familienkunde, Bezirksgruppe Schwaben
Prof. Dr. Klaus Wolf, Universität Augsburg
Prof. Dr. Wolfgang Wüst, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg← 11 | 12 →← 12 | 13 →
Details
- Pages
- 316
- Publication Year
- 2018
- ISBN (Hardcover)
- 9783631743256
- ISBN (PDF)
- 9783631746554
- ISBN (ePUB)
- 9783631746561
- ISBN (MOBI)
- 9783631746578
- DOI
- 10.3726/b13301
- Language
- German
- Publication date
- 2019 (April)
- Keywords
- Reichsstädte Komparatistik Landesgeschichte Patriziat Reformation Verfassungsgeschichte
- Published
- Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 2018. 315 S., 27 farb. Abb., 11 s/w Abb.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG