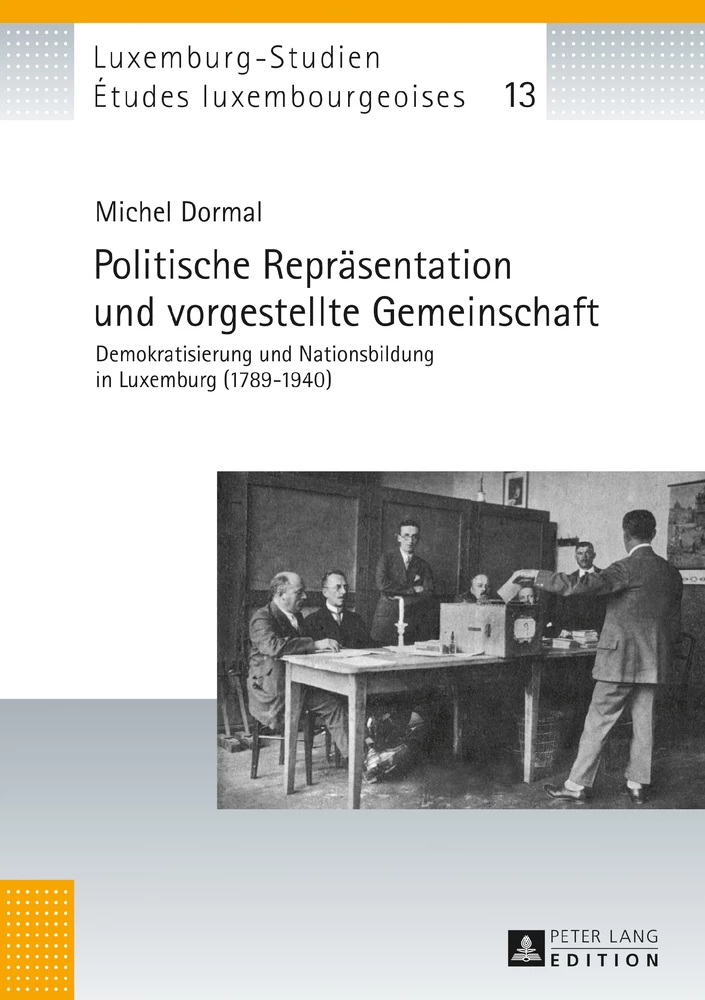Politische Repräsentation und vorgestellte Gemeinschaft
Demokratisierung und Nationsbildung in Luxemburg (1789–1940)
Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autoren-/Herausgeberangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Vorbemerkung
- Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Thema und Fragestellung
- 1.2 Eine Geschichte des Politischen – Ansatz und Methode
- 1.2.1 Politik und Geschichte in der Forschung
- 1.2.2 Der Begriff des Politischen
- 1.2.3 Die ‚histoire conceptuelle du politique‘
- 1.2.4 Kritik oder Erzählung
- 1.3 Aufbau der Arbeit
- 2. Eine demokratietheoretische Perspektive auf Repräsentation und Nation
- 2.1 Die Nation ist nicht durch konkrete Merkmale zu definieren
- 2.2 Die Nation ist nicht mit einer Vertragsgemeinschaft zu verwechseln
- 2.3 Die Nation ist ein politisches Phänomen der Moderne
- 2.4 Die Nation ist keine Willensgemeinschaft
- 2.5 Nation ist eine Ressourcengemeinschaft
- 2.6 Jede Nation hat drei Gesichter: Souverän, Bürger, Geschichte
- 2.7 Das allgemeine Wahlrecht gibt dem Gemeinwesen eine neue Form
- 2.8 Demokratie ist eine Praxis
- 2.9 Nationalrepräsentation wandelt sich zur Konfliktrepräsentation
- 2.10 Repräsentation hat eine figurative Dimension
- 2.11 Nation ist ein Einsatz im Streit um Hegemonie
- 2.12 Nationsbildung ist eine politische Verarbeitung von Klassenkonflikten
- 2.13 Vier Schwellen der Nationsbildung
- 2.14 Es gibt einen Unterschied zwischen Nation und Nationalismus
- 2.15 Nation und Demokratie bilden eine antagonistische Symbiose
- 3. Historischer Forschungsstand, Kontext und Quellen
- 3.1 Stand der Literatur
- 3.2 Der Aufbau eines modernen Staatsapparats
- 3.3 Sozialer Wandel und Diversität
- 3.4 Quellenlage und Quellenkritik
- 4. Von der ständischen Repräsentation zur Gemeinschaft der Gleichen
- 4.1 Ausgangsbedingungen. Repräsentation ohne Demokratie und Nation
- 4.1.1 Die Entwicklung der politischen Repräsentation vor der Staatsbildung
- 4.1.2 Die Ständeversammlung im neuen Staat
- 4.2 Die Schwelle der öffentlichen Kritik
- 4.2.1 ‚Cahiers de Doléance‘ und der Ruf nach Öffentlichkeit
- 4.2.2 Repräsentation und Öffentlichkeit
- 4.2.3 Öffentliche Meinung und Nation
- 4.3 Die Schwelle des Wahlrechts. Der Kampf um Gleichheit
- 4.3.1 Überblick
- 4.3.2 Ambivalenter Liberalismus: 1848 und das Wahlrecht
- 4.3.3 Quantitative und rechtliche Entwicklung des Wahlrechts im 19. Jahrhundert
- 4.3.4 Dominanz der Rationalität des Privilegs und zögerliche Kritik
- 4.3.5 Eine neue Bewegung für das allgemeine Wahlrecht
- 4.3.6 Rückzugsgefechte der zensitären Rationalität
- 4.3.7 Das neue Verständnis des Wahlrechts setzt sich durch
- 4.3.8 Was ist allgemein? Das Frauenwahlrecht
- 4.4 Zusammenfassung und Diskussion
- 5. Die Nationalisierung der Einheitsrepräsentation
- 5.1 Einleitung und Vorbemerkung zum Begriff der Souveränität
- 5.2 Einheit und Souveränität in den Verfassungskämpfen des 19. Jahrhunderts
- 5.2.1 Parlamentarismus ohne Einheitsrepräsentation
- 5.2.2 Die Rückkehr des Königs
- 5.2.3 Auf der Suche nach dem Repräsentanten der Souveränität
- 5.3 Die Nationalisierung der Einheitsrepräsentation im 20. Jahrhundert
- 5.3.1 Die Monarchie und die Polarisierung des Konflikts bis 1916
- 5.3.2 Die Monarchie in der Debatte über die Verfassungsreform
- 5.3.3 Krise und Republik
- 5.3.4 Die Nation in der Auseinandersetzung um Hegemonie
- 5.3.5 Das Referendum und die Folgen
- 5.4 Zusammenfassung und Diskussion
- 6. Repräsentation und Politisierung sozialer Konfliktlinien
- 6.1 Einleitung
- 6.2 Die Blütezeit der Honoratiorenrepräsentation
- 6.3 Unsicherheiten: Die Demokratie auf der Suche nach ihrer Form
- 6.4 Politisierung der Konfliktlinien und Genese des Parteiensystems
- 6.4.1 Staat und Kirche
- 6.4.2 Stadt und Land
- 6.4.3 Arbeit und Kapital
- 6.5 Die Proportionen des Volkes
- 6.6 Repräsentation des sozialen Konflikts und Nation: Zwei Fallbeispiele
- 6.6.1 Die Auseinandersetzung über die Arbeitslosenpolitik von 1921
- 6.6.2 Der Conseil National du Travail
- 6.7 Zusammenfassung und Diskussion
- 7. Weimarer Debatten in Luxemburg? Krise und Resilienz der Repräsentation
- 7.1 Einleitung
- 7.2 Die erste Versuchung der organisierten Gesellschaft: Sozialismus und Korporatismus
- 7.3 Die zweite Versuchung der organisierten Gesellschaft: Berufsständische Ordnung
- 7.4 Krise des Parlamentarismus und der Ruf nach Rationalisierung
- 7.5 Die nationalistische Fantasie der Einheitsrepräsentation
- 7.6 Von der Krise zur Verteidigung der Demokratie
- 7.6.1 Die Arbeiterpartei und der Parlamentarismus
- 7.6.2 Die endgültige Entleerung des Ortes der Macht. Streit um das Ordnungsgesetz
- 7.6.3 Die große Koalition und die Nation
- 7.7 Zusammenfassung und Diskussion
- 8. Schluss
- 8.1 Zusammenfassung
- 8.2 Die politische Gegenwart im Spiegel der Geschichte
- Quellenverzeichnis
- Literatur
- Index
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts attestierte Max Weber (2002, 529) in einem Fragment aus Wirtschaft und Gesellschaft den Luxemburgern eine „völlige Indifferenz gegenüber der Idee der Nation“. Das mag damals nicht mehr ganz gestimmt haben. Doch in der Tat gibt es für das gesamte Mittelalter kein Zeugnis, in dem die Einwohner auf dem Gebiet des späteren Großherzogtums sich selbst als Luxemburger oder Angehörige einer Luxemburger Nation bezeichnen würden (Pauly 2011, 52). Die neuere historische Forschung hat sich in den letzten Jahren erfolgreich um den Nachweis bemüht, dass die luxemburgische Nation als kollektive Vorstellung eine Erfindung – der Begriff ‚Erfindung‘ ist hier aber nicht (ab)wertend gemeint – recht jungen Datums und mithin Ergebnis eines erst im späten 19. Jahrhundert einsetzenden Prozesses der Nationalisierung der Gesellschaft ist (Kmec u. a. 2008, Péporté u. a. 2010). Damit wurde die im 20. Jahrhundert in der Geschichtsschreibung lange dominierende Ursprungserzählung, die eine nationale Kontinuität von der sagenumwobenen ‚Gründung‘ Luxemburgs im Jahre 963 bis zur Gegenwart unterstellte und dabei ganze Jahrhunderte zu Epochen der ‚Fremdherrschaft‘ erklärte, einer fälligen Revision unterworfen. Welche Faktoren prägten diesen Prozess der ‚Erfindung‘ der Nation in Luxemburg? Die jüngere Forschungsliteratur hat sich dieser Frage vor allem aus kulturwissenschaftlicher Perspektive gewidmet, indem sie gezeigt hat, wie durch Schulbücher, Literatur oder Architektur bestimmte Vorstellungen über Territorium, Sprache und Geschichte gefestigt wurden.
Die kulturelle Entwicklung kann aber nicht losgelöst von der politischen Dynamik betrachtet werden. In der Literatur wird an vielen Stellen darauf verwiesen, dass kulturelle Konstruktionen oft politischen Legitimationszwecken dienten. Die vorliegende, von einem Politikwissenschaftler verfasste Studie greift diesen Gedanken auf und stellt die politische Macht ins Zentrum. Genauer: die Demokratisierung der Macht. Geschichtsschreibung tendierte lange Zeit dazu, Politik und Macht vor allem unter dem Gesichtspunkt der Außenpolitik zu betrachten. Mir geht es dagegen um die Demokratisierung der inneren Verhältnisse. Natürlich ist letztere auch den Historikern nicht ganz fremd. Anlässlich der Unabhängigkeitsfeier von 1989 behauptete etwa Gilbert Trausch (1989a, 32) eher beiläufig, die Entstehung und Festigung der luxemburgischen Nation verdanke sich dem „bon fonctionnement de la démocratie“. Für die politikwissenschaftliche Perspektive eröffnet diese These Anknüpfungsmöglichkeiten. Zugleich drängen sich Nachfragen auf. Was ist genau ← 11 | 12 → gemeint, wenn von Demokratie die Rede ist? Welche Bevölkerungsgruppen hatten daran teil, welche wurden ausgegrenzt? Wann und warum kann man sagen, dass Demokratie gut funktioniert? Trausch scheint hier vor allem an die staatliche Leistungsfähigkeit, an den Output, zu denken. Aber hat Demokratie nicht vielleicht mehr mit dem Input, also mit der Weise, wie Interessen und Meinungen unter Gleichen artikuliert werden, zu tun? Und wie hängt dies mit dem Erfolg nationaler Erzählungen und Deutungen zusammen? Mit diesem Fragenkomplex sind das Ausgangsproblem und das Erkenntnisinteresse der vorliegenden Studie umrissen. Der von mir untersuchte Zeitraum umfasst dabei die wichtigsten Auseinandersetzungen rund um die Demokratie. Letztere begannen in Luxemburg mit der ‚Fundamentalpolitisierung‘ in den vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts und hielten bis in die dreißiger Jahre des 20. Jahrhunderts an. In diese knapp hundert Jahre fallen zentrale Demokratisierungsschritte: Die Parlamentarisierung der Regierung, die Herausbildung eines Parteiensystems, die verschiedenen Reformen, die zum allgemeinen Wahlrecht führten oder auch die ersten, umstrittenen Anfänge einer Wirtschaftsdemokratie. Historisch nahm Luxemburg damit keine Sonderstellung ein. Alles in allem folgte es, wenn auch gelegentlich mit leichter Verzögerung, dem Trend der ersten großen Welle der Demokratisierung in Europa.1
Es gibt natürlich unterschiedliche Modelle und Definitionen von Demokratie. Zwar werden meist ähnliche Merkmale und Dimensionen genannt. Dennoch weichen Begrifflichkeit, Schwerpunktsetzung und Herangehensweise teils erheblich ab. Ich stelle im Folgenden die politische Repräsentation in den Mittelpunkt. Denn die Demokratie war und ist in Luxemburg, wie in allen westlichen Demokratien, repräsentativ verfasst. Von der Repräsentation auszugehen, bedeutet, von den Handlungsmöglichkeiten der Menschen auszugehen, von den politischen Forderungen, die sie artikulieren, und den Widersprüchen und Konfliktlinien, die sich dabei als maßgeblich erweisen. Andere mögliche Blickwinkel auf Politik treten damit in den Hintergrund. Das betrifft insbesondere die staatliche Außenpolitik sowie Fragen der Steuerung, der Problemlösung und der Politikimplementierung, kurz den politischen Output. Über den Output lässt sich immer streiten. Demokratie hat hingegen mehr damit zu tun, wer streitet, wie gestritten wird und wie Streitigkeiten entschieden werden. Der Anspruch auf eine wie auch immer verstandene ‚Repräsentativität‘ von Standpunkten, Entscheidungen und Institutionen gehört dabei zu den konstitutiven demokratischen Versprechen. Die Feststellung, dass Luxemburg eine repräsentative Demokratie ist, fehlt denn ← 12 | 13 → auch in keiner Überblicksdarstellung der politischen Institutionen. Ein Beitrag in einem neueren Lehrbuch zum politischen System Luxemburgs beginnt beispielsweise mit der Aussage, seit der Verfassungsreform von 1919 sei „die Nation der Souverän“, die „Wahrnehmung der Souveränitätsattribute“ aber der Einfachheit halber „an Stellvertreter übertragen“ worden (Hirsch und Thewes 2008, 93). Diese Aussage scheint den Autoren wenig Kopfzerbrechen zu bereiten. Doch schauen wir genauer hin: Was ist Souveränität? Lässt sie sich übertragen? Was heißt ‚stellvertreten‘? Was wird von wem repräsentiert? Gibt es ein Repräsentationsdefizit, wenn das Parlament kein „Spiegelbild der Gesellschaft“ (Tageblatt 2013) ist, wie nach den letzten Wahlen moniert wurde? Und natürlich: Was ist eigentlich eine Nation? Auf solche Fragen bietet die gängige Lehrbuchterminologie keine zufriedenstellende Antwort. Sie ist nur bedingt geeignet, die innere Komplexität und historische Dynamik zu begreifen, die das Verhältnis von Repräsentation, Demokratie und Nation bestimmt. Ich hoffe, mit meiner Arbeit diese Lücke ein Stück weit schließen zu können.
Die vorliegende Studie untersucht demnach die Nationsbildung in Luxemburg als Prozess der Ausweitung und Transformation politischer Repräsentation. Als Fragestellung formuliert: Welche Rolle spielten die politische Repräsentation, ihr Wandel und die Auseinandersetzung um die Teilhabe an ihr für das Entstehen einer geteilten Vorstellung und Erzählung der Nation? Ich habe zu dieser Frage eine Vermutung. Sie lautet, dass politische Repräsentation, und zwar vor allem die Repräsentation des Konflikts, in der Tat eine wichtige und unterschätzte Quelle von Nationsbildung ist. Diese Vermutung wird in Kapitel 2 anhand einer Reihe von Thesen genauer erläutert. Zuvor wird in Abschnitt 1.2 der interdisziplinäre Ansatz der Arbeit und in Abschnitt 1.3 der weitere Aufbau der Darstellung skizziert.
1.2 Eine Geschichte des Politischen – Ansatz und Methode
In der Fragestellung meiner Studie treffen sich zwei Erkenntnisinteressen, die sich aus dem interdisziplinären Forschungskontext ergeben. Von einem Politikwissenschaftler verfasst, ist die Arbeit zugleich ein Ergebnis des in der Geschichtswissenschaft angesiedelten Forschungsprojekts ‚Nationenbildung und Demokratie‘ an der Universität Luxemburg. Gegenstand dieses mittlerweile abgeschlossenen Projekts war der Zusammenhang zwischen der Nationsbildung und den Auseinandersetzungen um politische, kulturelle und wirtschaftliche Teilhabe in Luxemburg seit 1789 (Franz und Lehners 2013). Vor allem die Rolle von Frauen, Arbeitern, Migranten, Juden und der ländlichen Bevölkerung wurde dabei untersucht. Die vorherrschende Rekonstruktion der Nationsbildung aus Sicht der Eliten sollte um eine Perspektive ergänzt werden, die den Beitrag anderer Bevölkerungsgruppen ← 13 | 14 → systematisch in den Blick nimmt. Denn unterschiedliche Gruppen verbinden verschiedene Erfahrungen mit der Nation. Das trägt zur allgemeinen Attraktivität der Nation als Form des politischen Gemeinwesens bei, verbietet es aber auch, sie umstandslos mit den Selbstbildern der Eliten zu identifizieren (Haupt und Tacke 1996, 262). Aus diesem breiten historischen Forschungsprogramm bearbeite ich eine Teilfrage, nämlich jene nach dem Zusammenhang zwischen der Nationsbildung und der Repräsentation von gesellschaftlichen Konfliktlinien.
Zugleich schließt die vorliegende Studie auch an die Fragestellungen des 2012 abgeschlossenen politikwissenschaftlichen Forschungsprojekts ‚Formen und Funktionsweisen politischer Repräsentation von Fremden und Armen‘ im Sonderforschungsbereich 600 an der Universität Trier an. Im Zentrum dieses Forschungsprojekts stand die Arbeit an einem angemessenen Verständnis der verschiedenen Funktionsweisen politischer Repräsentation. Bereits seit längerem wurde moniert, dass die politikwissenschaftliche Repräsentationstheorie defizitär bleibe und seit dem Standardwerk von Hanna Pitkin (1972) auf der Stelle trete (so schon Eulau und Wahlke 1978). Angesichts eines anhaltenden „Unbehagen[s] an der Demokratietheorie“ (Buchstein und Jörke 2003) und sich häufenden Stimmen, die auch eine empirische Krise der repräsentativen Demokratie diagnostizieren (siehe Linden und Thaa 2011a), wurde daher in den letzten Jahren vermehrt ein verfeinertes Verständnis für Fragen der politischen Repräsentation angestrebt.2 Was bedeuten die Begriffe ‚Repräsentation‘ oder ‚Repräsentativität‘ in der Sphäre des Politischen? Welche Wandlungsprozesse haben diese Bedeutungen durchlaufen? Ist demokratische Repräsentation nur im Nationalstaat möglich oder auch in transnationalen Kontexten? Die hier vorgelegte empirische Studie kann zur Klärung dieser Fragen einen kleinen Beitrag leisten, indem sie einen Blick zurückwirft und die keineswegs bruchlose Entwicklung demokratischer Repräsentation historisch rekonstruiert. Das Fallbeispiel Luxemburg erlaubt dabei einen neuen Blick auf Probleme, die bislang eher im französischen oder angelsächsischen Kontext diskutiert wurden.
Aus dem interdisziplinären Forschungskontext ergeben sich Herausforderungen. Denn jedes Fach hat seine etablierten Grundbegriffe und Paradigmen, die nicht mehr stets aufs Neue diskutiert werden müssen. Interdisziplinäre Forschung muss sich um solche Reflexion hingegen doppelt bemühen. Ich möchte dies im Folgenden in mehreren Schritten tun. Dazu frage ich zunächst, in welchem Verhältnis Politik und Geschichte stehen, und gehe auf die Schwierigkeit ein, den ← 14 | 15 → Gegenstand von Politikgeschichte genau zu bestimmen (1.2.1). Anschließend versuche ich, den Politikbegriff genauer zu klären, und führe die Unterscheidung zwischen der Politik und dem Politischen ein (1.2.2). Von dieser Unterscheidung ausgehend skizziere ich die Grundgedanken einer Geschichtsschreibung des Politischen (1.2.3). Zuletzt gehe ich auf die Frage nach dem normativen Status einer solchen Geschichtsschreibung ein (1.2.4). Der an der Empirie interessierte Leser mag diese Abschnitte überspringen. Allerdings wird sich ihm die Art und Weise der historischen Darstellung und Schwerpunktsetzung dann nicht ohne Weiteres erschließen.
1.2.1 Politik und Geschichte in der Forschung
Die Frage nach dem Verhältnis von Politik und Geschichte stellt sich in doppelter Hinsicht. Erstens ist der sachliche Zusammenhang ins Auge zu fassen: die historische Dimension des Politischen und die politische Dimension von Geschichte (a). Zweitens ist auch das Verhältnis von Geschichts- und Politikwissenschaft als wissenschaftlichen Disziplinen zu klären (b).3
a) Politik und Geschichte sind nicht zwei unterschiedliche Untersuchungsgegenstände. Zwar ist ‚Geschichte‘ weit mehr als nur Politik, die Beschäftigung mit ‚Geschichte‘ besitzt aber gerade darum letztlich gar keinen besonderen Gegenstand (Koselleck 2000, 301). Bereits Max Weber (2002, 2) verstand Sozial- und Geschichtswissenschaft gleichermaßen als „empirische Wissenschaften vom Handeln“, die sich ein und denselben sachlichen Gegenstand teilen und nur durch ihre Erkenntnisperspektive unterscheiden. Während die Soziologie auf allgemeine Erklärungen ziele, beschäftige sich die Geschichtswissenschaft bevorzugt mit der „Analyse und Zurechnung individueller, kulturwichtiger, Handlungen, Gebilde, Persönlichkeiten“ (Weber 2002, 9). Die wenigsten ernsthaften Historiker würden sich aber heute noch auf die Untersuchung einzelner Ereignisse, Persönlichkeiten und Handlungen festlegen lassen. Spätestens unter dem Einfluss der französischen Schule der Annales, die ihrerseits u. a. von der Soziologie Durkheims inspiriert war, wurde der Anspruch der Verallgemeinerbarkeit, den Weber für die Sozialwissenschaft reservierte, auch von den Historikern eingefordert (siehe Burke 2004). Geschichtswissenschaft lässt sich letztlich nicht anders denn als historische Gesellschaftswissenschaft verstehen. ← 15 | 16 →
Sucht man nach einem tragfähigen Kriterium, bleibt auf den ersten Blick nur der spezifische methodische Zugang des Historikers über die Quellen, nicht aber ein Unterschied in dem, was untersucht wird, um die Geschichtswissenschaft von anderen Sozialwissenschaften einigermaßen trennscharf zu unterscheiden (siehe dazu auch Thompson 1980, 81 ff.). Geschichtswissenschaft rekonstruiert anhand von Quellen und Zeugnissen, angeleitet von wissenschaftlichen Methoden und Kriterien, plausible Zusammenhänge aus den für sich genommen keineswegs aussagekräftigen Trümmern einer „vergangenen Vergangenheit, die dem Beobachter in ihrer Komplexität nicht authentisch zugänglich ist“ (Mergel und Welskopp 1997a, 27 f.). Aber Geschichte ist nichts, das sich neben anderen Dingen auch noch als Teil der Gesellschaft ereignen würde. Alles, was in der Gesellschaft passiert, kann potentiell als Teil von Geschichte thematisiert werden. Geschichte liegt quer zu der sachbezogenen Einteilung des Sozialen in Politik, Recht oder Wirtschaft. Solche Differenzen werden nicht zufällig innerhalb der Geschichtswissenschaft als Spezialisierungen wieder nachgebildet. Im einfachsten Sinne ergibt sich ‚Geschichte‘ also schlicht daraus, dass ‚Gesellschaft‘ sich nur in der Zeit denken lässt.4 ‚Geschichte‘ ist die explizite Selbstbeobachtung von Gesellschaft anhand des Kriteriums der Vergangenheit. Vor diesem Hintergrund sieht René Rémond (1996b, 11) die eigentliche Aufgabe des Historikers darin, „d’observer les changements qui affectent la société et […] d’en proposer des explications“. Auch für Jürgen Kocka (1986, 100) besteht das Hauptgeschäft des Historikers in der „Erklärung des gesellschaftlichen Wandels in der Zeit“. Koselleck glaubt gar, „dass die ubiquitär angelegte Historie nur als Wissenschaft bestehen kann, wenn sie eine Theorie der geschichtlichen Zeiten entwickelt, ohne die sich die Historie als Allesfragerin ins Uferlos verlieren müsste“ (Koselleck 2000, 302).
Es muss also jeder Historiker ein Stück weit Politikwissenschaftler werden, sobald er sich systematisch mit dem Politischen befasst, ein Stück weit Soziologe, sobald die Sozialstruktur zum Thema wird. Geschichtswissenschaft ist daher unweigerlich auch „immer angewandte Gesellschaftstheorie“ (Mergel und Welskopp 1997b, 29). Das gilt natürlich auch nach der anderen Seite. Der Sozialwissenschaftler, der sich mit der geschichtlichen Dimension seines Gegenstandes befassen will, kommt nicht umhin, von den Historikern zu lernen. Gelegentlich ist von einem regelrechten „historic turn“ in den Geistes- und Sozialwissenschaften die Rede ← 16 | 17 → (McDonald 1996). Vor diesem Hintergrund fasst Wehler zusammen: „Praktisch hat Geschichte es unablässig mit Gesellschaft, hat Soziologie es mit Geschichte zu tun“ (Wehler 1980, 44). Und von Seiten der Soziologen sekundiert Bourdieu: „Ich darf wohl sagen, dass einer meiner ausdauerndsten Kämpfe […] darauf zielt, die Entstehung einer vereinigten Sozialwissenschaft zu fördern, wobei Geschichte eine historische Soziologie der Vergangenheit und die Soziologie eine Sozialgeschichte der Gegenwart wäre“ (Bourdieu 2004, 104). Das darf analog auch für die Politikwissenschaft gelten. Einige der meistgelesenen Werke der Politischen Theorie sind in der Tat zugleich wichtige historische Studien – man denke an die große Machiavelli-Studie von Münkler (1982), an die Analyse totaler Herrschaft bei Hannah Arendt (2006a) oder die Geschichte der bürgerlichen Öffentlichkeit von Jürgen Habermas (2006).
b) Neben diesen allgemeinen Überlegungen über den gemeinsamen Gegenstand steht die Frage nach dem konkreten Verhältnis der Disziplinen in der Praxis. Bisher wurde in der Literatur vor allem das disziplinäre Verhältnis von Geschichtswissenschaft und Soziologie aufgearbeitet (McDonald 1996; Mergel 1998; Bourdieu 2004). Während Historiker und Soziologen dabei über den Begriff der Gesellschaft zuletzt ein gemeinsames Terrain fanden, bleibt der Austausch mit der Politikwissenschaft schwierig (in Ansätzen Patzelt 2007). Eine Ursache dieser Schwierigkeit ist das ambivalente Verhältnis der Historiker zur Politik. Im 19. und frühen 20. Jahrhundert pflegten, wie Kocka (1986, 52) und Wehler (1980, 44) rückblickend kritisieren, zahlreiche Historiker eine besondere Zuneigung zum Staat und dessen Bannkreis. Das Selbstverständnis der frühen Historiker war oft das von „nationalpädagogischen“ Apologeten des eigenen Staates (Borowsky 1998, 476). Diese problematische Affinität provozierte im 20. Jahrhundert eine Gegenbewegung innerhalb der Geschichtswissenschaft. Idealismus, Individualismus, unwissenschaftliche Psychologisierung und die Fixierung auf Entscheidungshandeln waren nur einige der – berechtigten – Einwände gegen die einst dominierende Ereignisgeschichte von großen Staatsmännern und ihren Taten (Julliard 1974; Wehler 1975; Borowsky 1998; Landwehr 2003, 79 ff.). In Abgrenzung dazu suchten manche Historiker nun die Annäherung an die junge empirische Sozialforschung. Neben der Soziologie fungierten die Geographie und die Demographie als Referenzwissenschaften; insbesondere in Frankreich gewann die quantifizierende Analyse sozialer Strukturen an Bedeutung, während Politik zum Überbauphänomen degradiert wurde (Burke 2004, 68–73; vgl. Le Goff 1978, 215). Auch in Deutschland geschah die Annäherung der Geschichte an die Sozialwissenschaft, die sich in dem neuen Konzept der Sozial- und Gesellschaftsgeschichte niederschlug (Kocka 1986), vor allem mit Blick auf die empirische Soziologie. ← 17 | 18 → Nicht mehr die Staatsführung, sondern die Bevölkerung, die Warenströme oder die Berufsstruktur wurden zum bevorzugten Gegenstand. Die Eigenlogik der Politik geriet dabei bisweilen aus dem Blick.
Vor diesem Hintergrund kam es in den 1970er und 1980er Jahren wiederum zu zögerlichen Bemühungen um eine ‚Neue Politikgeschichte‘, die, ohne in alte Fehler zu verfallen, wieder grundsätzlicher nach der Bedeutung des Politischen fragte. Zum ersten Mal wurde dabei der Kontakt mit der modernen Politikwissenschaft gesucht. In einem einschlägigen Text hieß es beispielsweise: „Le renouvellement de l’histoire politique se fera […] au contact de la science politique, discipline […] en pleine expansion, et dont l’historien ne peut plus ignorer les recherches“ (Julliard 1974, 235). Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang der Einfluss von René Rémond. Im Jahr 1988 erschien die erste Ausgabe des von ihm herausgegebenen programmatischen Sammelbandes Pour une histoire politique (Rémond 1996a; siehe auch Jennings 2001). Der These eines Primats der Sozialstruktur hielt er darin die relative Autonomie des politischen Handelns entgegen und insistierte, dass „les choix politiques ne sont pas le simple décalque des rapports de forces entre catégories socioprofessionnelles“ (Rémond 1996b, 21). Im Zuge dieser Kontaktaufnahme mit der Politikwissenschaft gingen einige Historiker dazu über, z. B. das offenere Konzept des politischen Systems zu verwenden. Anders als der alte Staatsbegriff betont der Systembegriff die Prozessdimension und verspricht, auch sub- und nichtstaatliche Akteure und Faktoren zu erfassen. Mit dieser Öffnung haben sich die Historiker aber zugleich eine Reihe von neuen Problemen eingehandelt, die zum Teil aus der Politikwissenschaft mit importiert wurden – etwa die Frage nach den „Grenzen des Systems“ (Wehler 1975, 366). Wann gehört etwas oder jemand zum politischen System? Wie kommt diese Grenzziehung zustande?
Neben dem Systemkonzept importierten die Historiker noch einen zweiten wichtigen Begriff aus der Politikwissenschaft: die politische Kultur.5 Sie wurde vor allem dort diskutiert, wo die neue Politikgeschichte mit der Wende zur erneuerten Kulturgeschichte zusammentraf.6 Der Begriff der politischen Kultur schien in diesem Zusammenhang wie geschaffen, der neuen Politikgeschichte ← 18 | 19 → Forschungsfelder jenseits der engen Fixierung auf Herrschaft und Diplomatie zu eröffnen. Aus dem kombinierten Projekt einer Kulturgeschichte der Politik sind in den letzten Jahren interessante Arbeiten entstanden, die aber auch die konzeptionellen Probleme verdeutlichen (Lipp 1996; Mergel 2002; Landwehr 2003; Blänkner 2005). Ist das Kulturelle der symbolische Überbau von Politik? Oder ist die Kulturgeschichte eine spezielle Forschungsperspektive? Sollen auch jene Bereiche der Kultur und des Alltags, die bisher gerade nicht als politisch galten, Gegenstand der Analyse werden? In diese Richtung gehen beispielsweise historische Fragestellungen, die auf die mikro- und „kryptopolitischen“ Funktionen von Familienstrukturen, Sportvereinen oder Festveranstaltungen abzielen (Lipp 1996, 91 f.). Solche Verallgemeinerung provoziert aber unweigerlich die Gegenfrage: „Was ist dann Nicht-Politik?“ (Mergel 2002, 586). Diese Unklarheit beklagt auch Blänkner (2005, 75): „Von einer Kulturgeschichte des Politischen wird man […] einerseits mehr erwarten dürfen als die Beschreibung von politischen Festen und Fahnen, zum anderen wird sie sich intensiver auf die Präzisierung dessen einlassen müssen, was als das ‚Politische‘ bezeichnet wird“. Im Gegensatz zur Politikwissenschaft verfügt die Geschichtswissenschaft nicht über eine Reflexionsinstanz, die solche Fragen umfassend aufarbeitet. Bis heute bleibt daher häufig unklar, wie sich die „Untersuchungsfelder und Themen […] systematisch bündeln lassen und was den spezifischen Gegenstandsbereich der Politischen Geschichte bildet“ (Borowsky 1998, 484). Auch Corneließen (2000, 134) verweist auf die „Vielschichtigkeit des Begriffs der Politik“ und kann für „das Feld der politischen Geschichte weder räumliche noch zeitliche oder thematische Grenzen“ angeben. Es führt für die Politikgeschichte daher kein Weg an der Auseinandersetzung mit der Politischen Theorie vorbei.
Details
- Seiten
- 389
- Erscheinungsjahr
- 2017
- ISBN (Hardcover)
- 9783631717318
- ISBN (PDF)
- 9783631717325
- ISBN (ePUB)
- 9783631717332
- ISBN (MOBI)
- 9783631717349
- DOI
- 10.3726/b10818
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2017 (Februar)
- Schlagworte
- Nationale Identität Wahlrecht Partizipation Verfassungsgeschichte Benelux-Länder Parteiengeschichte
- Erschienen
- Frankfurt am Main, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 2017. 389 S., 4 s/w Tab.
- Produktsicherheit
- Peter Lang Group AG