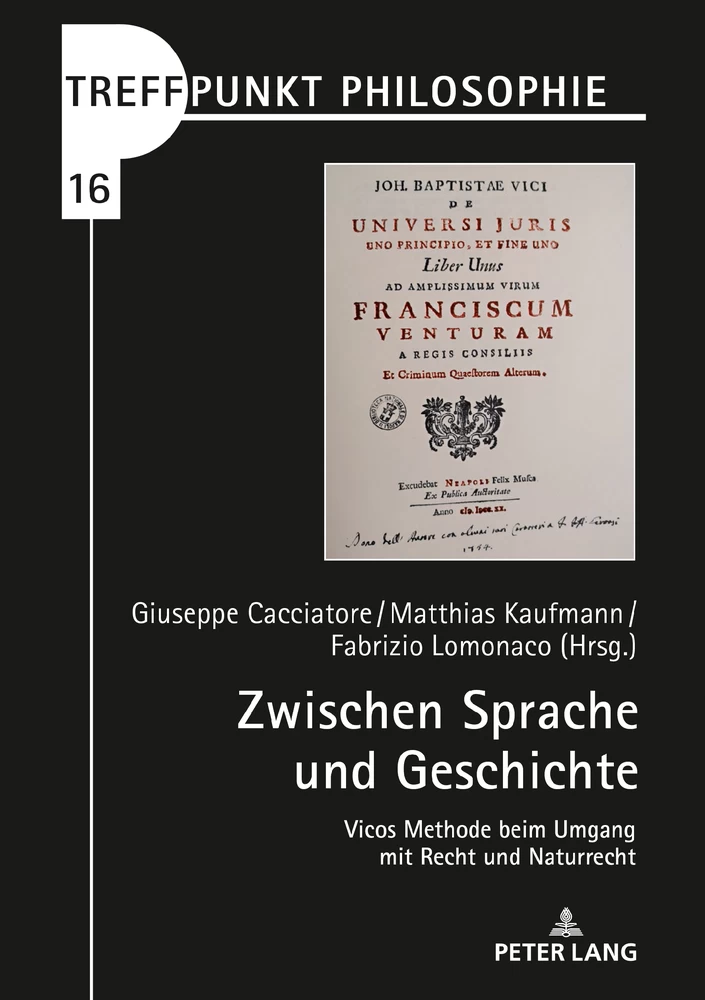Zwischen Sprache und Geschichte
Vicos Methode beim Umgang mit Recht und Naturrecht
Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Title Page
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Inhaltsverzeichnis
- Siglenverzeichnis
- Giuseppe Cacciatore, Matthias Kaufmann, Fabrizio Lomonaco: Einführung
- Romana Bassi: Giambattista Vico und Francis Bacon: „De Uno“ im Lichte des „Exemplum Tractatus De Iustitia Universali, Sive De Fontibus Iuris“1
- Giuseppe Cacciatore: Der Zusammenhang zwischen der Universalität des Gesetzes und der empirischen Geschichtlichkeit der Civitas in Vicos Begriff der Bürgerschaft
- Giuseppe D’Anna: “Genese” und “Komposition” in Vicos De Uno
- Antonino Falduto: Vico, das Naturrecht und der Begriff Obligatio
- Rossella Gaglione: From Flash-storms to Enlightenment? Pinchard reads Vico
- Giulio Gisondi: Giambattista Vico and the Problem of Method between Rhetoric and Experimentalism
- Julia V. Ivanova – Pavel V. Sokolov: Physica Ingeniosa and Abyssinian Philosophy: The Ambivalence of the Cartesian Physics in De Ratione, V1
- Matthias Kaufmann: Giambattista Vicos Umgang mit dem Begriff des Dominium
- Stefan Knauß: „Aus den tiefsten Mysterien der Philosophie“- Giambattista Vicos Naturrechtslehre zwischen Metaphysik und Geschichte
- Fabrizio Lomonaco: Between Law and Religion. A Contribution to Textual Criticism of De Uno
- Claudia Megale: The Origins of the Vichian Interest in History: Themes and Profiles of the De ratione
- Dominik Recknagel: Vicos Vindiciae. Eine Auseinandersetzung um den Naturrechtsbegriff
- Stefania Sini: “Old European and Catholic Cheerfulness” some Observations on “Literature” according to Giambattista Vico between the Republic of Letters and the World of Nations1
- Autorinnen und Autoren
- Personenverzeichnis
Giuseppe Cacciatore, Matthias Kaufmann, Fabrizio Lomonaco
Einführung
Die komplizierte geopolitische Lage der gegenwärtigen Welt stellt die kritisch reflektierenden Menschen aller Nationen vor entsprechend komplexe ethisch-juridische Fragen, denen sich noch kein vorangegangenes Zeitalter mit vergleichbarer Dringlichkeit gegenüber sah. Der Wegfall einiger geographischer wie kultureller Grenzen, die traditionell als Wasserscheiden zwischen den diversen, für gewöhnlich als „Kulturen“ oder „Zivilisationen“ bezeichneten menschlichen Siedlungszonen dienten, zumindest mehrheitlich so wahrgenommen wurden, bringt Moralvorstellungen und Rechtssysteme in kontinuierlichen und direkten Kontakt, die sich über Jahrhunderte in relativer Unabhängigkeit von einander entwickelt hatten. Dieser Kontakt macht es schwieriger, Konflikte und divergierende Sichtweisen durch eine schlichte Einteilung in „wir“ und „sie“, Freund und Feind zu vereinfachen.
Das Problem stellt sich mit besonderer Intensität für die rechtsstaatlich verfassten Nationen mit demokratischer Regierung (ob eher liberal oder kommunitarisch ist dabei ebenso nebensächlich wie die genaue Kodifikation der Verfassung). Seit der Französischen Revolution zählen die meisten demokratischen Systeme eine besondere Art des Universalismus zu ihren leitenden Prinzipien: den Universalismus der Rechte. Dieser induziert sowohl in der ethisch-juridischen Theorie, als auch in der politischen Praxis eine Spannung angesichts einer expansiven Tendenz jenes Rechts, welches die beiden anderen fundamentalen demokratischen Prinzipien garantiert und potenziert: die Freiheit und die Gleichheit. Wenngleich diese Spannung häufig durch kontingente Entwicklungen der historisch-politischen Wirklichkeit überdeckt wird und wenngleich die Definition und die Umsetzung dieser Prinzipien erheblichen Variationen unterliegt, je nachdem, ob man sich auf Menschen oder Bürger bezieht, so bleibt doch der Universalismus der Rechte zumindest nominell ein grundlegendes Kennzeichen der modernen Demokratien. Dazu gehört sowohl die Anerkennung (innerhalb des Staates) der grundlegenden Rechte – wie etwa das Recht auf Leben, auf Freiheit, auf moralische Autonomie und die Freiheit des religiösen (oder nicht-religiösen) Bekenntnisses der einzelnen Individuen, als auch der universelle Einsatz für eben diese Rechte. Lassen sich angesichts der massiven Migrationsbewegungen unserer Tage unter diesen Voraussetzungen ein nationales Verfassungssystem und ein nationales Ethos beibehalten, ←11 | 12→ohne die legitimen ethisch-juridischen Ansprüche von Bürgern aus anderen, dem Gastland oft radikal fremden Kulturkreisen zu beeinträchtigen? Können zudem auf transnationaler Ebene diese verschiedenen Universen ohne Konflikt miteinander kommunizieren, falls ihre Rechtssysteme auf inkompatiblen Vorannahmen basieren? Lässt es sich schließlich vermeiden, dass die mit der Harmonisierung unterschiedlicher Werte einhergehende, angebliche „Lockerung“ der auf die politische Gemeinschaft bezogenen Moral das Bürgerethos selbst verwässert? Was in den achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts oft wie ein akademischer Streit, etwa zwischen Liberalen und Kommunitariern, erschien, erhält nunmehr unmittelbare politische Brisanz.
Details
- Seiten
- 258
- Erscheinungsjahr
- 2020
- ISBN (Hardcover)
- 9783631787335
- ISBN (PDF)
- 9783631787342
- ISBN (ePUB)
- 9783631787359
- ISBN (MOBI)
- 9783631787366
- DOI
- 10.3726/b15517
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2019 (November)
- Schlagworte
- Rechtsphilosophie Philosophie der Geschichte Literatur Rechtspositivismus Dominium
- Erschienen
- Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 2020. 258 S.
- Produktsicherheit
- Peter Lang Group AG