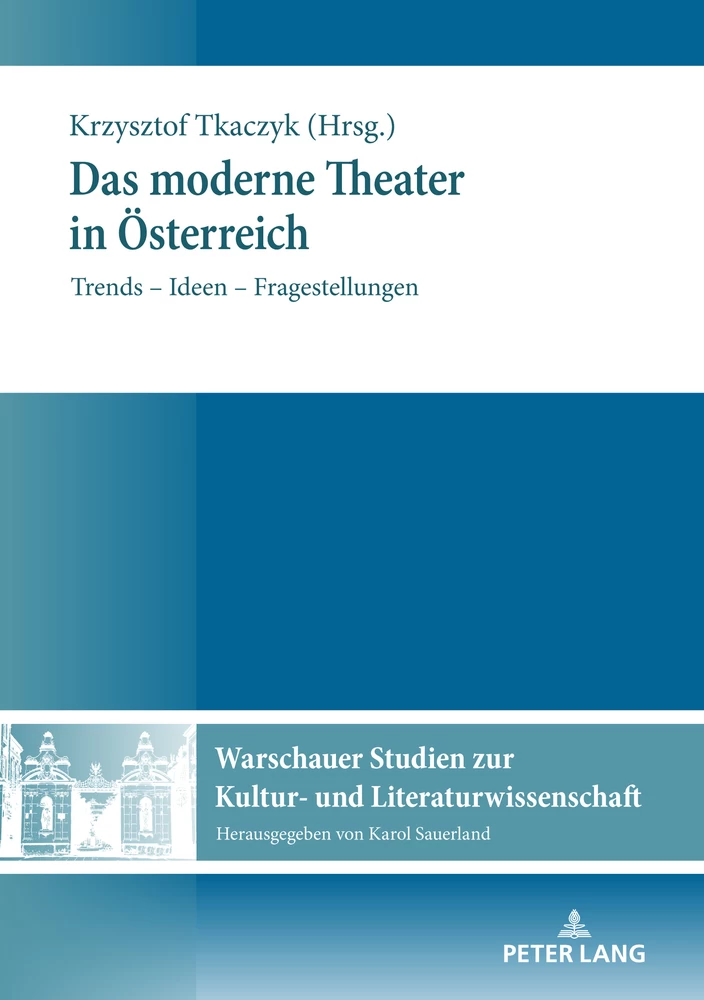Das moderne Theater in Österreich
Trends – Ideen – Fragestellungen
Summary
Excerpt
Table Of Contents
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Table of Contents
- Was ist vom österreichischen Drama der 1960er und 1970er Jahre geblieben?
- Literatur
- Land der Berge. Die Alpen als dramatischer Ort in Stücken von Martin Plattner und Thomas Arzt
- Literatur
- Beschwörungen des Archaischen: Politisches Theater nach Peter Turrini
- Kinski/Herzog-Chiffre
- Tarzans Ruf
- Zurück zum Organischen
- Literatur
- Theater in der Krise oder Krisentheater? Klimawandel und Engagement in Thomas Köcks Klimatrilogie
- „Our house is on fire!“ Die Tragödie der Erde
- Fakten, Performanz und Tragödie. Thomas Köcks Theatertext
- Sympoiesis und das Autor. Köcks theatrale Dramaturgie und Poetik
- Stop talking, start engaging!
- Literatur
- Daniel Kehlmanns ‚Literaturtheater‘
- Einführung
- Die Salzburger Rede – ein Plädoyer für die Werktreue
- Der Mentor – das ‚absurde Ernst‘
- Resümee
- Literatur
- Aspekte des neosozialen Dramas. Am Beispiel von Ewald Palmetshofer: Vor Sonnenaufgang, Thomas Arzt: Alpenvorland und Gerhild Steinbuch: schlafengehen
- Zur Ästhetik des Nach-Scheins sozialer Wirklichkeit im Postrealismus
- „Ich hab zu funktionieren, weißt?“ (Th. Arzt, Alpenvorland)
- „die Menschheit insgesamt liegt in Agonie“ (E. Palmetshofer, Vor Sonnenaufgang)
- „bis man nichts mehr so sehen kann wies wirklich ist“ (G. Steinbuch, schlafengehen)
- Literatur
- Man muss nicht dankbar sein! Die Frauensolidarität und der Kampf gegen den neoliberalen Konsens (Textil-Trilogie von Volker Schmidt)
- Literatur
- Österreichische ‚Frauendramatik‘? Zu Kathrin Rögglas Kinderkriegen und Sophie A. Reyers Mutterbrennen
- Literatur
- Das „Alter [ist] kein Verdienst […], aber auch kein Verbrechen“1 – Thanatopolitik in George Taboris Frühzeitiges Ableben und Constanze Dennigs Exstasy Rave
- Wer gilt als überzählig?
- „Es ist eine ausgezeichnete Idee, Menschen über fünfzig zu eliminieren“11 – künstliche Auslese bei Tabori
- Zwei Happy Ends, kein glücklicher Ausblick
- Literatur
- Willkommen in Auschwitz! Zur Institutionalisierung und Trivialisierung des Shoahgedenkens in Robert Menasses Theaterstück Doktor Hoechst. Ein Faust-Spiel
- Literatur
- Elfriede Jelineks Theaterstücke als Bühne für Kunst und Wissen
- Literatur
- Der Literaturkreis PODIUM und das Theater.Mit Anmerkungen zur polnischen Rezeption des dramatischen Schaffens von PODIUM-Autoren
- Literatur
- Über die Autorinnen und Autoren
- Personenregister
- Titres de la collection
Zur Einführung
Das moderne österreichische Theater ist ein Polylog von Ideen, Einfällen und Haltungen, der sich in der Vielfalt und Heterogenität seiner Erscheinungsformen vorschnellen Klassifizierungsversuchen entzieht und dadurch umso interessanter ist.
Für Ewald Palmetshofer, Volker Schmidt, Thomas Arzt, Martin Plattner, Thomas Köck, Constanze Dennig, Daniel Kehlmann, Kathrin Röggla, Sophie A. Reyer und Gerhild Steinbuch, wie auch für die RepräsentantInnen der älteren Generation wie George Tabori, Peter Turrini, Robert Menasse oder Elfriede Jelinek ist das Theater ein Ort ästhetischer und politischer Arbeit, ein Versuchsraum der sozialen Fantasie, unentbehrlich als Ansporn zum kritischen Denken. Die österreichischen DramatikerInnen verstoßen vielfach gegen die Political Correctness und sind ideologisch unbequem. Sie rütteln an den Gewohnheiten ihrer RezipientInnen, greifen stereotype Denkweisen an, fordern auf, das Bestehende aus einer etwas verschobenen Perspektive zu sehen. Sie beobachten kritisch die Wirklichkeit – nicht nur die von Wien, Linz, Salzburg oder die der österreichischen Provinz, sondern auch die europäische und globale. Sie entdecken, sondieren, legen alle Risse und Sprünge auf dem verzuckerten Bild bloß, das Politiker und Medien von dieser Wirklichkeit zeichnen. Das moderne Prekariat, Flüchtlinge, Mutterschaft, Geschlechter- und Machtverhältnisse als Überbleibsel von patriarchaler Mentalität, ungerechte Güterverteilung, physische und sprachliche Gewalt, bedrohlicher Klimawandel, aber auch die kulturpolitische Funktion des Theaters, seine (neuen) dramatischen Formen, die kritische Überprüfung der Sprache, in der man ein Bollwerk alter Denkschemata erkennt – all das sind ihre Themen, die auch unsere geworden sind, denn der Band präsentiert, diskutiert und interpretiert sie alle.
In dem Eröffnungsbeitrag reflektiert Karol Sauerland über den literarisch-theatralischen Dialog, den die jungen österreichischen Dramatiker mit ihren Vorgängern und zugleich Wegbereitern des modernen Theaters in Österreich führen. Mit dem besonderen Augenmerk für die Theatertexte Ewald Palmetshofers (die unverheiratetete, 2014; Vor Sonnenaufgang, 2017) und Volker Schmidts (Dörfer, 2009; Eigentlich schön, 2014) fragt Sauerland, was sich die moderne österreichische Dramatik, für die – laut Autor – immer noch vorwiegend Österreich und Österreicher mit ihren Ängsten, Phobien und Schuldgefühlen im Zentrum des Interesses stehen, von den Leistungen des engagierten Theaters der 1960er und 70er Jahre (Skandalstücke des jungen Wolfgang Bauer ←7 | 8→und Peter Turrinis, Sprechstücke Peter Handkes), den Theatertexten Thomas Bernhardts sowie Theaterarbeiten und Enunziationen Elfriede Jelineks angeeignet und welche neuen Erzähl- und Aufführungsstrategien sie entwickelt hat.
An die österreichische Theatertradition (Raimund – Schnitzler – Horváth – Jelinek) knüpft auch Wolfgang F. Hackl an, der die Alpenlandschaft als ein im österreichischen Theater tief verankertes Motiv betrachtet und nach dessen Variationen und Metaphorisierungen in ferner (2018) und rand: ständig (2019) von Martin Plattner sowie Totes Gebirge (2016) von Thomas Arzt fragt. Für Plattner seien mit Eis und Schnee bedeckte Berggebiete allegorische Landschaften, Orte der Einsamkeit und Resignation, Projektionsflächen für die eingefrorenen sozialen Beziehungen und die Gefühlskälte einer jegliche Hilfeleistungen verweigernden Gesellschaft. Arzt benutze die Topographie des Toten Gebirges als Bühne, auf der die durch die Erfordernisse einer Dauerleistungsgesellschaft gebrochenen Individuen agieren. Sein Stück, voller intellektueller Bezüge, sei eine Veranschaulichung der wüsten österreichischen Seelenlandschaft. Für beide Autoren sind mithin die Alpen ein Vorwand für eine weitgehende Kritik der modernen entsolidarisierten Gesellschaft.
Der breit angelegte Beitrag von Joanna Firaza ist den „Beschwörungen des Archaischen und Archetypischen“ im politischen Schocktheater Peter Turrinis gewidmet. Turrini – das Enfant terrible des österreichischen Theaters – suche in der Hinwendung zum Rituellen, Organisch-Animalischen, Ur- und Vorsprachlichen nach emotioneller und geistiger Läuterung. Die Bemühungen des Autors um eine theatralische Katharsis, die an Grotowskis Theater denken lassen, werden an zwei seiner Stücke exemplifiziert: Die Liebe in Madagaskar (1998) und Aus Liebe (2013), die sein Werk zwischen dem traditionellen und postmodernen Theater positionieren und in denen sich Turrini als ein sprachkritischer Dramatiker mit gesellschaftspolitischem Gespür zu erkennen gibt.
Den der Beleuchtung unterschiedlicher Verflechtungen des zeitgenössischen österreichischen Theaters mit seiner progressiven Tradition gewidmeten Beiträgen folgen einige, die das Theater als Ästhetikum und Politikum zugleich betrachten und seine Formen (manchmal kritisch) reflektieren.
Die Möglichkeiten des Postdramatischen untersucht mit Fokus auf Thomas Köcks Klimatrilogie (2015–2017) Andreas Englhart, der die Frage stellt, inwieweit das ästhetisch raffinierte postdramatische Theater es vermag, die wissenschaftlich begründeten Fakten und Szenarien der KlimaforscherInnen zu verarbeiten, sie zugleich attraktiv und glaubwürdig zur Schau zu stellen, um somit seine ZuschauerInnen zum zielgerichteten Engagement zu ermutigen. Köcks Theatertext, der sich einer Reihe von performativen Produktionen anschließe, wie Rimini Protokolls Welt-Klimakonferenz (2015) oder das ←8 | 9→posthumane Langzeittheater Die Welt ohne uns des Theaterkollektivs lunatiks produktion (2010–2015), zeige sich als eine eigenartige, zwischen Dramatik, Prosa und Lyrik schwebende, aus der antiken Tragödie genauso gut wie aus dem Rap schöpfende Komposition, die mit einem kritischen Blick die akuten gesellschafspolitischen Problemen der globalisierten neoliberalen Welt verfolge.
Einem anderen theatralischen Konzept widmet Eliza Szymańska ihre Aufmerksamkeit. Sie geht Daniel Kehlmanns Idee des Literaturtheaters auf die Spur, die der Autor in der Rede anlässlich der Salzburger Festspiele 2009 darstellte. In seinem künstlerischen Manifest wandte sich Kehlmann gegen das Regietheater und die beinahe uneingeschränkte Inszenierungsfreiheit des Regisseurs und plädierte für eine werktreue szenische Arbeit. Die Autorin bespricht nicht nur Kehlmanns Programm, sondern auch die kritischen Kommentare zu ihm. Den zweiten Teil des Artikels fokussiert Szymańska auf die Satire Der Mentor (Hörspiel, 2012), in der sich die Konzeption des Literaturtheaters Kehlmanns manifestiere.
Günther A. Höfler beschäftigt sich in seiner eigehenden Analyse mit narrativen Strategien des neosozialen Dramas, das sich durch nichtmimetische Darstellungsweisen und postdramatische Innovationsspiele kennzeichne, was in Realitätsverlust und eingeschränktes Wirkungspotential münden müsse. Die in dem Beitrag untersuchten Theatertexte: Thomas Arzts Alpenvorland (2013), Ewald Palmetshofers Vor Sonnenaufgang (2017) und Gerhild Steinbuchs schlafengehen (2006) verfügen zwar über einen realistischen Plot und einen sozialkritischen Ton, aber durch die Entfernung von sozial Konkretem und das Fehlen einer psychologischen Handlungsbegründung bleibt ihnen das Ästhetische, so dass die Dramen eher poetisch ermüden, statt zu faszinieren.
Soziale Fragen, Ungerechtigkeitsempfindungen und Solidaritätsregungen als theatralische Phänomene interessieren Krzysztof Tkaczyk. Der Autor befasst sich in seinem Artikel mit der Textil-Trilogie (2007–2017) von Volker Schmidt, der dem engagierten Realismus in der österreichischen Dramatik anzuordnen sei. In der im Geiste der politischen Philosophie Jacques Rancières verfassten Trilogie entwirft Schmidt ein finsteres Bild der Zukunft, in der Österreich Billiglohnland und Lieferant der Textilwaren für den reichen Osten geworden ist. Das dystopische Zukunftsuniversum Schmidts, in dem drei Näherinnen einer Wiener Textilfabrik, ausgebeutet und erniedrigt, im gemeinsamen Agieren ihr Schicksal zu ändern suchen, rekurriere auf die schwierige Lage der Mindestlohn-VerdienerInnen des modernen Neoliberalismus, der sich aus der prekären Arbeit der verunsicherten ArbeitnehmerInnen speise. Der politische ←9 | 10→Theatertext Schmidts sei zugleich eine Streitschrift gegen die allgegenwärtige Marktglobalisierung, ein Plädoyer für die Frauenrechte und ein Appell an die emanzipierte Leser- und Zuschauerschaft, die durchaus ökonomisierte Welt neu zu denken.
Frauen und eine genderspezifische Perspektive stehen auch im Fokus des Beitrags von Artur Pełka, der anhand der Theatertexte von Kathrin Röggla (Kinderkriegen, 2012) und Sophie A. Reyer (Mutterbrennen, 2019) über die österreichische Frauendramatik nach 2000 reflektiert. Zwar schreiben beide Autorinnen nicht aus einer radikal-feministischen Perspektive, trotzdem kennzeichne ihre Dramentexte, deren Thematik um die Mutterschaft, gesellschaftlich zugewiesene Frauenrollen sowie Geschlechter- und Machtverhältnisse kreist, ein starker politischer Gestus. Auch wenn sich Röggla ironisch „lausige Feministin“ nennt, höre sie nicht auf, für die politische Emanzipation der Frauen zu plädieren und so in Kinderkriegen entpuppe sie das Kinderkriegen bzw. Nicht-Kriegen als eine der Instrumentalisierungsstrategien der neoliberalen Gesellschaft. In Reyers Theatertext werde wiederum die gesellschaftliche Vererbung von Frauenrollen mit Rekurs auf die Vergangenheit dargestellt, von der es gelte, sich letztendlich zu befreien.
Agnieszka Jezierska widmet ihr Augenmerk zwei dystopischen Dramen, die die Frage der Überalterns behandeln. In George Taboris Stück mit klaren Anspielungen auf die Biopolitik des Dritten Reiches Frühzeitiges Ableben (deutsche Fassung 2001) wird das Recht auf Leben denjenigen abgesprochen, die die Altersgrenze von 50 Jahren überschritten haben, und im satirischen Euthanasiedrama Extasy rave (2003) von Constanze Dennig denjenigen über 80. Die AutorInnen verweisen auf mangelnde Sensibilität, wunde Stellen in der Sozialpolitik und schwindende Solidarität der Generationen. Trotz des komödienhaften Kostüms werde in beiden Theaterstücken eine düstere Diagnose der zeitgenössischen Zustände und eine Warnbotschaft zugleich formuliert.
Magdalena Daroch geht in ihrem Beitrag auf das Motiv des Besuches in einem Konzentrationslager ein und rekurriert auf literarische Texte, in denen eine Reise nach Auschwitz unternommen wird, u.a. auf Robert Menasses Roman Die Hauptstadt. Den Brennpunkt des Beitrags bildet jedoch sein im Jahre 2013 veröffentlichtes (2009 in Darmstadt uraufgeführtes) Theaterstück Doktor Hoechst. Ein Faust-Spiel, in dem der österreichische Schriftsteller auf Gefahren der Institutionalisierung, Musealisierung und Medialisierung des Shoahgedenkens aufmerksam macht und vor der Trivialisierung der Erinnerungskultur warnt. Auf grotesk-ironische Weise schildere Menasse den Besuch des modernen Faust in Auschwitz, das als Ort des Schreckens, dessen Name stellvertretend für den nationalsozialistischen Völkermord steht, und zugleich ←10 | 11→als Museum, bekannte Sehenswürdigkeit und Stätte des Tourismus funktioniert.
Bożena Chołuj fragt nach den Beziehungen zwischen literarischen Texten und wissenschaftlichen Diskursen. Literatur, darunter auch Texte fürs Theater, brauchen nicht mittels anderer (wissenschaftlicher Texte) gelesen und interpretiert zu werden, da sie selbst Quelle des Wissens seien und wissenschaftlich begründete Erkenntnisse vermitteln. Anhand der Theatertexte von Krzysztof Warlikowski, René Pollesch und Elfriede Jelinek verweist die Autorin auf das kritische Potenzial des modernen Theaters, das auf die Leistungen der Psychoanalyse, Soziologie, Wirtschaftslehre, der Postcolonial Studies oder Gender und Queer Theory rekurrierend zu einer art/science mit stark gesellschaftskritischem Akzent wird, ohne seine ästhetischen Qualitäten einzubüßen.
In dem Abschluss-Artikel leuchtet Krzysztof Huszcza unterschiedliche Aspekte der literarischen Tätigkeit des 1971 gegründeten niederösterreichischen Autorenkreises PODIUM aus. Seine historisch angelegte Untersuchung liefert zahlreiche Informationen zu Aktivitäten (Lesungen, Debatten, Symposien, Bühnenauftritte, Performances, Ausstellungen, Gründung eines hauseigenen Periodikums „Podium“ und vieles mehr) der Gruppenmitglieder, zu denen viele anerkannte DramatikerInnen, Regisseure, Dramaturgen und SchauspielerInnen gehör(t)en, wie etwa Kurt Klinger, Matthias Mander, Helmut Peschina, Hilde Berger (die bei Grotowski in der Lehre war), Silke Hassler und andere, die sich in ihrem Schaffen auch dem Theater verschrieben haben.
Die in dem Band enthaltenen Beiträge sind Resultat des von dem Institut für Germanistik der Universität Warschau und dem Österreichischen Kulturforum Warschau vom 14. bis 15. November 2019 veranstalteten internationalen wissenschaftlichen Symposiums „Österreichisches Theater nach 2000: Trends, Ideen, Fragestellungen“, das noch einmal zeigte, wie vital und innovativ das österreichische Theater von heute ist, und dass es inzwischen zum festen Bestandteil des europäischen Kulturidioms wurde.
Details
- Pages
- 200
- Publication Year
- 2021
- ISBN (PDF)
- 9783631862346
- ISBN (ePUB)
- 9783631867242
- ISBN (Hardcover)
- 9783631833179
- DOI
- 10.3726/b19043
- Language
- German
- Publication date
- 2021 (December)
- Keywords
- Österreichisches Theater der Gegenwart Postdramatisches Theater Theater und Politik Gesellschaftskritik Erinnerungskultur Feminismus
- Published
- Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 2021. 200 S., 1 s/w Abb.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG