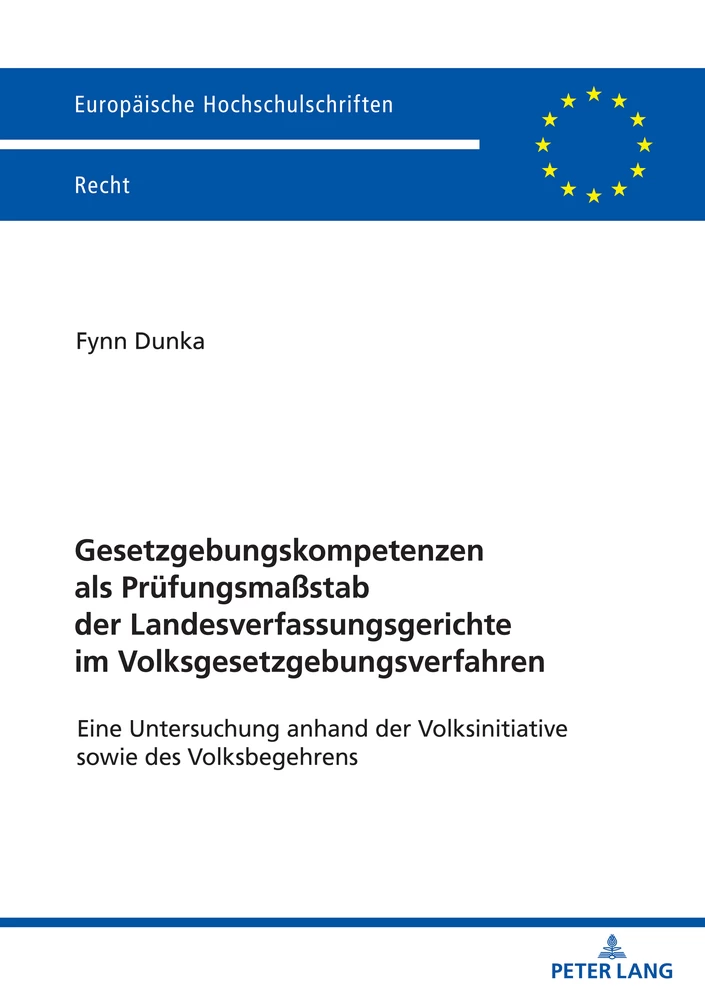Gesetzgebungskompetenzen als Prüfungsmaßstab der Landesverfassungsgerichte im Volksgesetzgebungsverfahren
Eine Untersuchung anhand der Volksinitiative sowie des Volksbegehrens
Summary
Excerpt
Table Of Contents
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Vorwort
- Inhalt
- Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Einleitung
- Gang der Untersuchung und Problemaufriss
- Erster Abschnitt – Die Volksinitiative
- A. Die Volksinitiative
- I. Der demokratische Ursprung der Volksinitiative
- 1. Das Art. 20 Abs. 1 S. 1 GG zugrundeliegende Demokratieprinzip
- 2. Die repräsentative Demokratie
- 3. Die direkte Demokratie
- II. Die Verfassungslage in der Bundesrepublik Deutschland
- III. Die Volksgesetzgebung
- 1. Die Volksinitiative
- 2. Volksbegehren und Volksentscheid
- IV. Zusammenfassung
- B. Elemente der direkten Demokratie
- I. Die isolierte Volksinitiative
- II. Das Referendum
- III. Die Volksbefragung
- IV. Zusammenfassung
- C. Die Zulässigkeit der Volksgesetzgebung
- I. Zulässigkeit auf Landesebene
- 1. Das Bundesstaatsprinzip
- 2. Die Verfassungsautonomie als Konsequenz der Länderstaatlichkeit
- 3. Die Rechtswirkung von Art. 28 Abs. 1 GG
- 4. Die Vereinbarkeit der Volksgesetzgebung mit der Mindesthomogenität
- a) Vereinbarkeit mit der Demokratieanforderung
- b) Kein Übergewicht des parlamentarischen Gesetzgebers
- c) Restriktion aufgrund der Funktionsfähigkeit des Parlaments
- 5. Zusammenfassung
- II. Zulässigkeit auf Bundesebene
- 1. Verfassungsvorbehalt oder Einführung durch Bundesgesetz?
- 2. Vereinbarkeit mit dem Demokratieprinzip
- 3. Vereinbarkeit mit der Beteiligung der Länder an der Gesetzgebung
- a) Bundesstimme als zeitgleiche Abgabe einer Landesstimme
- b) Bundesstimmen und gewichtete Landesstimme im Föderalsystem
- c) Stimmabgabe als Bundestagsbeschluss
- d) Der Ausschluss der Mitwirkung in der Sache oder in dem Verfahren
- e) Zusammenfassung
- D. Der Verfahrensablauf der Volksinitiative sowie des Volksbegehrens
- I. Die Initiative als Teil der Volksgesetzgebung
- 1. Verfahrensablauf
- a) Das Einleitungsverfahren
- b) Das Hauptverfahren
- c) Das Abschlussverfahren
- 2. Zulässigkeitsvoraussetzungen
- a) Voraussetzungen Art. 48 Abs. 1, 2 LVerf SH
- aa) Entscheidungszuständigkeit des Landtages
- bb) Tauglicher Initiativgegenstand
- (1) Gegenstand der politischen Willensbildung
- (2) Gesetzentwürfe
- (3) Ausgeschlossene Initiativgegenstände
- cc) Zulässige Unterschriften
- b) Voraussetzungen § 6 VAbstG SH
- c) Volksbegehren innerhalb der letzten zwei Jahre
- 3. Rechtsschutz
- a) Rechtsmittel zum Verwaltungsgericht
- b) Rechtsmittel zum Landesverfassungsgericht
- II. Die Entscheidungszuständigkeit des Landtages
- III. Das Volksbegehren im zweistufigen Volksgesetzgebungsverfahren
- E. Zusammenfassung
- Zweiter Abschnitt – Das Verhältnis der Verfassungsgerichtsbarkeiten
- A. Einleitung
- B. Die Landesverfassungsgerichtsbarkeit
- I. Die Legitimation eigener Landesverfassungsgerichte
- II. Das Trennungsprinzip
- C. Der Prüfungsmaßstab der Landesverfassungsgerichte
- I. Die umfassende prinzipielle Überprüfung anhand des Grundgesetzes
- 1. Einfügung in den Bundesstaat
- 2. Überprüfung nach Art. 100 Abs. 3 GG
- II. Die Parallelität zur Landesverfassung
- 1. Die Kompetenzabgrenzung anhand des Überprüfungsgegenstandes
- 2. Das Trennungsprinzip als Instrument zur Abgrenzung der Prüfungsmaßstäbe der Verfassungsgerichte
- D. Die Durchbrechung des Trennungsprinzips
- I. Die Vorprüfung des Prüfungsgegenstandes
- 1. Bestehen der Vorlagepflicht nach Art. 100 Abs. 1 GG
- 2. Bestehende Kritik an der Vorlageverpflichtung für Landesverfassungsgerichte
- 3. Prinzipielle Anwendung auf den Prüfungsgegenstand
- II. Das Hineinwirken des Grundgesetzes in die Landesverfassung
- 1. Art. 70 ff. GG
- a) Der Beschluss des Hessischen Staatsgerichtshofs vom 15. Januar 1982
- b) Der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24. März 1982
- c) Die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs von Nordrhein-Westfalen vom 9. Mai 1992
- d) Der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 7. Mai 2001
- e) Moderne Rechtsprechungsentwicklung
- f) Die Kompetenzverteilung als notwendige Grundgesetzesregelung und der damit verbundene Ausschluss als Bestandteilsnorm
- 2. Die Legitimation von Bestandteilsnormen
- a) Bundesverfassungsrechtlicher Ursprung
- b) Die Argumentation im Einzelnen
- c) Bestandteilsnormen als unzulässige Verkürzung der gliedstaatlichen Verfassungsautonomie und Verstoß gegen die Gewaltenteilung
- d) Art. 28 Abs. 3 GG als Ausdruck des unzulässigen Hineinlesens
- 3. Zusammenfassung
- III. Die Prüfung anhand von Durchgriffsnormen
- 1. Die Qualifikation von Durchgriffsnormen
- 2. Gesetzgebungskompetenzen als durchgreifende Grundgesetzbestimmungen
- 3. Die Überprüfung am Maßstab von Durchgriffsnormen
- E. Die landesverfassungsrechtliche Aufnahme des Grundgesetzes
- I. Die Hebeltechnik
- II. Die Verweistechnik
- F. Zusammenfassung
- Dritter Abschnitt – Das Grundgesetz als Teil des Prüfungsmaßstabes im Volksgesetzgebungsverfahren
- A. Der Prüfungsumfang der Präventivkontrolle im Hinblick auf die Gesetzgebungskompetenzen des Landtags
- I. Die Rechtsprechung der Landesverfassungsgerichte
- 1. Das Landesverfassungsgericht Schleswig-Holstein
- 2. Der Staatsgerichtshof Baden-Württemberg
- 3. Das Landesverfassungsgericht Hamburg
- 4. Der Verfassungsgerichtshof des Landes Berlin
- a) Das Urteil vom 06. Oktober 2009
- b) Das Urteil vom 13. Mai 2013
- 5. Das Landesverfassungsgericht Thüringen
- 6. Der Staatsgerichtshof Bremen
- 7. Der Verfassungsgerichtshof Nordrhein-Westfalen
- 8. Der Verfassungsgerichtshof Bayern
- a) Die Entscheidung vom 26. Juli 1965
- b) Die Entscheidung vom 14. Juni 1985
- aa) Das Wortlautargument
- bb) Der Sinn und Zweck der Regelung
- c) Die Entscheidung vom 14. August 1987
- d) Die Entscheidung vom 19. März 1990
- e) Bestätigung der Rechtsprechung
- f) Die Position des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs
- 9. Zusammenfassung der Rechtsprechung
- II. Ansätze im Schrifttum
- 1. Die Überprüfung ohne ausdrückliche Kompetenzzuweisung
- 2. Die Überprüfung kraft ausdrücklicher Kompetenzzuweisung
- B. Die Beschaffenheit der Zuweisung einer Präventivkontrolle
- I. Die Notwendigkeit einer ausdrücklichen landesverfassungsrechtlichen Kompetenzzuweisung
- 1. Keine grundgesetzliche Pflicht zur Überprüfung
- 2. Die Unzulänglichkeit einer ungeschriebenen Kompetenz
- a) Die Kompetenz Kraft Natur der Sache
- b) Das Prinzip der Bundestreue
- c) Das landesverfassungsrechtliche Rechtsstaatsprinzip
- 3. Der Kerngehalt der Kompetenzzuweisung als Zuweisung nicht integrierten Bundesrechts in den Prüfungsmaßstab der landesverfassungsrechtlichen Entscheidungsfindung
- II. Die Legitimation der landesverfassungsrechtlichen Kompetenzzuweisung im Kontext der Landesverfassungen und des Grundgesetzes
- 1. Vereinbarkeit mit der Landesverfassung
- a) Prüfungszuweisung durch die Landesverfassung
- aa) Das Konzept der Vorabüberprüfung
- (1) Grundkonstellation
- (2) Die Legitimation der Präventivkontrolle
- (3) Grenzen der Vorabprüfung im Rahmen der Volksgesetzgebung
- (4) Keine Schlechterstellung des Volksgesetzgebers
- bb) Zusammenfassung
- b) Prüfungszuweisung durch einfaches Landesrecht
- aa) Vereinbarkeit mit den Aufgaben des Landesverfassungsgerichts
- bb) Keine Schlechterstellung des Volksgesetzgebers
- c) Zusammenfassung
- 2. Vereinbarkeit mit dem Grundgesetz
- a) Die repressive Überprüfung des Bundesverfassungsgerichts
- b) Keine Vorlagemöglichkeit nach Art. 100 Abs. 1 GG
- c) Keine grundlegende Vorlageverpflichtung nach Art. 100 Abs. 3 GG
- d) Die Untauglichkeit sonstiger Verfahren zur Rüge der Verletzung der Gesetzgebungskompetenzen durch einen Gesetzentwurf
- e) Zusammenfassung
- 3. Die Voraussetzungen einer landesverfassungsrechtlichen Überprüfung der Gesetzgebungskompetenzen im Volksgesetzgebungsverfahren
- 4. Die Reduzierung der Prüfungsintensität
- C. Die Zulässigkeit der landesverfassungsgerichtlichen Überprüfung im Falle der hypothetischen Einfügung direktdemokratischer Elemente auf Bundesebene
- D. Zusammenfassung
- Vierter Abschnitt – Zusammenfassung der Ergebnisse
- Literaturverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
a.A. |
Andere Ansicht |
a.a.O. |
Am angeführten Ort |
aF |
Alte Fassung |
AöR |
Archiv des öffentlichen Rechts |
Art. |
Artikel |
AS |
Amtliche Sammlung von Entscheidungen er Oberverwaltungsgerichte Rheinland-Pfalz und Saarland mit Entscheidungen der Verfassungsgerichtshöfe beider Länder |
Az. |
Akzenteichen |
BaWü |
Baden-Württemberg |
BayVBL |
Bayrische Verwaltungsblätter |
BayVerfGH |
Bayerischer Verfassungsgerichtshof |
BayVerfGHE |
Entscheidungen des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs |
BerlVerfGH |
Berliner Verfassungsgerichtshof |
Bnd. |
Band |
BRD |
Bundesrepublik Deutschland |
BremStGH |
Bremischer Staatsgerichtshof |
BremStGHE |
Entscheidungen des Bremischen Staatsgerichtshofes |
BT |
Bundestag |
BVerfG |
Bundesverfassungsgericht |
BVerfGE |
Amtliche Entscheidungssammlung des Bundesverfassungsgerichts |
BVerfGG |
Bundesverfassungsgerichtsgesetz |
Dass. |
Dasselbe |
Ders. |
Derselbe |
DÖV |
Die öffentliche Verwaltung |
DVBl. |
Deutsche Verwaltungsblätter |
ff. |
Folgende |
Fn. |
Fußnote |
FS |
Festschrift |
GeschO |
Geschäftsordnung |
GG |
Grundgesetz |
GvoBl |
Gesetz- und Verordnungsblatt |
h.M. |
Herrschende Meinung |
HambVerF |
|
HessStGH |
Hessischer Staatsgerichtshof |
JA |
Juristische Arbeitsblätter |
JöR |
Jahrbuch des öffentlichen Rechts |
JuS |
Juristische Schulung |
JZ |
Juristen Zeitung |
Krit. |
kritisch |
KritV |
Kritische Vierteljahrsschrift für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft |
LKV |
Landes- und Kommunalverwaltung |
LVerf |
Landesverfassung |
LVerfG |
Landesverfassungsgericht |
LVerfGE |
Entscheidungen der Verfassungsgerichte der Länder |
m.w.N. |
mit weiteren Nachweisen |
N.F. |
Neue Fassung |
NiedStGH |
Niedersächsischer Staatsgerichtshof |
NJW |
Neue Juristische Wochenschrift |
NordÖR |
Zeitschrift für Öffentliches Recht in Norddeutschland |
NRW |
Nordrhein-Westfalen |
NVwZ |
Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht |
NVwZ-RR |
Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht Rechtsprechungs-Report |
NWVBl. |
Nordrhein-Westfälische Verwaltungsblätter |
RGZ |
Reichsgerichtshof für Zivilsachen |
RLP |
Rheinland-Pfalz |
Rn. |
Randnummer |
RuP |
Recht und Politik |
SaarlVerfGH |
Saarländischer Verfassungsgerichtshof |
SächsVerfGH |
Sächsischer Verfassungsgerichtshof |
SH |
Schleswig-Holstein |
StaatsGH |
Staatsgerichtshof |
ThürVBl. |
Thüringer Verwaltungsblätter |
ThürVerfGH |
Thüringer Verfassungsgerichtshof |
Urt. |
Urteil |
VAbstG |
Volksabstimmungsgesetz |
VerfGH |
Verfassungsgerichtshof |
VG |
Verwaltungsgericht |
Vgl. |
Vergleiche |
VVDStRL |
Veröffentlichung der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtler |
VwGO |
Verwaltungsgerichtsordnung |
ZAP |
|
ZfIR |
Zeitschrift für Immobilienrecht |
ZG |
Zeitschrift für Gesetzgebung |
ZParl |
Zeitschrift für Parlamentsfragen |
ZRP |
Zeitschrift für Rechtspolitik |
NRWVerfGHE |
Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofs Nordrhein-Westfalens |
MedR |
Medizinrecht |
Einleitung
„Bürgerinnen und Bürger haben das Recht, den Landtag im Rahmen seiner Entscheidungszuständigkeit mit bestimmten Gegenständen der politischen Willensbildung zu befassen.“ – Art. 48 Abs. 1 S. 1 LVerf SH
Die Landesverfassung Schleswig-Holsteins stellt mit diesem Artikel die Weichen für direkte Demokratie. Mit der Regelung zu der Volksinitiative öffnet die Landesverfassung das Eingangstor für das sogenannte Volksgesetzgebungsverfahren, welches durch einen aus dem Volk eingebrachten Gesetzentwurf initiiert wird und gegebenenfalls mit einer direkten Abstimmung des Volkes über den Gesetzentwurf endet – dem sogenannten Volksentscheid. Im Gegensatz zum vorherrschenden parlamentarischen Gesetzgebungsprozess ist das Volk hier maßgeblicher Initiator und Entscheider zugleich.
Die direkte Demokratie erfreut sich steigender Beliebtheit (einer vergangenen Studie aus dem Jahre 2010 von TNS-Emnid im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung nach wünschen sich gar 84 Prozent der Befragten eine weitergehende Teilnahmemöglichkeit als Wahlen1) und Beteiligungszahlen und drängt weiter in das öffentliche Meinungsbild als Korrektur und Ergänzung möglicherweise bestehender Mängel in vorhandenen oder fehlenden gesetzlichen Regelungen. Von Seiten des Volkes wird dabei ein breit gefächertes Themenfeld angesteuert, wobei insbesondere Initiativen zu Mietsachen und Umweltfragen hervorzuheben sind.2
Doch obwohl sich die Volksgesetzgebung – in unterschiedlicher Ausgestaltung3 – mittlerweile auf Landesebene etabliert hat, sind nicht alle Fragen rund um direktdemokratische Elemente in der Bundesrepublik abschließend geklärt und beschäftigen auch heute noch Literatur und die Gerichte. Die Diskussion um direkte Demokratie gliedert sich dabei in zwei Strömungen: Einerseits werden die generelle Zulässigkeit sowie der politische Nutzen und damit einhergehende Gefahren sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene hinterfragt;4 ←23 | 24→diese Diskussion ist vor allem verfassungspolitisch geprägt, wartet aber auch mit komplexen juristischen Problemen auf. Andererseits beschäftigt auch die praktische Umsetzung dieser Verfahrensarten weiterhin die Rechtswissenschaft. Insbesondere der letzten Problematik soll sich diese Untersuchung widmen.
Details
- Pages
- 214
- Publication Year
- 2022
- ISBN (PDF)
- 9783631878156
- ISBN (ePUB)
- 9783631878163
- ISBN (MOBI)
- 9783631878170
- ISBN (Softcover)
- 9783631875605
- DOI
- 10.3726/b19680
- Language
- German
- Publication date
- 2022 (April)
- Published
- Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 2022. 214 S.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG