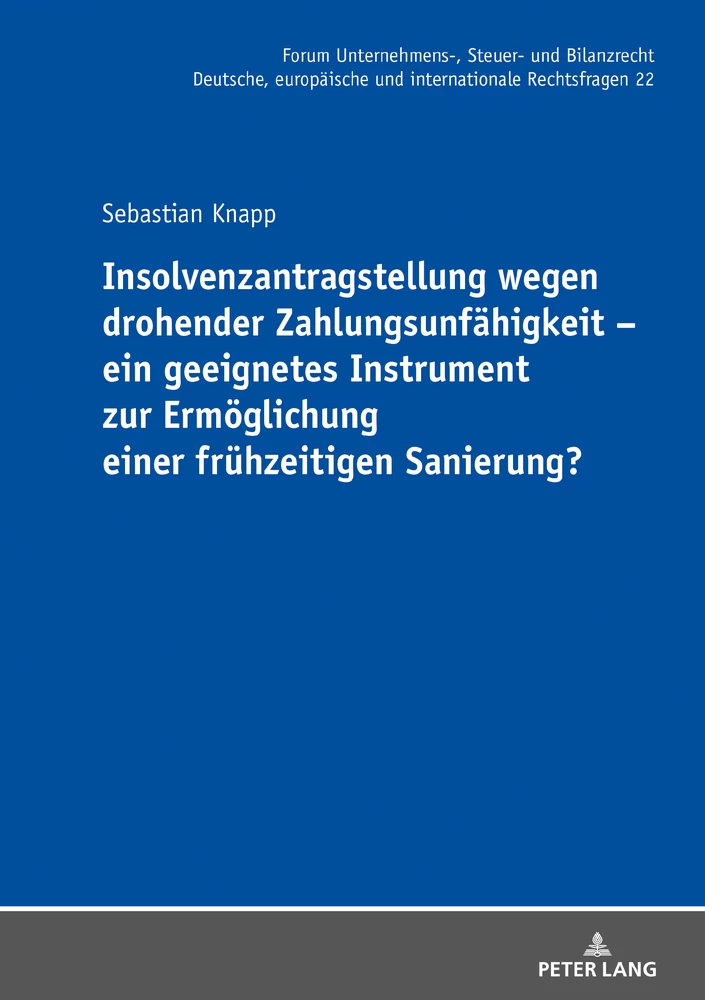Insolvenzantragstellung wegen drohender Zahlungsunfähigkeit – ein geeignetes Instrument zur Ermöglichung einer frühzeitigen Sanierung?
Summary
Dabei nimmt er zu bisher wenig beachteten Rechtsfragen im Zusammenhang mit den Eröffnungsgründen nach §§ 17 ff. InsO Stellung, entwickelt eine eigene Prüfungssystematik für den Tatbestand des § 18 InsO und unterbreitet einen Reformvorschlag zur Ablösung des § 19 InsO. Er beleuchtet die bestehenden Anreize für eine frühzeitige Verfahrenseinleitung mit Fokus auf die gesetzlichen Sanierungsinstrumente sowie die Konkurrenzsituation zum StaRUG und unterbreitet für klärungsbedürftige Einzelfragen Lösungsvorschläge.
Der Autor stellt fest, dass de lege lata kaum geeignete Anreize zur Förderung einer Verfahrenseinleitung bereits bei drohender Zahlungsunfähigkeit vorhanden sind und der Gesetzgeber daher das mit § 18 InsO verfolgte Ziel nach wie vor verfehlt. Anschließend präsentiert er konkrete Vorschläge zur Weiterentwicklung des geltenden Rechts de lege ferenda.
Excerpt
Table Of Contents
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Vorwort
- Inhaltsverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- A. Einleitung
- I. Problemstellung und Ziel der Untersuchung
- 1. Erreichung der im Zusammenhang mit § 18 InsO bestehenden rechtspolitischen Ziele des Gesetzgebers
- 2. Unklarheiten der tatbestandlichen Anforderungen
- 3. Ausgewählte Maßnahmen zur Vermeidung oder Beseitigung einer drohenden Zahlungsunfähigkeit
- 4. Überschneidungsbereich mit dem Eröffnungstatbestand der Überschuldung gemäß § 19 InsO und verbleibender Anwendungsbereich des § 18 InsO
- 5. Anforderungen an einen fakultativen Insolvenzantrag
- II. Gang der Untersuchung
- B. Entstehungshistorie des § 18 InsO
- C. Normzweck – rechtspolitische Ziele des Gesetzgebers
- D. Der Tatbestand der drohenden Zahlungsunfähigkeit gemäß § 18 InsO
- I. Methodik der Feststellung der drohenden Zahlungsunfähigkeit
- II. Alternative Methodik der Rechtsprechung
- III. Der Finanzstatus
- 1. Verfügbare liquide Mittel
- 2. Fällige Verbindlichkeiten
- IV. Der Finanzplan
- 1. Grundsätzliche Anforderungen an den (Ertrags- und) Finanzplan
- 2. Mittelzuflüsse (Aktiva II)
- 3. Mittelabflüsse (Passiva II)
- a) Ausschließliche Berücksichtigung der im Betrachtungszeitpunkt bereits bestehenden Verbindlichkeiten oder auch Einbeziehung der im Planungszeitraum voraussichtlich entstehenden Verpflichtungen?
- b) Stellungnahme
- 4. Die Länge des Prognosezeitraums
- V. Das Merkmal der Voraussichtlichkeit nach § 18 Abs. 2 InsO und die Anforderungen an die prognostischen Elemente des Finanzplans
- 1. Grundlagen zur Ermittlung der überwiegenden Wahrscheinlichkeit
- a) Keine objektive Wahrscheinlichkeit
- b) Berücksichtigung subjektiver Elemente
- c) Keine naturwissenschaftlich-mathematische Berechnungsmethodik
- d) Ermittlung überwiegender Wahrscheinlichkeit im Wege eines umfassenden Abwägungsprozesses
- 2. Stellungnahme
- 3. Ausnahme von dem Maßstab der überwiegenden Wahrscheinlichkeit bei Sanierungsmaßnahmen?
- VI. Eintritt der drohenden Zahlungsunfähigkeit
- 1. Die Definition der Zahlungsunfähigkeit nach § 17 Abs. 2 InsO
- a) Zahlungseinstellung i. S. d. § 17 Abs. 2 Satz 2 InsO
- b) Zeitliche und quantitative Anforderungen an die Zahlungsunfähigkeit i. S. d. § 17 InsO
- c) Dauerhafte Liquiditätsunterdeckungen von weniger als 10 %
- d) Kurzfristige Liquiditätsüberdeckungen im Dreiwochenzeitraum
- 2. Methodik der Prüfung der Zahlungsunfähigkeit nach § 17 InsO
- a) Erstellung eines Finanzstatus und eines Finanzplans
- b) Berechnung der Liquiditätslücke nach Erstellung des Finanzplans
- c) Retrograde Prüfung der Zahlungsunfähigkeit
- 3. Erforderlichkeit einer Doppelprognose für die Prüfung drohender Zahlungsunfähigkeit
- a) Ansichten in der Literatur
- b) Stellungnahme und eigene Methodik
- VII. Pflicht zur Feststellung der drohenden Zahlungsunfähigkeit und Dokumentation der Prüfungshandlungen
- 1. Mittelbare Prüfungspflicht aus der (allgemeinen) Überwachungs- und Sanierungspflicht?
- 2. Gesellschaftsrechtliche Überwachungs- und Sanierungspflicht am Beispiel des GmbH-Geschäftsführers
- 3. Zwischenergebnis
- 4. Dokumentation der Prüfungshandlungen
- E. Ausgewählte Maßnahmen zur Vermeidung oder Beseitigung einer drohenden Zahlungsunfähigkeit
- I. Forderungsstundung
- 1. Stundungsvereinbarung
- 2. Pactum de non petendo
- II. Forderungsverzicht (Erlassvertrag), ggf. mit Besserungsabrede
- 1. Handelsbilanzielle Auswirkungen
- 2. Steuerbilanzielle Auswirkungen
- III. Patronatserklärung
- 1. Arten von Patronatserklärungen
- a) „Harte“ und „weiche“ Patronatserklärungen
- b) Interne und externe Patronatserklärungen
- 2. Berücksichtigung einer Patronatserklärung im Finanzplan zur Vermeidung oder Beseitigung der drohenden Zahlungsunfähigkeit
- a) „Weiche“ Patronatserklärungen
- b) „Harte“ externe Patronatserklärungen
- c) „Harte“ konzerninterne Patronatserklärung
- 3. Besondere vertragliche Vereinbarungen, betragsmäßige Begrenzung und Befristung einer „harten“ Patronatserklärung und ihre Auswirkungen auf den Finanzplan
- 4. Kündigungsmöglichkeit einer „harten“ Patronatserklärung und ihre Auswirkungen auf den Finanzplan
- 5. Der mögliche Regressanspruch des Patrons gegen den Protegé und seine Auswirkungen auf den Finanzplan
- IV. Rangrücktrittsvereinbarung
- 1. Rechtsnatur, Anforderungen und Wirkung einer qualifizierten Rangrücktrittsvereinbarung i. S. d. § 19 Abs. 2 InsO
- 2. Kündigung/Aufhebung der Rangrücktrittsvereinbarung
- 3. Handels- und steuerbilanzielle Auswirkungen der qualifizierten Rangrücktrittsvereinbarung
- 4. Auswirkungen der qualifizierten Rangrücktrittsvereinbarung auf die Prüfung der drohenden Zahlungsunfähigkeit
- V. Zwischenergebnis
- F. Abgrenzung zu dem Insolvenzeröffnungsgrund der Überschuldung gemäß § 19 InsO und Auswirkungen auf den Anwendungsbereich des § 18 InsO
- I. Zweck des Insolvenzgrundes der Überschuldung
- II. Temporäre Suspendierung der Insolvenzantragspflicht gem. § 15a InsO nach Maßgabe des COVInsAG
- 1. Aussetzung der Insolvenzantragspflicht durch das COVInsAG
- 2. Zeitraum für den Antrag nach Aussetzung der Antragspflicht
- III. Der Tatbestand der Überschuldung gemäß § 19 InsO
- 1. Methodik der Feststellung der Überschuldung
- 2. Die insolvenzrechtliche Fortbestehensprognose (§ 19 Abs. 2 Satz 1 HS 2 InsO)
- a) Erforderlichkeit der (Wieder-)Herstellung der Ertragsfähigkeit?
- b) Subjektiver Fortführungswille als Element des Unternehmenskonzepts
- c) Unternehmenskonzept als Grundlage der (Ertrags- und) Finanzplanung
- d) (Ertrags- und) Finanzplanung
- aa) Anforderungen an den (Ertrags- und) Finanzplan
- bb) Prognosezeitraum
- cc) Eintritt der Zahlungsunfähigkeit im Prognosezeitraum – Erforderlichkeit einer Doppelprognose
- 3. Die Überschuldungsbilanz (§ 19 Abs. 2 Satz 1 HS 1 InsO)
- 4. Das Spannungsfeld der Mehrfachprognosen im Rahmen des Überschuldungstatbestands und dessen Folgen für die Rechtsanwendung
- a) Aktivierbarkeit von Beteiligungen im Rahmen eines Überschuldungsstatus
- aa) Aktivierung von Beteiligungen dem Grunde nach
- bb) Aktivierung von Beteiligungen der Höhe nach
- (1) Übertragung der Grundsätze der Aktivierbarkeit eines Geschäfts- bzw. Firmenwertes im Rahmen eines Überschuldungsstatus auf die Höhe des im Überschuldungsstatus aktivierbaren Wertes einer Beteiligung
- (2) Voraussetzungen der Aktivierbarkeit eines Geschäfts- bzw. Firmenwertes im Rahmen eines Überschuldungsstatus
- (3) Stellungnahme
- (4) Berücksichtigung der Besonderheiten von Beteiligungen
- b) Sachdienlichkeit der Prüfung des Schuldendeckungspotenzials zur Erreichung des mit § 19 InsO verfolgten Zwecks
- IV. Feststellung des Überschneidungsbereichs zwischen § 18 InsO und § 19 InsO und seine Auswirkungen auf die Antragsmotivation wegen drohender Zahlungsunfähigkeit
- V. Vorschlag einer Verzahnung der bestehenden Eröffnungsgründe nach §§ 18, 19 InsO de lege ferenda
- G. Die drohendende Zahlungsunfähigkeit als Eröffnungsgrund i. S. d. § 16 InsO
- H. Fakultative Insolvenzantragstellung bei drohender Zahlungsunfähigkeit
- I. Die Berechtigung zur Stellung eines Insolvenzantrags im Stadium der drohenden Zahlungsunfähigkeit
- I. Natürliche Personen
- II. Sonderregelungen für Kredit- und Finanzdienstleistungsunternehmen, Versicherungsunternehmen und Krankenkassen nach Maßgabe des KWG, VAG und SGB V
- III. Juristische Personen und Gesellschaften ohne Rechtspersönlichkeit
- 1. Anforderungen an die Insolvenzantragstellung im Stadium der drohenden Zahlungsunfähigkeit im Außenverhältnis
- a) Antragsrecht bei Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung nach § 15 InsO
- b) Antragsrecht bei drohender Zahlungsunfähigkeit nach §§ 15, 18 Abs. 3 InsO
- 2. Anforderungen an die Insolvenzantragstellung im Stadium der drohenden Zahlungsunfähigkeit im gesellschaftsrechtlichen Innenverhältnis
- a) Keine gesellschaftsrechtlichen Restriktionen bei Eintritt eines zu einem Insolvenzantrag verpflichtenden Eröffnungsgrundes
- b) Pflicht zur Beteiligung der Gesellschafter aus § 1 StaRUG vor Insolvenzantragstellung wegen § 18 InsO?
- c) Mechanismen des Insolvenzverfahrens bei Antragstellung wegen drohender Zahlungsunfähigkeit und ihre Bedeutung für Gesellschafter
- d) Erforderlichkeit eines Gesellschafterbeschlusses bei der GmbH
- aa) Keine Erforderlichkeit der Gesellschafterbeteiligung vor Insolvenzantragstellung wegen Qualifizierung als Geschäftsleitungsmaßnahme oder eines Vorrangs der Gläubigerrechte?
- (1) Gewöhnliche Sanierungsmaßnahme und ausreichender Schutz der Gesellschafter?
- (2) Erforderlichkeit eines Gesellschafterbeschlusses auch bei Geschäftsleitungsmaßnahmen
- (3) Ausschluss der Gesellschafterbeteiligung wegen eines Primats der Gläubigerrechte vor Eintritt materieller Insolvenzreife und eines Gebots zügigen Handelns?
- (a) Keine Entbehrlichkeit eines Gesellschafterbeschlusses aufgrund des Interesses an einer frühzeitigen Verfahrenseinleitung oder einer Eilbedürftigkeit
- (b) Kein Primat der Gläubigerinteressen vor Eintritt der materiellen Insolvenzreife
- (c) Keine grundsätzliche gesetzliche Anordnung des Primats der Gläubigerrechte ab Eintritt drohender Zahlungsunfähigkeit durch das StaRUG
- (d) Gläubigerschutz vor Eintritt materieller Insolvenzreife durch allgemeine Straf- und Haftungstatbestände und Folgen eines ablehnenden Gesellschafterbeschlusses
- bb) Mehrheitserfordernisse eines Gesellschafterbeschlusses
- e) Erforderlichkeit eines Hauptversammlungsbeschlusses bei der AG
- f) Erforderlichkeit eines Gesellschafterbeschlusses bei der OHG mit natürlicher Person als persönlich haftender Gesellschafter
- g) Erforderlichkeit eines Gesellschafterbeschlusses bei der KG mit natürlicher Person als persönlich haftender Gesellschafter
- h) Erforderlichkeit eines (doppelstufigen) Gesellschafterbeschlusses bei der GmbH & Co. KG
- i) Haftungsrisiken der nach §§ 15, 18 Abs. 3 InsO Antragsbefugten bei Missachtung der gesellschaftsrechtlichen Anforderungen im Innenverhältnis
- J. Erreichung der mit § 18 InsO verfolgten rechtspolitischen Ziele des Gesetzgebers
- I. Gründe in der Person der organschaftlichen Vertreter
- II. Bestehende Alternativen zu einer Insolvenzantragstellung
- 1. Wesentliche Elemente des Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmens für Unternehmen nach dem StaRUG
- a) Instrumente des StaRUG, Anzeige des Restrukturierungsvorhabens
- b) Pflichtenkreis des Schuldners und seiner Organe
- aa) Kein uneingeschränkter shift of fiduciary duties ab Anzeige des Restrukturierungsvorhabens
- bb) Gläubigerschutz durch allgemeine Haftungsregeln
- c) Kernelement des StaRUG: Der Restrukturierungsplan
- d) Die gerichtliche Planabstimmung
- e) Die gerichtliche Vorprüfung
- f) Stabilisierungsanordnung
- g) Gerichtliche Planbestätigung
- h) Der Restrukturierungsbeauftragte
- i) Der Gläubigerbeirat
- j) Missbrauch des StaRUG durch Vermögensverschiebungen im Vorfeld der Restrukturierungsanzeige?
- 2. Mögliche Auswirkungen des StaRUG auf die Nutzung des Insolvenzverfahrens als Sanierungsinstrument im Stadium drohender Zahlungsunfähigkeit
- III. Überschneidung mit dem Eröffnungsgrund der insolvenzrechtlichen Überschuldung gemäß § 19 InsO
- IV. Mangelnde Anreize für eine frühzeitige Insolvenzantragstellung
- 1. Eingrenzung der zivil- und strafrechtlichen Haftungsrisiken der organschaftlichen Vertreter
- 2. Reduzierung von Insolvenzanfechtungsrisiken
- 3. Gesetzliche Restschuldbefreiung
- 4. Die gesetzlichen Sanierungsinstrumente
- a) Vorläufige Sicherungsmaßnahmen im Eröffnungsverfahren
- b) Insolvenzgeld und Insolvenzgeldvorfinanzierung
- aa) Kritik
- bb) Stellungnahme
- c) Herausgabesperre im eröffneten Insolvenzverfahren
- d) Quotale Befriedigung der Insolvenzgläubiger
- e) Auswirkungen der Verfahrenseröffnung auf Vertragsverhältnisse
- aa) Erfüllungswahlrecht nach § 103 InsO
- bb) Sonderkündigungsrechte bei von der Verfahrenseröffnung unberührten Vertragsverhältnissen
- (1) Kündigung eines Immobilienmiet- oder Immobilienpachtverhältnisses
- (2) Kündigung von Dienstverhältnissen
- f) Sonderregelungen für betriebliche Änderungen i. S. d. § 111 BetrVG
- g) Insolvenzsicherung betrieblicher Versorgungszusagen
- h) Besonderheiten bei der übertragenden Sanierung aus der Insolvenz
- aa) Haftung nach § 75 AO
- bb) Haftung nach § 25 HGB
- cc) Besonderheiten des Betriebsübergangs nach § 613a BGB
- (1) Teleologische Reduktion des § 613a BGB
- (2) Herstellung der Veräußerungsfähigkeit des Betriebs und Kündigung nach Erwerberkonzept
- i) Zusammenfassende Bewertung der vorstehend erörterten gesetzlichen Sanierungsinstrumente als Anreiz zur frühzeitigen Umsetzung der Sanierung in einem Insolvenzverfahren
- j) Das Eigenverwaltungsverfahren
- aa) Wesentliche Aspekte des Eigenverwaltungsverfahrens nach §§ 270 ff. InsO
- (1) Zugang zur Eigenverwaltung und vorläufiges Eigenverwaltungsverfahren
- (2) Das vorläufige Eigenverwaltungsverfahren nach § 270c InsO
- (3) Die Schutzschirmanordnung nach § 270d InsO
- (4) Aufhebung der vorläufigen Eigenverwaltung
- (5) Anordnung der Eigenverwaltung
- bb) Die Pflichtenkollision zwischen Massesicherungspflicht und den nach Maßgabe der § 266a StGB und § 69 AO haftungsbewehrten Zahlungspflichten in der vorläufigen Eigenverwaltung
- (1) Problemstellung nach der Rechtslage vor Inkrafttreten des SanInsFoG
- (2) Strafbarkeit nach § 266a StGB im vorläufigen Eigenverwaltungsverfahren?
- (3) Haftung aus § 69 AO im vorläufigen Eigenverwaltungsverfahren?
- (4) Lösungsansätze in der rechtlichen Sanierungsberatung
- (a) Einholung von Verzichts- oder Stundungserklärungen
- (b) Übernahme der Kassenführung durch den vorläufigen Sachwalter gemäß §§ 270a Abs. 1 Satz 2, 275 Abs. 2 InsO a. F.
- (c) Zustimmungsvorbehalt gemäß § 21 Abs. 1 Satz 1 InsO
- (d) Gerichtliche Anordnung eines Zahlungsverbots
- (e) Zwischenergebnis
- (5) Rechtssicherheit durch den mit dem SanInsFoG eingeführten § 15b InsO?
- (a) Grundsystematik des § 15b InsO
- (b) Auswirkungen des § 15b Abs. 8 InsO auf die Pflichtenkollision zwischen Massesicherungspflicht und haftungsbewehrten Zahlungspflichten in der vorläufigen Eigenverwaltung
- (6) Zusammenfassende Bewertung des § 15b InsO und dessen Auswirkungen auf die Pflichtenkollision zwischen Massesicherungspflicht und haftungsbewehrten Zahlungspflichten
- cc) Zusammenfassende Bewertung der Eigenverwaltung als Anreiz zur frühzeitigen Umsetzung der Sanierung in einem Insolvenzverfahren
- k) Das Insolvenzplanverfahren
- aa) Grundzüge des Insolvenzplanverfahrens
- (1) Darstellender Teil
- (2) Gruppenbildung
- (3) Gestaltender Teil
- (4) Plananlagen
- (5) Verfahrensgang bis zum Erörterungs- und Abstimmungstermin
- (6) Erforderliche Mehrheiten und Obstruktionsverbot
- (7) Verfahrensgang ab dem Erörterungs- und Abstimmungstermin
- (8) Umsetzung der ESUG-Evaluation im Bereich des Insolvenzplanrechts?
- bb) Flankierung der Sanierungswirkung des Insolvenzplans durch die Regelungen über die Besteuerung von Sanierungsgewinnen
- (1) Grundzüge der Tatbestandsvoraussetzungen und Rechtsfolgen des § 3a EStG
- (2) Inkrafttreten des § 3a EStG und verbleibende Fragestellungen der Sanierungsbesteuerung
- (a) Keine Beihilfe i. S. d. Art. 107 Abs. 1 AEUV
- (b) Verbindliche Auskunft als Handlungsoption?
- cc) Anwendungsfelder und Anreizfunktion des Insolvenzplanverfahrens
- dd) Der Insolvenzplan als Impulsgeber auf Gesellschafterebene für eine Eigensanierung der Gesellschaft in der Insolvenz?
- (1) Die Interessenlage der am Schuldner beteiligten Personen
- (2) Die Rechtsstellung der am Schuldner beteiligten Personen im Insolvenzplanverfahren
- (3) Insolvenzrechtliche Rechtfertigung für den Eingriff in Anteilsrechte
- (4) Grenzen der insolvenzrechtlichen Gestaltungsfreiheiten
- (a) Verfassungsrechtlicher Schutz der Anteilseigner und Gläubiger
- (b) Verfassungsrechtliche Rechtfertigung des Eingriffs in den Schutzbereich der Art. 9 Abs. 1, 14 Abs. 1 GG
- (c) Keine verfassungsrechtliche Rechtfertigung bei vorhandenen milderen Mitteln
- (d) Entschädigung bei Eingriff in die grundrechtlich geschützten Rechte der Anteilseigner
- (aa) Ausnahme von der Entschädigungspflicht
- (bb) Quantifizierung des Entschädigungsanspruchs
- (e) Schutz eines Minderheitsgesellschafters im Insolvenzplanverfahren nach §§ 251, 253 InsO
- (f) Grundsätzlich erforderliche Beteiligung der sanierungswilligen und leistungsfähigen Anteilseigner bei Kapitalerhöhungen
- ee) Durchführung eines Investorenprozesses im Eigenverwaltungsverfahren als Grundlage für die Vergleichsrechnung im Insolvenzplan
- (1) Die Interessen der Verfahrensbeteiligten
- (2) Wesentliche Vor- und Nachteile des Dual-Track
- (3) Stellungnahme
- ff) Zusammenfassende Bewertung der Anreizwirkung des Insolvenzplanverfahrens zur frühzeitigen Verfahrenseinleitung auf Gesellschafterebene
- 5. Zwischenergebnis: keine ausreichenden Anreize für eine frühzeitige Verfahrenseinleitung
- V. Zwischenergebnis: keine Erreichung der mit der Einführung des § 18 InsO verbundenen rechtspolitischen Ziele
- K. Entwicklung von Gestaltungsanregungen für die Legislative
- L. Zusammenfassung in Thesen
- I. Rechtspolitische Ziele des Gesetzgebers bei Implementierung des § 18 InsO in die InsO
- II. Der Tatbestand der drohenden Zahlungsunfähigkeit gemäß § 18 InsO
- 1. Prüfungsmethodik: Erstellung eines Finanzstatus und eines Finanzplans
- 2. Prognosezeitraum
- 3. Das Merkmal der Voraussichtlichkeit nach § 18 Abs. 2 InsO
- 4. Eintritt der drohenden Zahlungsunfähigkeit gemäß § 18 InsO
- a) Kriterien der Zahlungsunfähigkeit gemäß § 17 InsO
- b) Heranziehung der Kriterien der Zahlungsunfähigkeit nach § 17 InsO für die Prüfung der drohenden Zahlungsunfähigkeit nach § 18 InsO: eigene Prüfungsmethodik
- 5. Pflicht zur Feststellung der drohenden Zahlungsunfähigkeit und Dokumentation der Prüfungshandlungen
- III. Maßnahmen zur Vermeidung oder Beseitigung einer drohenden Zahlungsunfähigkeit
- IV. Abgrenzung zu dem Insolvenzeröffnungsgrund der Überschuldung gemäß § 19 InsO und Auswirkungen auf den Anwendungsbereich des § 18 InsO
- V. Anforderungen an die Insolvenzantragstellung im Stadium der drohenden Zahlungsunfähigkeit
- VI. Erreichung der mit § 18 InsO verfolgten rechtspolitischen Ziele des Gesetzgebers
- 1. Gründe in der Person der organschaftlichen Vertreter
- 2. Bestehende Alternativen zu einer Insolvenzantragstellung
- 3. Überschneidung mit dem Eröffnungsgrund der insolvenzrechtlichen Überschuldung gemäß § 19 InsO
- 4. Mangelnde Anreize für eine frühzeitige Insolvenzantragstellung
- VII. Entwicklung von Gestaltungsanregungen für die Legislative
- Literaturverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
A. Einleitung
Mit der am 01. Januar 1999 in Kraft getretenen Insolvenzordnung (InsO) wurde die drohende Zahlungsunfähigkeit nach Maßgabe des § 18 InsO – neben den Eröffnungsgründen der Überschuldung nach § 19 InsO und der Zahlungsunfähigkeit gemäß § 17 InsO – als weiterer Eröffnungsgrund in das deutsche Insolvenzrecht implementiert. Mit dem zum 01. Januar 2021 in Kraft getreten Gesetz zur Fortentwicklung des Sanierungs- und Insolvenzrechts (Sanierungs- und Insolvenzrechtsfortentwicklungsgesetz – SanInsFoG) hat der Gesetzgeber die Richtlinie EU 2019/1023 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 u. a. über präventive Restrukturierungsrahmen1 in nationales Recht umgesetzt und damit sowohl das Gesetz über den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen für Unternehmen (Unternehmensstabilisierungs- und -restrukturierungsgesetz – StaRUG) verabschiedet als auch die InsO u. a. hinsichtlich der §§ 18, 19 InsO geändert, um den Überschneidungsbereich zwischen beiden Insolvenzeröffnungsgründen zu limitieren.2 Der Tatbestand hat hierdurch ein neues Gewand erhalten, das die praktische Anwendung und dessen Bedeutung im Restrukturierungsrecht neu ausrichtet.
Die drohende Zahlungsunfähigkeit ist nicht nur Eröffnungsgrund i. S. d. § 16 InsO, sondern hat darüber hinaus weitere Anknüpfungspunkte:
(i)Mit der Kenntnis der drohenden Zahlungsunfähigkeit sind – allerdings nicht ohne Hinzutreten weiterer subjektiver Elemente – gesetzliche Vermutungswirkungen im Rahmen der Anfechtungstatbestände der vorsätzlichen Benachteiligung gemäß § 133 Abs. 1 Satz 2 InsO und § 3 Abs. 1 Satz 2 AnfG verbunden.
(ii)Im Falle des Eintritts einer drohenden Zahlungsunfähigkeit bei einem Institut, welches dem besonderen Anwendungsbereich des § 46b KWG unterliegt, bestehen für die Geschäftsleiter Anzeigepflichten gemäß § 46b Abs. 1 KWG.←27 | 28→
(iii)Das Sanierungsprivileg gemäß § 39 Abs. 4 InsO greift bereits ab dem Zeitpunkt, zu dem die Zahlungsunfähigkeit i. S. d. § 18 InsO droht.
(iv)Ein Antrag gemäß § 270d Abs. 1 InsO (sog. Schutzschirmanordnung) kann lediglich bei drohender Zahlungsunfähigkeit i. S. d. § 18 InsO oder Überschuldung i. S. d. § 19 InsO gestellt werden.
(v)Die drohende Zahlungsunfähigkeit i. S. d. § 18 InsO ist Tatbestandsmerkmal der Straftatbestände des Bankrotts gemäß § 283 Abs. 1, 4 und 5 StGB sowie der Schuldnerbegünstigung nach § 283d Abs. 1 StGB.3
(vi)Der Eintritt der drohenden Zahlungsunfähigkeit ist Voraussetzung für die Anwendung der von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätze des Sanierens oder Ausscheidens4.
(vii)Nach der Konzeption des StaRUG ist Voraussetzung für die Umsetzung eines Restrukturierungsvorhabens i. S. d. § 31 StaRUG, dass das betreffende Unternehmen lediglich drohend zahlungsunfähig i. S. d. § 18 InsO ist. Die Instrumente des StaRUG können nach § 29 Abs. 1 StaRUG lediglich zur nachhaltigen Beseitigung einer drohenden Zahlungsunfähigkeit in Anspruch genommen werden, wohingegen die Restrukturierungssache aufzuheben ist, soweit Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung eingetreten ist, es sei denn, die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens liegt aufgrund des fortgeschrittenen Stadiums der Restrukturierungssache nicht im Interesse der Gläubigergesamtheit oder die Erreichung des Restrukturierungsziels ist überwiegend wahrscheinlich, § 33 Abs. 2 Nr. 1 StaRUG.
I. Problemstellung und Ziel der Untersuchung
1. Erreichung der im Zusammenhang mit § 18 InsO bestehenden rechtspolitischen Ziele des Gesetzgebers
Wesentliches Ziel des Gesetzgebers bei der Einfügung des Insolvenzeröffnungsgrundes der drohenden Zahlungsunfähigkeit war die Schaffung einer Möglichkeit für den Schuldner, eine Sanierung im Wege eines Insolvenzverfahrens in ←28 | 29→einem möglichst frühen Krisenstadium als verfahrensrechtliche Gegenmaßnahme einleiten zu können und im Liquidationsfall eine höhere verteilungsfähige Insolvenzmasse zugunsten der Gläubigergesamtheit zu erzielen.5
Untersuchungen haben jedoch ergeben, dass die Stellung eines Insolvenzantrags im Durchschnitt zehn bis elf Monate nach Eintritt der materiellen Insolvenz, mithin nach Eintritt der Zahlungsunfähigkeit gemäß § 17 InsO und/oder der Überschuldung nach § 19 InsO erfolgte.6 Im Zeitraum 2008 bis einschließlich 2011 wurde in lediglich 0,58 % der Unternehmensinsolvenzverfahren ein Insolvenzantrag wegen drohender Zahlungsunfähigkeit nach § 18 InsO gestellt.7
Mit dem Gesetz zur weiteren Erleichterung der Sanierung von Unternehmen (ESUG) sollten mit der Stärkung der Eigenverwaltung und insbesondere mit der Einführung des Verfahrens zur Vorbereitung einer Sanierung nach § 270b InsO a. F., sog. „Schutzschirmanordnung“ oder „Schutzschirmverfahren“, sowie der Umgestaltung des Insolvenzplanverfahrens nach §§ 217 ff. InsO weitere Anreize für eine frühzeitige Antragstellung zur Umsetzung einer Sanierung unter den insolvenz(verfahrens)rechtlichen Rahmenbedingungen geschaffen werden.8 Auch nach Einführung des ESUG konnte eine Vorverlagerung von Insolvenzanträgen allerdings nicht festgestellt werden.9 Insolvenzanträge ←29 | 30→wegen drohender Zahlungsunfähigkeit nach § 18 InsO wurden im Zeitraum 2012 bis einschließlich 2020 in lediglich 0,66 % der Unternehmensinsolvenzverfahren gestellt.10 Damit ist zu konstatieren, dass eine signifikante Nutzung des Eröffnungsgrundes nach § 18 InsO weiterhin ausbleibt.
Daher ist kritisch zu hinterfragen, inwieweit die mit der Implementierung des § 18 InsO in die Insolvenzordnung verbundenen Ziele des Gesetzgebers tatsächlich erreicht wurden. Dabei sind die Hintergründe für eine Zielerreichung oder Zweckverfehlung zu identifizieren.
Die Vielschichtigkeit der Hintergründe einer offenbar zurückhaltenden frühzeitigen Verfahrenseinleitung im Stadium der lediglich drohenden Zahlungsunfähigkeit richtet den Blick auf:
(i)die persönlichen Belange der organschaftlichen Vertreter;
(ii)bestehende Alternativen zu einer Insolvenzantragstellung wegen drohender Zahlungsunfähigkeit, nunmehr insbesondere die Möglichkeiten des Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmens nach dem StaRUG; in diesem Zusammenhang ist die Frage zu beantworten, ob eine an den Tatbestand des § 18 InsO anknüpfende außerinsolvenzliche Sanierungsgestaltungsoption eine frühzeitige Einleitung eines insolvenzlichen Sanierungsverfahrens im Stadium der drohenden Zahlungsunfähigkeit nachhaltig beeinträchtigen oder gar konterkarieren kann;
(iii)mögliche Überschneidungen mit dem Eröffnungsgrund der insolvenzrechtlichen Überschuldung nach § 19 InsO unter Berücksichtigung der Änderungen durch das SanInsFoG;
(iv)im Besonderen die vorhandenen Anreize für eine frühzeitige Insolvenzantragstellung.
Eine solche Anreizwirkung kann neben (i) der Eingrenzung der zivil- und strafrechtlichen Haftungsrisiken der organschaftlichen Vertreter, (ii) der Reduzierung von Insolvenzanfechtungsmöglichkeiten und (iii) der gesetzlichen Restschuldbefreiung im Besonderen auch (iv) von der Möglichkeit der Eigenverwaltung sowie (v) von den gesetzlichen Sanierungsinstrumenten entfaltet werden.
Doch welche gesetzlichen Instrumente gibt der Gesetzgeber dem Rechtsanwender zur Unternehmenssanierung in Insolvenzsituationen an die Hand und wie sind diese ausgestaltet? Ferner ist fraglich, ob diese rechtlichen ←30 | 31→Rahmenbedingungen ihrer Anreizfunktion auch in der Rechtsanwendungsrealität gerecht werden können. In diesem Zusammenhang sind auch – für diese Arbeit selektierte – rechtliche Spannungsverhältnisse zu analysieren, welche die Anreizfunktion von Sanierungsinstrumenten der InsO in der Fassung nach Einführung des ESUG hemmen konnten, um sodann zu evaluieren, ob die Neuregelungen durch das SanInsFoG die bisher bestehenden rechtlichen Spannungsverhältnisse zu lösen geeignet sind. Darüber hinaus werden eigene Lösungswege aufgezeigt.
2. Unklarheiten der tatbestandlichen Anforderungen
Auch zwanzig Jahre nach Einführung des § 18 InsO bestehen noch tatbestandliche Unklarheiten.11 Da im Zusammenhang mit dem Eröffnungsgrund der drohenden Zahlungsunfähigkeit prognostische Elemente auf Grundlage individueller Überzeugungen und Einschätzungen zu bewerten sind,12 eröffnet dies grundlegende Fragestellungen hinsichtlich Methode, Gegenstand und Zeitraum der anzustellenden Prognose, deren Beantwortung für eine praxistaugliche Anwendung des § 18 InsO von entscheidender Bedeutung sind.
So unterscheiden sich etwa bereits die von Rechtsprechung und Literatur entwickelten Methodenansätze zur Ermittlung drohender Zahlungsunfähigkeit – „dynamische Liquiditätsbilanz“ oder (Ertrags- und) Finanzplan. Ebenso ist fraglich, welchen Zeitraum die Prognose zu umfassen hat und welche Zahlungsverpflichtungen im Rahmen der Prognose zu berücksichtigen sind. Während der Wortlaut des § 18 Abs. 2 InsO nahelegt, dass lediglich auf die bestehenden Zahlungspflichten abzustellen ist, wird in der Regierungsbegründung zur InsO darauf hingewiesen, dass auch zukünftige, noch nicht begründete Zahlungspflichten in die Prognose einzubeziehen seien.13 Unklar ist auch, wie das Merkmal der Voraussichtlichkeit gemäß § 18 Abs. 2 InsO zu verstehen ist und wie die diesem Merkmal zugrundeliegende Wahrscheinlichkeitsbeurteilung praktisch handhabbar gemacht werden kann. Außerdem ist nicht ←31 | 32→definiert, ob für die Annahme einer drohenden Zahlungsunfähigkeit die von der Rechtsprechung entwickelten quantitativen und zeitlichen Anforderungen sowie insbesondere die – bisher sehr zurückhaltend behandelte – Frage nach der konkreten Berechnungsmethodik der Liquiditätslücke im Rahmen des Tatbestands der Zahlungsunfähigkeit nach § 17 InsO im Prognosezeitraum gemäß § 18 InsO vollumfänglich (inzident) geprüft werden müssen, folglich eine Doppelprognose für die Feststellung drohender Zahlungsunfähigkeit vorzunehmen ist.
Details
- Pages
- 562
- Publication Year
- 2022
- ISBN (PDF)
- 9783631879658
- ISBN (ePUB)
- 9783631879665
- ISBN (Hardcover)
- 9783631873540
- DOI
- 10.3726/b19818
- Language
- German
- Publication date
- 2022 (July)
- Keywords
- Insolvenz Überschuldung Insolvenzordnung Reformvorschlag Zivilrecht
- Published
- Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 2022. 562 S., 5 Tab.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG