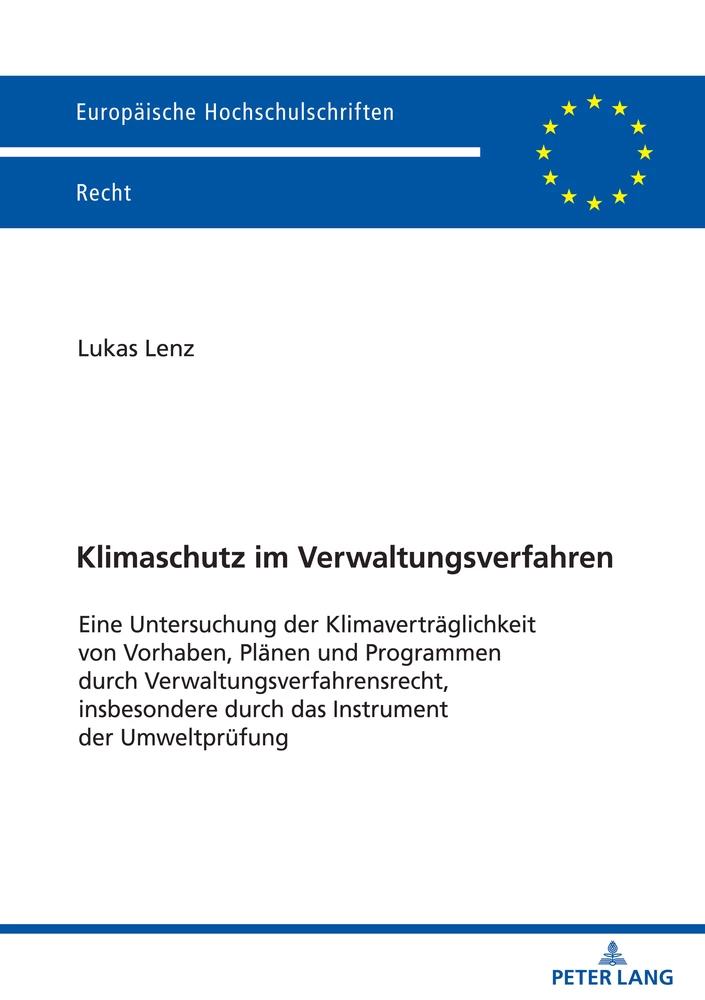Klimaschutz im Verwaltungsverfahren
Eine Untersuchung der Klimaverträglichkeit von Vorhaben, Plänen und Programmen durch Verwaltungsverfahrensrecht, insbesondere durch das Instrument der Umweltprüfung
Summary
Excerpt
Table Of Contents
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Vorwort
- Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Kapitel 1: Einleitung
- I. Einführung
- II. Gang der Untersuchung
- III. Methodik
- Kapitel 2: Grundlagen der Debatte um Klimastörungen
- I. Begrifflichkeiten
- 1. Klima
- 2. Klimawandel
- II. Naturwissenschaftliche Grundlagen
- 1. Treibhauseffekt
- 2. Treibhausgase, insbesondere CO2
- 3. Verursachergruppen
- III. Auswirkungen des Klimawandels
- 1. Anstieg der Temperatur
- 2. Rückgang der globalen Eisvorkommnisse
- 3. Anstieg des Meeresspiegels
- 4. Wetterextreme
- 5. Auswirkungen auf Ökosysteme
- 6. Auswirkungen auf den Menschen
- 7. Zusammenfassung der Auswirkungen
- IV. Strategien zur Bekämpfung der Klimastörungen
- 1. Mitigation, Adaption und Resilienz
- a. Mitigation
- b. Adaption
- c. Resilienz
- d. Klimapolitik hat mehrere Gesichter
- 2. Herausforderungen der Klimapolitik
- 3. Das 2-Grad-Ziel
- Kapitel 3: Rechtliche Vorgaben zum Klimaschutz
- I. Völkerrechtliche Vorgaben
- 1. Genfer Übereinkommen
- 2. Wiener Übereinkommen zum Schutz der Ozonschicht
- 3. Protokoll von Montreal
- 4. Klimarahmenkonvention
- 5. Kyoto-Protokoll
- a. Reduktionspflichten
- b. Weitere Kyoto-Mechanismen
- c. Emissionszertifikatehandel
- d. Bewertung des Kyoto Regimes
- e. Post Kyoto Regime
- 6. Paris Abkommen
- a. Klimaziele
- b. Verantwortlichkeit
- c. Unterschiedliche Verbindlichkeiten
- d. Nationally Determined Contributions (NDCs)
- e. Loss and Damage
- f. Erfüllungskontrolle und Transparenzsystem
- g. Bewertung
- 7. Klimakonferenzen COP24 und COP25
- 8. Stellung und Bedeutung des IPCC
- 9. Erkenntnisse des Völkerrechts
- II. Europarechtliche Vorgaben
- 1. Primärrecht
- 2. Europäische Zielsetzungen
- 3. Sekundärrechtliche Maßnahmen
- 4. Erkenntnisse des Europarechts
- III. Nationale Vorgaben
- 1. Verfassungsrecht
- a. Grundrechte auf Klimaschutz
- aa. Abwehrrechtliche Dimension
- bb. Schutzrechtliche Dimension
- aaa. Dogmatische Herleitung
- bbb. Tatbestand
- ccc. Intergenerationelle Dimension
- ddd. Schutzumfang und gerichtliche Kontrolldichte
- eee. Schutzverwirklichung durch Verwaltungsverfahren
- b. Vorgaben aus Art. 20a Grundgesetz
- aa. Schutzbereich
- bb. Einordnung als Staatsziel
- cc. Maß der Schutzverpflichtung
- dd. Erkenntnisse aus Art. 20a GG für den Klimaschutz
- c. Erkenntnisse des Verfassungsrechts zum Klimaschutz
- 2. Nationale Klimaschutzziele
- a. Meseberger Beschlüsse
- b. Energiekonzept
- c. Aktionsprogramm Klimaschutz 2020
- d. Klimaschutzplan 2050
- e. Kritik an Klimaschutzzielsetzung
- f. Klimaschutzgesetz
- 3. Der Klimaschutz-Beschluss des Bundesverfassungsgerichts
- a. Gegenstand des Beschlusses und Entscheidung
- b. Bedeutung der Wissenschaft/Budgetansatz des SRU
- c. Schutzpflichten
- d. Intertemporale Freiheitsrechte
- e. Erkenntnisse zu Art. 20a GG
- f. Das Verhältnis von Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Anpassung an den Klimawandel
- g. Stellungnahme und Ausblick
- 4. Entwicklungen seit dem Klimaschutz-Beschluss
- IV. Zusammenfassung der Vorgaben
- Kapitel 4: Verwaltungsverfahrensrecht
- I. Erfassung des Verfahrensrechts
- II. Allgemeine Stellung des Verfahrensrechts
- 1. Dienende Funktion des Verfahrens
- 2. Schwankende Grade der dienenden Funktion
- 3. Funktionen des Verfahrensrechts
- a. Richtigkeitsgewähr
- b. Generierung von Informationen und Wissen
- c. Demokratische Funktion
- d. Schutz der Grundrechte
- aa. Funktion
- bb. Schutzpflichten, Verfahren und Klimaschutz
- e. Akzeptanzschaffung
- f. Zwischenergebnis
- III. Die Abwägung als zentrales Element planungsrechtlicher Verfahren
- 1. Ablauf der Abwägung
- a. Ermittlung des Abwägungsmaterials
- b. Einstellung der Belange
- c. Gewichtung der Belange
- aa. Auswirkungen von Art. 20a GG auf die planerische Abwägung
- bb. Auswirkungen des Bundes-Klimaschutzgesetzes und des Klimaschutz-Beschlusses des BVerfG auf die planerische Abwägung
- cc. Auswirkungen der UVP auf die planerische Abwägung
- d. Ausgleich konfligierender Belange
- 2. Planungsalternativen
- 3. Gebot gerechter Abwägung/ Recht auf gerechte Abwägung
- a. Abwägungsausfall
- b. Abwägungsdefizit
- c. Abwägungsfehleinschätzung
- d. Abwägungsdisproportionalität
- 4. Der Klimaschutzbelang in der Abwägung
- a. Ermittlung und Einstellung
- b. Gewichtung
- c. Ausgleich mit konfligierenden Belangen
- IV. Zusammenfassung zum allgemeinen Teil des Verfahrensrechts
- Kapitel 5: Die Umweltprüfung
- I. Grundgedanken und Grundzüge
- 1. Umweltprüfungen als Instrument des Umweltrechts
- 2. Umweltprüfung als Verwirklichung des Verfassungsrechts?
- 3. Prinzipien der Umweltprüfung
- a. Vorsorgeprinzip
- aa. Inhalt und Bedeutung
- bb. Verfassungsrechtliche Dimension
- cc. Vorsorgeprinzip, Umweltprüfung und Klimaschutz
- b. Integrationsprinzip
- aa. Inhalt und Bedeutung
- bb. Integrationsprinzip, Umweltprüfung und Klimaschutz
- c. Kooperationsprinzip
- II. Geschichte der Umweltprüfungen
- 1. USA
- 2. Europa
- a. Richtlinie 85/337/EWG
- b. UVP-Änderungsrichtlinie 97/11/EG
- c. Die SUP-Richtlinie
- d. UVP-Richtlinie 2011/92/EU
- e. Richtlinie 2014/52/EU
- 3. Deutschland
- a. Vor der EU-Gesetzgebung
- b. Umsetzung der Richtlinie 85/337/EWG
- c. Weitere nationale Genese und Novelle 2017
- III. Verfahrensablauf der Umweltprüfung
- 1. Feststellung der UVP-Pflicht
- 2. Unterrichtung über den Untersuchungsrahmen (Scoping)
- 3. UVP-Bericht
- 4. Behördenbeteiligung
- 5. Öffentlichkeitsbeteiligung
- 6. Zusammenfassende Darstellung
- 7. Bewertung der Umweltauswirkungen
- a. Funktion und Zweck
- b. Maßstäbe der Bewertung
- c. Gesamtbewertung und Alternativen
- 8. Berücksichtigung bei der Vorhabenzulassung
- 9. Bekanntmachung der Entscheidung
- 10. Verhältnis der Umweltprüfung zur allgemeinen Abwägung
- IV. Klima in der Umweltprüfung
- 1. Normativer Niederschlag des Klimas im UVPG
- a. Schutzgut Klima
- b. UVP-Bericht
- c. Umweltbericht (SUP)
- 2. Klima in den unterschiedlichen Stufen der UVP
- a. Feststellung der UVP-Pflicht
- b. Unterrichtung über den Untersuchungsrahmen (Scoping)
- c. UVP-Bericht
- aa. Beschreibung des Vorhabens
- bb. Beschreibung der Merkmale des Vorhabens
- cc. Beschreibung der geplanten Maßnahmen
- dd. Beschreibung der erheblichen Umweltauswirkungen
- ee. Vernünftige Alternativen
- d. Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung
- e. Zusammenfassende Darstellung
- f. Bewertung der Klimaauswirkungen
- aa. Verbindlichkeit
- bb. Konkretheit
- aaa. Zeitliche Dimension
- bbb. Räumliche Dimension
- ccc. Inhaltliche Dimension
- cc. Fazit
- g. Berücksichtigung des Klimas bei der Vorhabenzulassung
- 3. Klima in den unterschiedlichen Stufen der SUP
- a. Feststellung der SUP-Pflicht
- b. Festlegung des Untersuchungsrahmens
- c. Umweltbericht
- aa. Darstellung der Umweltziele
- bb. Beschreibung der Auswirkungen
- cc. Darstellung der Vermeidungsmaßnahmen
- dd. Alternativen
- ee. Bewertung
- d. Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung
- e. Abschließende Bewertung
- f. Berücksichtigung
- 4. Fazit: Klima im Verfahren der Umweltprüfung
- 5. Ausblick: Einführung einer Klimaverträglichkeitsprüfung
- a. Einführung als Teil der UVP/SUP
- b. Einführung als selbstständiges Verfahren
- c. Bewertung und Fazit
- d. Prüfung der Klimawandelanpassungsfähigkeit und Klimaresilienz
- Kapitel 6: Die Rügemöglichkeit von Fehlern der UVP/SUP
- I. Relevanz der Rügemöglichkeiten für die Zwecke des Klimaschutzes
- II. Struktur der Rügemöglichkeiten
- 1. Allgemeine Klagemöglichkeiten gegen Verfahrensfehler
- 2. Klagen nach Umweltrechtsbehelfsgesetz
- a. Rechtsbehelfe von Umweltverbänden
- b. Rechtsbehelfe von Individualklägern
- c. Verfahrensfehler
- aa. Absolute Verfahrensfehler
- bb. Relative Verfahrensfehler
- cc. Verfahrensverständnis des § 4 UmwRG
- aaa. Ansicht des Bundesverwaltungsgerichts
- bbb. Ansicht des Oberverwaltungsgerichts Münster
- ccc. Stellungnahme
- d. Fehlerhafte Ermittlung des Klimabelangs
- e. Relativierung durch Heilungsmöglichkeiten
- aa. Struktur der Heilungsmöglichkeiten
- bb. Auswirkungen auf das Verfahren
- Kapitel 7: Klimaschutz bei der Planung von Bundesautobahnen
- I. Klimarelevanz des Verkehrs auf Bundesautobahnen
- II. Klimaschutzinstrumente im Verkehrsbereich
- 1. Überblick
- 2. Planungsansätze
- a. Städtebaurecht
- b. Raumordnung
- c. Fachplanungsrecht der Verkehrsinfrastruktur
- d. Handlungsoptionen Klimaschutz
- e. Verkehrsinduzierende Wirkung neuer Straßen
- III. Die Planung von Bundesautobahnen
- 1. Verfahrensschritte der Planung von Bundesautobahnen
- a. Transeuropäisches Verkehrsnetz
- b. Bundesverkehrswegeplan
- c. Bedarfsplan
- d. Raumordnungsverfahren
- e. Linienbestimmungsverfahren
- f. Planfeststellungsverfahren
- g. Einflussfaktoren
- 2. Klimaschutz im Verfahren der Planung von Bundesautobahnen
- a. Bundesverkehrswegeplan
- b. Bedarfsplan
- c. Raumordnungsverfahren
- d. Linienbestimmungsverfahren
- e. Planfeststellungsverfahren
- f. Zusammenfassende Erkenntnisse
- 3. Überprüfung bisher ergangener Planungsentscheidungen
- a. SUP zum BVWP 2030
- aa. Ermittlung des Klimaschutzbelangs
- bb. Kritik an der SUP
- cc. Rechtliche Bewertung durch das BVerwG
- dd. Stellungnahme
- b. Beispielhafte Planungsentscheidungen
- aa. Rahmenbedingungen
- bb. Untersuchte Merkmale
- aaa. Anerkennung des globalen Klimas
- bbb. Treibhausgasemissionen von Fahrzeugen
- ccc. Natürliche Kohlenstoffsenken
- ddd. Trassenalternativen
- eee. Klimaschutz in der materiellen Abwägungsentscheidung
- cc. Stellungnahme
- VI. Zusammenfassung und Ausblick
- Kapitel 8: Gesamtergebnis
- I. Umweltprüfung als geeignetes Klimaschutzinstrument
- II. Weitere Erkenntnisse
- III. Ausblick
- Literaturverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
←21 | 22→Kapitel 1: Einleitung
I. Einführung
Klimaschutz ist eine der wichtigsten, wenn nicht die wichtigste Aufgabe unserer Zeit. Diese Wahrnehmung war jedoch zu Beginn der vorliegenden Arbeit im Herbst 2018 nicht so uneingeschränkt vorherrschend. Das Politikfeld Klimaschutz wurde vielfach zwar als wichtiges Thema angesehen, ernsthafte politische Bestrebungen zur Bekämpfung der Klimastörungen waren jedoch die Ausnahme. Spätestens seit dem Wahlkampf zur Bundestagswahl 2021 ist Klimaschutz im gesellschaftlichen Mainstream angekommen. Als Auswirkung wird auch der rechtswissenschaftliche Diskurs in zunehmendem Maße von Fragen des Klimaschutzes, der Klimawandelanpassung und neuerdings auch der Klimaresilienz geprägt. Das Klimaschutzrecht unterliegt daher seit wenigen Jahren einem immensen Anpassungs- und Entwicklungsdruck. Auch im allgemeinen Umweltrecht hat das Klimaschutzrecht als ein Teilgebiet einen starken Bedeutungszuwachs erlebt. Wurde im Jahr 2010 noch über die Existenz und die Konturen eines Rechtsgebiets „Klimaschutzrecht“ nachgedacht1, bestehen mittlerweile mehrere deutschsprachige Handbücher speziell zu diesem Gebiet2 und weitere sind im Erscheinen.3
Klimaschutz ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Alle Teile der Gesellschaft müssen daher in das Klimaschutzregime eingebunden werden. Aus diesem Grund ist das Klimaschutzrecht geprägt durch einen breiten und ausdifferenzierten Instrumentenkatalog. So bestehen etwa ordnungsrechtliche Instrumente, wie die Bestimmung von Emissionsgrenzwerten für neuzuzulassende PKW. Für einen Großteil der Emissionen aus der Industrie hat sich zudem das ökonomische Instrument des Handels mit Emissionszertifikaten als das zentrale Instrumente in der EU entwickelt. Außerdem werden inzwischen die Emissionen aus Brennstoffen, wozu auch Benzin und Diesel gehören, in einem ←23 | 24→nationalen Zertifikatsystem gehandelt. Von Relevanz sind sodann der Ausbau der erneuerbaren Energien und die Förderung der Energieeffizienz. Nicht zuletzt kommt dem nationalen Planungsrecht, worunter etwa die Verkehrswegeplanung, die Raumplanung aber auch die Bauleitplanung zu fassen sind, gestiegene Bedeutung zu.4
Umweltprüfungen, wie die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) und die strategische Umweltprüfung (SUP), sind seit ihrer Einführung ins nationale Recht im Jahr 1990 zentrale und wichtige Elemente des allgemeinen Umweltrechts.5 Sie sind als spezielle verfahrensrechtliche Instrumente ausgestaltet und werden für den Fall ihrer Anwendung in das jeweilige Fachrecht integriert, das für einschlägige Zulassungsentscheidungen maßgeblich ist. Der Grundgedanken ist, dass mögliche erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt frühzeitig erkannt und berücksichtigt werden sollen. Der Unterschied von UVP und SUP besteht grundsätzlich beim Betrachtungsgegenstand. Die UVP nimmt einen vorhaben- bzw. projektbezogenen Blick ein, wohingegen die SUP die Umweltauswirkungen von Plänen und Programmen beleuchtet. Im Rahmen der UVP und SUP sollen die Umweltauswirkungen ermittelt, beschrieben und bewertet werden, damit eine (Zulassungs-)Entscheidung im Hinblick auf alle umweltrechtlichen Belange umfassend vorbereitet wird. Dadurch sollen die Belange der Umwelt das ihnen in der jeweiligen Situation zustehende Gewicht erlangen.6
Für den Schutz einer Vielzahl umweltrechtlicher Güter stellen UVP und SUP heute anerkannte und etablierte Instrumente dar.7 Obwohl auch das Klima ein Schutzgut dieser Umweltprüfungen ist, wurden UVP und SUP in Deutschland bisher kaum als Instrumente des Klimaschutzes angesehen.8 Vorliegende Arbeit geht daher der Frage nach, ob dieses spezielle Verfahrensrecht ein effektives ←24 | 25→Instrument im Kampf gegen den anthropogenen Klimawandel sein kann und daher in der Lage ist, den bereits bestehenden Instrumentenkatalog zu ergänzen.
In diesem Zusammenhang stellt sich außerdem die Frage, welchen Beitrag das allgemeine Verwaltungsverfahrensrecht zu den nationalen Klimaschutzbemühungen leisten kann. Denn in der rechtswissenschaftlichen Diskussion geht es vorrangig um materiellrechtliche Anforderungen zum Klimaschutz, wie etwa die Einführung der Klimaschutzklausel in § 2 Abs. 2 Nr. 6 S. 7 ROG, wonach Klimaschutzmaßnahmen ebenfalls durch Maßnahmen der Raumordnung Rechnung zu tragen ist.9 Die Bedeutung und der Beitrag des allgemeinen Verwaltungsverfahrensrechts zu den nationalen Klimaschutzbemühungen werden in diesem Zusammenhang bislang gänzlich ausgespart. Auch diese Lücke soll vorliegende Arbeit schließen.
Details
- Pages
- 370
- Publication Year
- 2022
- ISBN (PDF)
- 9783631884393
- ISBN (ePUB)
- 9783631884409
- ISBN (MOBI)
- 9783631884416
- ISBN (Softcover)
- 9783631883259
- DOI
- 10.3726/b20063
- Language
- German
- Publication date
- 2022 (August)
- Published
- Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 2022. 370 S.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG