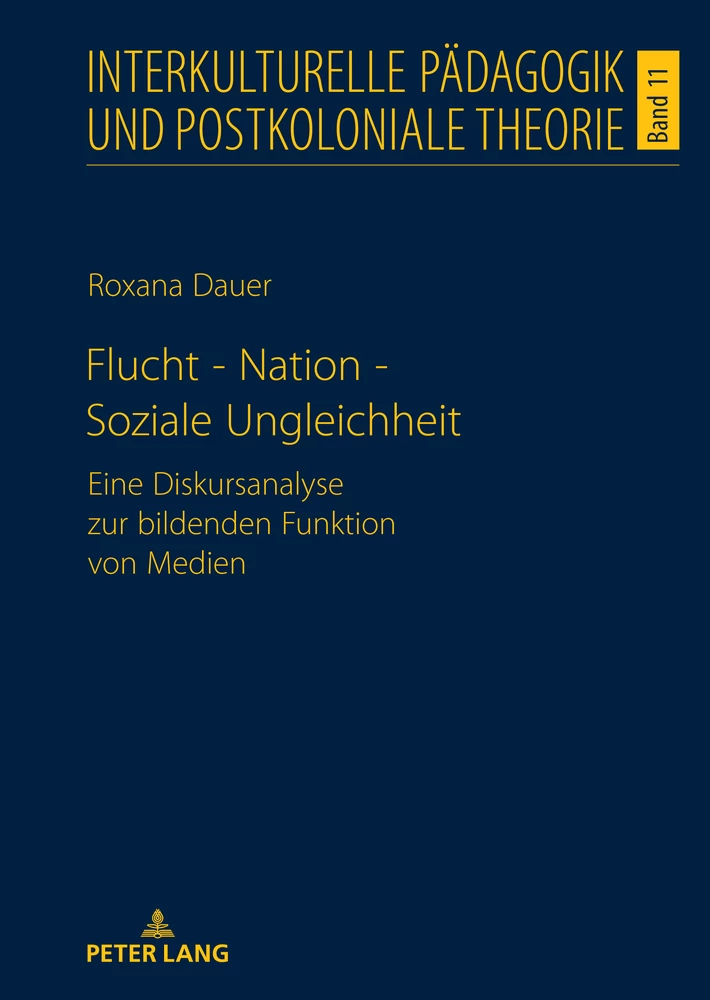Flucht - Nation - Soziale Ungleichheit
Eine Diskursanalyse zur bildenden Funktion von Medien
Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Danksagung
- Abstract
- Inhaltsverzeichnis
- 1 Problemstellung
- 2 Stand der Forschung und Erkenntnisinteresse
- 2.1 Diskursanalysen zu Flucht*Migration
- 2.2 Diskursanalytische Ansätze in der Medienpädagogik
- 2.3 ‚Flüchtlingskonstruktionen‘
- 2.4 Mediale Repräsentationen im Kontext von Flucht
- 2.5 Erkenntnisinteresse
- 3 Zum Aufbau der Arbeit
- 4 Zum Untersuchungsgegenstand Flucht*Migration
- 4.1 Abgrenzungen von Flucht gegenüber Migration
- 4.1.1 Zwischen Zwang und Freiwilligkeit: Juristische Bestimmung und allgemeiner Sprachgebrauch des „Flüchtlingsbegriffes“
- 4.1.2 Globale Ungleichheit und (Neo-)Kolonialismus: Beteiligung der EU-Mitgliedsstaaten an der Schaffung von Flucht*Migrationsursachen
- 4.1.2.1 Zwang zur Flucht*Migration am Beispiel transnationalen Landerwerbs
- 4.1.2.2 Weitere Beispiele für die Schaffung von Flucht*Migrationsursachen durch die EU-Außen- und Wirtschaftspolitik
- 4.1.3 Zwischenfazit
- 4.2 Soziale Ungleichheit im Kontext von Flucht*Migration
- 4.2.1 Das deutsche Asylsystem und die politisch-rechtlich legitimierte soziale Ungleichheit
- 4.2.2 Stereotypisierungen und Stigmatisierungen von geflüchteten*migrierten Personen im Kontext der Nation
- 4.2.3 Zwischenfazit
- 5 Funktionalistische Betrachtung von Medien
- 5.1 Die bildende Funktion von Medien
- 5.1.1 Annäherung an eine Definition des Bildungsbegriffs
- 5.1.2 Die bildende Funktion von Medien und der soziale Ausschluss einer politisch-rechtlichen Konstruktion von „Flüchtlingen“
- 5.1.3 Die bildende Funktion von Medien und der soziale Ausschluss einer sozialen Konstruktion von „Flüchtlingen“
- 5.2 Medien als (Re-)Produzierende sozialer Wirklichkeit
- 5.3 Medien als Kommunikationsmittel
- 5.4 Medien und Nationalstaat
- 5.4.1 Medien als (Re-)Produzierende der Nation
- 5.4.2 Medien als dem Staat verpflichtete Instanz
- 5.5 Zwischenfazit
- 6 Gouvernementalisierung des Staates im Fluchtkontext
- 6.1 Gouvernementalität
- 6.1.1 Annäherung an den Begriff der Gouvernementalität
- 6.1.2 Der Begriff der Regierung
- 6.1.3 Der Begriff der Macht
- 6.1.3.1 Strategische Spiele in zwischenmenschlichen Beziehungen
- 6.1.3.2 Macht-, Regierungsverhältnisse und die produktive Seite der Macht
- 6.1.3.3 Machtbeziehungen, Freiheit und Herrschaft
- 6.2 Sanfte Regierung und Zwangsausübung im Fluchtkontext
- 7 Methodologie und methodisches Vorgehen
- 7.1 Die diskursive Praktik der Repräsentation
- 7.2 Die Werkzeugkiste der Diskursanalyse
- 7.3 Datenerhebung und Wahl des Materialkorpus
- 7.4 Datenauswertung
- 8 Reflexion
- 8.1 Das Dilemma
- 8.2 Das Erfordernis einer Reflexion der eigenen Forschungstätigkeit
- 8.3 Die Verstrickungen
- 8.3.1 Westliche Wissenschaftler*innen und die Ausübung „epistemischer Gewalt“
- 8.3.2 Reflexion der eigenen Forschungstätigkeit in der vorliegenden Untersuchung
- 8.3.2.1 Die „komplizenhafte Verstrickung“ mit globaler Ungleichheit in der Position als westliche (Nachwuchs-)Wissenschaftler*in
- 8.3.2.2 Die (Re-)Produktion von sozialer Ungleichheit im Forschungsprozess
- 8.4 Zwischenfazit
- 9 Darstellung der Ergebnisse
- 9.1 „Was wollen wir tun?“ – Die Zeit – 23.04.2015
- 9.1.1 Deskription
- 9.1.2 Interpretation
- 9.2 „Willkommen!“ – Die Zeit – 06.08.2015
- 9.2.1 Deskription
- 9.2.2 Interpretation
- 9.3 „Die Macht der Gefühle“ – Die Zeit – 10.09.2015
- 9.3.1 Deskription
- 9.3.2 Interpretation
- 9.4 „Weiß sie, was sie tut?“ – Die Zeit – 17.09.2015
- 9.4.1 Deskription
- 9.4.2 Interpretation
- 9.5 „Wir sind die Neuen!“ – Die Zeit – 01.10.2015
- 9.5.1 Deskription
- 9.5.2 Interpretation
- 9.6 „Was helfen Zäune?“ – Die Zeit – 29.10.2015
- 9.6.1 Deskription
- 9.6.2 Interpretation
- 9.7 Zwischenfazit
- 10 Ableitungen für (sozial-)pädagogische Handlungsfelder
- 11 Abschließende Betrachtung
- 12 Abbildungsverzeichnis
- 13 Tabellenverzeichnis
- 14 Literaturverzeichnis
- Reihenübersicht
1 Problemstellung
Deutsche Medien diskutieren insbesondere seit dem Jahr 2015 die Zuwanderung von Menschen nach Europa und Deutschland kontrovers. Nicht selten war und ist bis heute in diesem Zusammenhang von der sogenannten „Flüchtlingskrise“1 die Rede. Dieses Thema hat ähnlich wie bereits in den 1990er Jahren erneut eine Hochkonjunktur erfahren. Auf den ersten Blick lassen sich seit dem Jahr 2015 sehr diverse und vielfältige Diskursstränge ausmachen. So wurde beispielsweise über eine deutsche „Willkommenskultur“ (vgl. Fischhaber 2015) in den Medien berichtet und es waren Bilder zu sehen, wie Menschen an überfüllten Bahnhöfen von Ehrenamtlichen freudig empfangen und mit dem Nötigsten versorgt wurden (vgl. Hengst/Sperber 2015). Thematisiert wurden Einzelschicksale, wie beispielsweise im Falle Alan Kurdis, dessen Leichnam gemeinsam mit dem seiner Mutter Rehana Kurdi und dem seines Bruders Ghalib Kurdi an der türkischen Mittelmeerküste angeschwemmt wurde. Sie waren bei dem Versuch das Mittelmeer zu überqueren, ertrunken (vgl. Frank 2015). Einprägsam waren ebenso Fotoaufnahmen von Menschen, die aus Kriegsgebieten wie Syrien oder Afghanistan zu Fuß auf europäischen Autobahnen unterwegs waren (vgl. Orth 2015). Oder aber es wurde in deutschen Medien über Anschläge auf Personen in Erstaufnahmeeinrichtungen berichtet, wie bspw. in Heidenau (vgl. Meisner 2015) und Clausnitz (vgl. Tretbar 2016). In Heidenau kam es im August 2015 anlässlich einer bevorstehenden Nutzung eines leerstehenden Gewerbegebäudes als Erstaufnahmeunterkunft über mehrere Tage hinweg zu massiven rechtsextremen Ausschreitungen, während in Clausnitz ein Mob mit „Wir sind das Volk!“-Ausrufen Personen einschüchterte, die sich mit einem Bus auf der Anreise zu ihren Wohnungen befanden. Gegen die rechten Demonstrierenden wurde nicht durchgegriffen, sondern die Polizei wandte körperlichen Zwang gegenüber den Personen im Bus an, wie ein medial weit verbreiteter Videoausschnitt dokumentierte (vgl. Spiegel Online 2016).
Die Liste an Ereignissen, die rund um den Themenbereich Flucht*Migration2 seit dem Jahr 2015 in den Medien behandelt wurden, ließe sich über viele ←13 | 14→weitere Seiten fortsetzen und wäre dennoch nicht erschöpft. Was sich anhand der medialen Berichterstattung jedoch zeigt, ist, dass Flucht*Migration die Gesellschaft bewegt. Es scheinen Themen zu sein, welche es wert sind, dass Medien darüber in Bezug auf verschiedenste gesellschaftliche Bereiche berichten. Sei es bezogen auf das Gemeinwesen von Städten und Kommunen, den Wohnungs- und Arbeitsmarkt, den Gesundheits- und Bildungssektor, inter-/nationale Politik u.v.a.m. Parallel zu der großen medialen Präsenz des Themenbereiches Flucht*Migration hat es seit dem Jahr 2015 eine Reihe gesetzlicher Verschärfungen in der deutschen Asylgesetzgebung sowie repressive Maßnahmen in deutscher und europäischer Migrationspolitik gegeben. Um nur einige Beispiele zu nennen:
- • Mit der Verabschiedung der sogenannten Asylpakete I und II in den Jahren 2015 und 2016 wurde die bereits ohnehin stark reglementierte Gewährung von Asyl weiter beschränkt. Das Asylpaket I, das am 23. Oktober 2015 in Kraft trat, erhöht u.a. die Aufenthaltsdauer für Schutzsuchende in Erstaufnahmeeinrichtungen ebenso wie die Residenzpflicht3 von drei auf sechs Monate. Albanien, Kosovo und Montenegro wurden zu sicheren Herkunftsstaaten erklärt und auf diese Weise die Durchsetzung von Abschiebungen von Personen, denen der Schutzstatus nicht zuerkannt wurde, beschleunigt. Das Sachleistungsprinzip4 wurde gegenüber dem Geldleistungsprinzip ←14 | 15→gestärkt sowie Leistungskürzungen bis unterhalb des Existenzminimums ermöglicht (vgl. Der Bundestag 2016a; Dernbach 2016; Pro Asyl 2015).
- • Im Rahmen des Asylpakets II wurde u.a. der Familiennachzug für subsidiär Schutzberechtigte vom 17. März 2016 bis zum 1. August 2018 ausgesetzt (vgl. Der Bundestag 2016b). Dies galt auch für unbegleitete, minderjährige Personen. Erst seit August 2018 ist der Nachzug von engsten Familienangehörigen wieder möglich, dabei jedoch auf ein Kontingent von 1.000 Personen pro Monat begrenzt (vgl. BAMF 2018; Kessler und Krause 2018, S. 4).
- • In Bayern wurden sogenannte „Ankerzentren“ (Ankunfts-, Entscheidungs- und Rückführungszentren; vgl. Lückoff 2019) eigerichtet. Bis zur Entscheidung über ihren Asylantrag werden Schutzsuchende dort für bis zu 18 Monate untergebracht. Während dieser Zeit besteht für sie Residenzpflicht, sie unterliegen einem Ausbildungs- und Arbeitsverbot, staatliche Transferleistungen werden nach dem Sachleistungsprinzip gewährt, es besteht ein Betreuungsverbot für ehrenamtliche Helfende sowie eine eingeschränkte medizinische Versorgung (vgl. Pro Asyl 2018: 4).
- • Das Bundeskabinett hat im April 2019 den Entwurf von Bundesinnenminister Horst Seehofer für ein „Geordnetes-Rückkehr-Gesetz“ verabschiedet5. Dieser Gesetzesentwurf ist eine weitere Maßnahme, welche das Asylgesetz in Deutschland deutlich schwächt (vgl. Pro Asyl 2019). Es sieht u.a. vor, dass asylbeantragende Personen, die keine Ausweisdokumente vorlegen oder bei der Beschaffung von Ersatzunterlagen nicht mitwirken, mit Sanktionen bei Sozialleistungen, Arbeitsverbot und Wohnsitzauflagen rechnen müssen. Darüber hinaus wird die Inhaftierung von Personen erleichtert, deren Asylantrag abgelehnt wurde. Diese sollen auch in regulären Haftanstalten untergebracht werden können, wenn keine Plätze in speziell dafür vorgesehenen Einrichtungen vorhanden sind (vgl. Bullion 2019; Iser 2019). Mit der Aufhebung einer räumlichen Trennung zwischen Personen, denen kein Aufenthalt gestattet wird, und strafgefangenen Personen, wird gleichzeitig eine Gleichsetzung zwischen Asylrecht und Strafrecht vorangetrieben. Eine zunehmende Kriminalisierung von asylsuchenden Personen ist die Konsequenz.
- • Auf internationaler Ebene versuchen Deutschland und die EU-Mitgliedstaaten geflüchtete*migrierte Personen zunehmend daran zu hindern, in die Nähe der Grenzen der EU zu kommen. Ein Beispiel hierfür ist die Verabschiedung des sogenannten EU-Türkei-Deals. Dieser besagt, ←15 | 16→dass die Türkei Schutzsuchende zurücknimmt, die nach dem 20. März 2016 ohne gültige Reisedokumente über die Türkei das Territorium europäischer Mitgliedstaaten erreicht haben. Hiervon können alle Personen, die kein Asyl beantragen oder deren Asylantrag bereits abgelehnt wurde, betroffen sein (vgl. Europäischer Rat 2016). Im Gegenzug haben sich die EU-Mitgliedsstaaten bereit erklärt, für jede – hauptsächlich von den griechischen Inseln – abgeschobene Person, eine andere schutzsuchende Person aus der Türkei aufzunehmen. Dieses 1:1 Verfahren stellt eine weitere Maßnahme dar, die abschreckend wirkt. Für geflüchtete*migrierte Personen wird damit das Risiko erhöht, keine langfristige Bleibeperspektive innerhalb der europäischen Mitgliedsstaaten zu erhalten, wenn sie versuchen sollten, über die Mittelmeerroute in die EU einzureisen. Zudem sicherte die EU der Türkei bis Ende 2018 drei Milliarden Euro für die Versorgung Schutzsuchender in der Türkei zu (vgl. Cremer 2017; Schmeitzner 2018; Tagesschau.de 2016).
- • Darüber hinaus bemüht sich die EU um einen Ausbau ihres Einflusses in afrikanischen Staaten, um zu verhindern, dass geflüchtete*migrierte Personen nach Europa kommen. Unter Slogans wie „The European Union’s cooperation with Africa on migration“ (EU KOM 2015) zahlt die EU im Rahmen unterschiedlicher Abkommen (vgl. z.B. „Rabat Process“, „Khartoum Process“; ebd.) Hilfsleistungen an afrikanische Staaten, die sich im Gegenzug verpflichten, die sogenannte „irreguläre Migration“ (ebd.) zu bekämpfen. Das bedeutet: Mehr Entwicklungshilfe für mehr Flucht*Migrationskontrolle. Die EU investiert in diesem Bereich immer mehr Geld. In dem Zeitraum von dem Jahr 2000 bis 2015 waren es rund zwei Milliarden Euro. Bis zum Jahr 2020 sollen weitere 14 Milliarden Euro in diesem Bereich ausgegeben werden (vgl. Jakob/Schlindwein 2017: 12). Die Bemühungen der EU sind darauf ausgerichtet, jede Bewegung von Staatsbürger*innen afrikanischer Staaten in Richtung Europa als irregulär zu erklären. Schlindwein (2019) macht dies am Beispiel Niger eindrücklich nachvollziehbar:
- „Die nigrische Stadt Agadez war bislang Drehkreuz für Migranten aus Westafrika in Richtung Mittelmeer: Durch diese historische Handelsstadt im Herzen des Niger geht seit Jahrtausenden alles hindurch, was von Westafrika durch die Sahara will: Waren, Händler, Kamele und Migranten. Agadez ist die letzte große Oase vor der Sahara. Schon immer zogen hier die Karawanen durch. Weil Flüge teuer sind, reisen Afrikaner lieber mit dem Bus. Überall auf dem Kontinent sprießen überregionale Buslinien aus dem Boden, vor allem in der gemeinsamen Westafrikanischen Wirtschaftsunion ECOWAS, wo es – wie im Schengen-Raum – Freizügigkeit gibt. Schon 2015 hatte die nigrische Regierung ein Gesetz beschlossen, durch das der ‚Transport von Menschen‘ mit einer Gefängnisstrafe von bis zu 30 Jahren sowie einer Geldbuße von bis zu 45.000 Euro bestraft werden kann. Doch das Gesetz ←16 | 17→wurde lange Zeit nicht angewandt. Dann reiste im Herbst 2016 Bundeskanzlerin Angela Merkel in den Niger. Sie hatte ein Geschenk dabei: Ein Projekt der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) für Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen im Niger im Wert von ca. 15 Millionen Euro. Nigers Präsident Mahamadou Issoufou lächelte verlegen und meinte, er habe da eher einen Betrag von rund einer Milliarde Euro im Sinn. Dafür wurde er müde belächelt. Aber dann bekam er doch, was er wollte. Nicht einmal ein Jahr später, auf der Geber-Konferenz für Niger im November 2017, schnürte die EU ein Hilfspaket für das Land. Deutschland gab noch einmal eine Extraportion obendrauf. Die Endsumme belief sich auf eine Milliarde Euro. Mit dieser Milliarde Euro stattete Deutschland die nigrische Armee mit Fahrzeugen und Radargeräten aus. Die Franzosen brachten ihren nigrischen Kameraden Verhaftungstechniken bei. Frontex entsandte Verbindungsbeamte nach Niger. Mithilfe von hochauflösenden Satellitenaufnahmen verfolgt die europäische Grenzschutzbehörde auf Bildschirmen in ihrem Hauptquartier in Warschau Reifenspuren im Wüstensand: Von Agadez aus müssen Lastwagen, Busse oder Pick-Ups vollbeladen mit Waren und Migranten tausende Kilometer durch die Wüste fahren, um die libysche Grenze zu erreichen. Unterwegs machen sie an Wasserstellen Halt, um Trinkflaschen aufzufüllen. Mithilfe von französischen Soldaten stationierte Nigers Armee gezielt Einheiten an den Wasserstellen entlang der Wüstenroute von Agadez nach Libyen. Dies führt dazu, dass immer mehr Fahrer weite Umwege machen, um Verhaftungen zu entgehen. Die Folge: Immer mehr Migranten verdursten auf dem langen beschwerlichen Weg durch die Sahara. Anfang Juni 2017 erklärte das Rote Kreuz in Niger: Ein Lastwagen war mitten in der Sahara liegen geblieben. Nur sechs Menschen konnten sich zu Fuß bis zur nächsten Wasserquelle durchschlagen. Zwei der Überlebenden führten Retter danach zum Unglücksort, an dem 44 Leichen gefunden wurden, darunter 17 Frauen und sechs Kinder. Am selben Tag rettete die nigrische Armee etwas weiter östlich 40 Menschen, die von Schleppern in der Sahara zurückgelassen wurden. Erst wenige Wochen zuvor waren in der nigrischen Wüste acht Migranten auf dem Weg nach Algerien verdurstet, darunter fünf Kinder. Gratuliert hat die Europäische Kommission Niger am 15. Dezember 2016 dafür, dass weniger Migranten nach Europa kommen. Schmuggler waren verhaftet und vor Gericht gestellt worden, 95 Fahrzeuge zum Transport von Migranten beschlagnahmt und neun Polizisten inhaftiert worden, weil sie unter Korruptionsverdacht standen. Niger leistet der EU als Türsteher einen gewaltigen Dienst.“
- • Die verheerenden Folgen dieser EU-Politik sind seit langem bekannt. Tausende Menschen haben im Mittelmeer, in der Sahara oder in Lagern wie in Libyen, in denen „KZ-ähnliche Verhältnisse“ (Semsrott 2018) herrschen, ihr Leben verloren. Der UNHCR hat allein im Zeitraum der Jahre 2015 bis 2018 insgesamt 14.708 Todesopfer im Mittelmeer sowie entlang der Landgrenzen Europas registriert (vgl. Tabelle 1). Der öffentliche und politische Diskurs wäre womöglich ein anderer, hätte es sich hierbei um Europäer*innen gehandelt.
- ←17 | 18→Es gibt aktuell keine sicheren Flucht*Migrationswege nach Europa. Die Mittelmeerroute ist einer der gefährlichsten Flucht*Migrationskorridore weltweit. Diese Situation ist europapolitisch gewollt. Im Falle Libyens wird dies deutlich, da die EU sich selbst durch Berichte des Auswärtigen Amtes, die auf „allerschwerst[e], systematisch[e] Menschenrechtsverletzungen“ (AA 2017, S. 1) hinweisen, nicht davon abhalten lässt, weiterhin große Summen zum Grenzschutz zur Verfügung zu stellen (vgl. Obert 2017; Peters/Popp 2018). Von dieser Politik profitieren zeitgleich europäische IT-Unternehmen sowie Rüstungs- und Sicherheitskonzerne. Denn es fließen nicht nur Geldleistungen, sondern auch Grenzschutztechnologien in Richtung afrikanischer Staaten.
- „So stellten das Bundesverteidigungsministerium und das Auswärtige Amt 2016 zwölf Millionen Euro […] zur Verfügung, aus dem auch Sicherheitsprojekte im Irak, Jordanien, Mali und Nigeria finanziert werden. Für 2017 wurden weitere 40 Millionen für Tunesien eingeplant […]. Auch die EU steuert 14 Millionen Euro für tunesische Grenzaufrüstung bei. Deutsche Bundespolizisten bilden tunesische Grenzschützer aus, die Bundeswehr schickt Schnellboote und gepanzerte Lastwagen. Für 2017 hatte Deutschland mobile Überwachungssysteme mit Bodenaufklärungssystemen an der tunesisch-libyschen Grenze zugesagt. Fünf Nachtüberwachungssysteme, 25 Wärmebildkameras, 25 optische Sensoren und fünf Radarsysteme hat Airbus für die Ausbildung nach Tunesien geliefert. Bezahlt hat das Gerät die Bundesregierung, aus Steuergeldern. Tunesien bekommt die Hightech-Grenze quasi umsonst.“ (Jakob/Schlindwein 2017: 197)
- Bei der Zusammenarbeit mit afrikanischen Staaten in Grenzschutzfragen verfolgt die EU folglich (mindestens) zwei migrations- und wirtschaftspolitische Interessen: einerseits Menschen an der Flucht*Migration nach Europa zu hindern, andererseits Rüstungs- sowie Sicherheitstechnik abzusetzen.
Tabelle 1: Recorded Deaths at the Mediterranean Sea and along land routes at Europe’s borders 2015–2018
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
Total | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Deaths at sea |
3.771 |
5.096 |
3.139 |
2.275 |
14.281 |
|
Number of deaths recorded along land routes at Europe’s borders |
144 |
72 |
Details
- Seiten
- 274
- Erscheinungsjahr
- 2022
- ISBN (PDF)
- 9783631885215
- ISBN (ePUB)
- 9783631885222
- ISBN (MOBI)
- 9783631885239
- ISBN (Hardcover)
- 9783631885062
- DOI
- 10.3726/b20010
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2022 (September)
- Erschienen
- Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 2022. 274 S., 6 farb. Abb., 2 s/w Abb., 3 Tab.
- Produktsicherheit
- Peter Lang Group AG