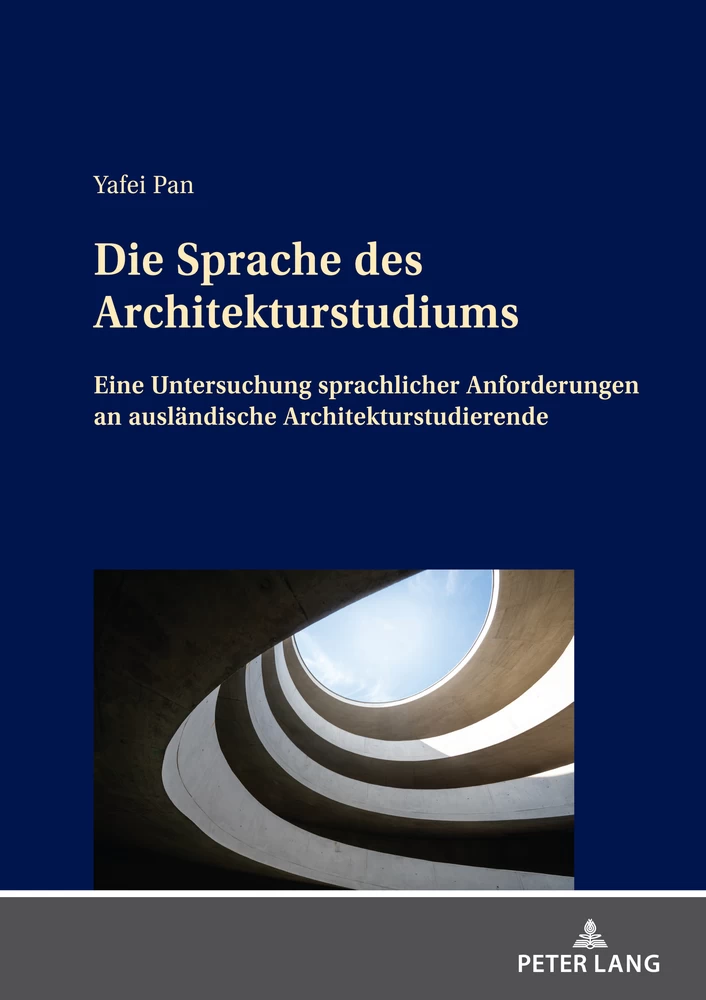Die Sprache des Architekturstudiums
Eine Untersuchung sprachlicher Anforderungen an ausländische Architekturstudierende
Summary
Excerpt
Table Of Contents
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Inhaltsverzeichnis
- Danksagung
- Abbildungsverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Fragestellung und Zielsetzung
- 3 Forschungsstand
- 3.1 Fachsprachen: ihre Definition und Merkmale
- 3.2 Fachsprachenforschung im akademischen Kontext
- 3.3 Allgemeine und fachsprachliche Sprachbedarfserhebung
- 4 Fachsprache oder Language for Special Purposes (LSP)?
- 4.1 Zum Verständnis des Begriffes „Fach“
- 4.2 Beziehung zwischen Fachsprache und Gemeinsprache
- 4.3 „For Special Purpose“ als „Fach“ zu verstehen
- 5 Architekturstudium in Deutschland, der Kommunikationsinhalt
- 5.1 Die Multidisziplinarität der Architekturlehre
- 5.2 Der Kommunikationsinhalt des Architekturstudiums
- 5.3 Sprachliche Konsequenzen
- 6 Sprachbedarf und kommunikative Anforderung
- 6.1 Der Begriff „Sprachbedarf“
- 6.2 Ausgewählte kommunikative Anforderungen (Teil der objektiven Necessities)
- 7 Untersuchungsmethode
- 8 Auswahlkriterien und Zusammensetzung des Korpus
- Empirischer Teil
- 9 Einteilung der Texte nach textexternen Kriterien
- 9.1 Textfunktion
- 9.1.1 Die bestehenden Ansätze zur Textfunktion
- 9.1.2 Perspektivenwechsel der Textfunktion
- 9.1.3 Die angestrebten Ziele der Architekturstudierenden als Typologisierungsbasis
- 9.2 Kommunikationssituation
- 10 Unterscheidung nach textinternen Kriterien
- 10.1 Auf thematisch-struktureller Ebene
- 10.1.1 Themen im Architekturstudium
- 10.1.2 Makrostruktur und Themenentfaltung
- 10.1.3 Themenentfaltungstypen
- 10.1.4 Text-Bild-Beziehung
- 10.1.5 Analyse-Beispiele zur Themenentfaltung
- 10.1.6 Fazit der Analyse der thematischen Struktur
- 10.2 Formal-grammatische Ebene
- 10.2.1 Untersuchungsgegenstände
- 10.2.2 Analyseverfahren und die Ergebnisse auf der lexikalischen Ebene
- 10.2.3 Analyseverfahren und Ergebnisse auf der syntaktischen Ebene
- 11 Zusammenfassung des empirischen Teils und Diskussion
- Auf der Ebene der Textfunktion
- Auf der Ebene der Kommunikationssituation
- Auf der thematisch-strukturellen Ebene
- Auf der formal-grammatischen Ebene
- 12 Schlusswort
- Literaturverzeichnis
- Quellenangaben der Korpustexte
- Anlage 1
- Anlage 2
- Anlage 3
Danksagung
Eine wissenschaftliche Arbeit ist nie das Werk einer einzelnen Person, deshalb möchte ich an dieser Stelle allen Menschen meinen großen Dank aussprechen, die mich bei der Anfertigung meiner Dissertation unterstützt haben.
In erster Linie möchte ich meinem Betreuer danken. Als erster Gutachter stand Herr Professor Ulrich Steinmüller mir während des langen Zeitraumes immer geduldig für klärende und konstruktive Gespräche zur Verfügung und lieferte zahlreiche wichtige Vorschläge an. Frau Professorin LIU Fang bin ich für ihr zweites Gutachten zu Dank verpflichtet. Ohne ihren wertvollen akademischen Rat wäre diese Arbeit nicht entstanden.
Mein besonderer Dank gilt Herrn Peter Winkler für das mühsame und sorgfältige Korrekturlesen der Manuskripte, die nützlichen Stellungnahmen und die konstruktive Kritik zur Thematik.
Mein Dank geht auch an die Professoren Torsten Schlak und Thorsten Roelcke sowie die ehemalige Dozentin Constanze Saunders, die mich mit bereichernden Tipps in diese fruchtbaren thematischen Bahnen gelenkt haben.
Ebenso will ich den Professoren und Studierenden des Architekturbereiches an der TU Berlin danken. Ohne ihre Unterstützung hätten die wichtigen Informationen über das Architekturstudium nicht gesammelt werden können.
Nicht zuletzt möchte ich an dieser Stelle meinen ewigen Dank für die unbedingte ideelle und finanzielle Überstützung meiner Eltern und meines Mannes zum Ausdruck bringen. Ohne sie wäre die Arbeit nicht möglich gewesen.
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 4-1: Horizontale Fachsprachengliederung nach Hoffmann (1985, S. 58)
Abbildung 4-2: Die von Göpferich (1995, S. 25) „gleitende Skala“ nach Kalverkämper
Abbildung 6-1: Die Bestandteile der „Needs“ (in Anlehnung an Hutchinson und Waters 1987, S. 55–62)
Abbildung 9-1: Typologisierungsschema von Göpferich 1995, S. 124
Abbildung 10-4: Die Anteile der Komposita in den primären Textsorten
Abbildung 10-6: Die Anteile der Derivata in den primären Textsorten
Abbildung 10-7: Die Anteile der verschiedenen Affixe in den gesamten Derivata (ausgewählte Affixe)
Abbildung 10-11: Die Anteile der verschiedenen Metapherntypen in den Texten des Korpus
Abbildung 10-12: Nebensatztypen im Korpus
Abbildung 10-13: Die Anteile der Infinitivsätze mit „zu“ in den jeweiligen Texten
Abbildung 10-14: Die Anteile der Infinitivsätze mit „zu“ in den primären Textsorten
Abbildung 10-15: Die Anteile der Konditionalsätze in den jeweiligen Texten
Abbildung 10-16: Die Anteile der Konditionalsätze in den primären Textsorten
Abbildung 10-17: Die Anteile der Finalsätze in den jeweiligen Texten
Abbildung 10-18: Die Anteile der Finalsätze in den primären Textsorten
Abbildung 10-19: Die Anteile der Relativsätze in den jeweiligen Texten
Abbildung 10-20: Die Anteile der Relativsätze in den primären Textsorten
Abbildung 10-21: Die Anzahl der Attribute pro Satz in den jeweiligen Texten
Abbildung 10-22: Die Anzahl der Attribute nach den primären Textsorten
Abbildung 10-23: Die Anteile der verschiedenen attributiven Konstruktionen
Abbildung 10-24: Die Anteile der FVG in den jeweiligen Texten
Abbildung 10-27: Die Anteile der verschiedenen Passiv- und Passiversatzformen im Korpus
Tabellenverzeichnis
Tabelle 5-1: Pflichtmodule des Bachelorstudiengang Architektur an der TU-Berlin (2015)
Tabelle 10-1: Zusammenfassung der Analyse zu den Themenentfaltungstypen der Korpustexte
Tabelle 10-2: Zusammenfassung der Analyse zu den Text-Bild-Beziehungen der Korpustexte
Tabelle 10-5: Ausgewählte untersuchte grammatische Phänomene in der vorliegenden Untersuchung
Tabelle 10-7: Die Anzahl der Sätze in den jeweiligen Texten im Korpus
Tabelle 10-8: Die Anzahl der Nebensätze in den jeweiligen Texten
1 Einleitung
Auf dem internationalen Bildungsmarkt hat sich Deutschland als attraktiver Studien- und Forschungsstandort etabliert. Die zahlreichen ausländischen Studierenden möglichst schnell in die deutschen Hochschulen zu integrieren, stellt sowohl für die Regierung als auch für die Sprachlehrer eine große Herausforderung dar. Obwohl seit vielen Jahren schon intensive Forschung auf dem Gebiet der Wissenschafts- und Fachsprachen betrieben wird, gibt es vonseiten der Theoretiker nur wenige praktische Tipps zur Didaktik der jeweiligen Sprachen.
Details
- Pages
- 240
- Publication Year
- 2022
- ISBN (PDF)
- 9783631874332
- ISBN (ePUB)
- 9783631874349
- ISBN (Hardcover)
- 9783631872956
- DOI
- 10.3726/b19486
- Language
- German
- Publication date
- 2022 (September)
- Keywords
- Fachsprache Fachsprachenlinguistik Textanalyse Korpusanalyse (Sprache der) Architektur
- Published
- Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 2022. 240 S., 62 S/W-Abb., 17 Tab.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG