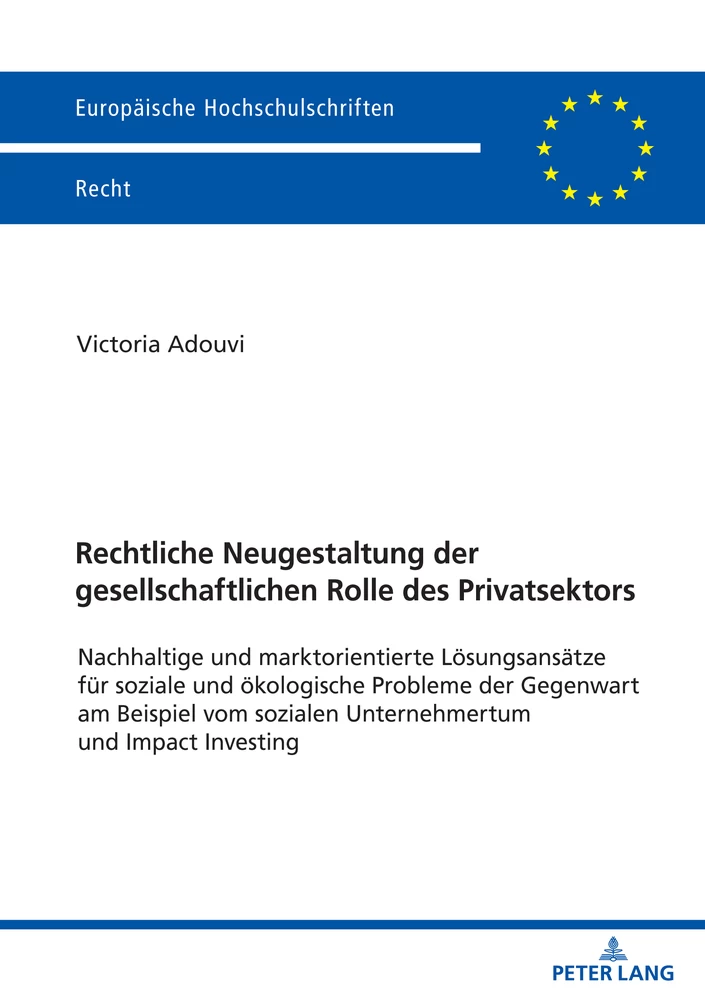Rechtliche Neugestaltung der gesellschaftlichen Rolle des Privatsektors
Nachhaltige und marktorientierte Lösungsansätze für soziale und ökologische Probleme der Gegenwart am Beispiel vom sozialen Unternehmertum und Impact Investing
Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Danksagung
- Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Einführung und Ziel der Arbeit
- Marktwirtschaft und empfundene Widersprüche
- 2.1 Aktuelle Wahrnehmung der Marktwirtschaft und Konfusion der Begriffe
- 2.2 Der Markt – Normative Grundlagen und Kritikpunkte
- 2.2.1 Zum Begriff des Marktes
- 2.2.2 Profitorientierung im Kontext von Smiths Lehre
- 2.2.3 Weitere Kritikpunkte der Marktwirtschaft
- 2.2.4 Entbettung der Märkte
- 2.3 Eine Marktwirtschaft für die Gesellschaft
- Gesellschaftliche Verantwortung des Privatsektors im „Age of Sustainable Development“
- 3.1 Entwicklung des Nachhaltigkeitskonzepts
- 3.1.1 Entwicklung der Sustainable Development Goals
- 3.1.2 SDGs als Vision einer neuen Gesellschaftsordnung
- 3.2 Übertragung der gesellschaftlichen Verantwortung auf Akteure der Marktwirtschaft
- 3.2.1 Ebene des Unternehmertums – Corporate Social Responsibility
- 3.2.1.1 Entwicklung des Konzepts der gesellschaftlichen Verantwortung der Unternehmen
- 3.2.1.1.1 Social Responsibilities of the Businessman nach Bowen
- 3.2.1.1.2 Verantwortungspyramide nach Caroll
- 3.2.1.1.3 Tripple-Bottom-Line von Elkington
- 3.2.1.2 Status quo: konzeptionelle Anarchie im Kontext einer Standardisierung
- 3.2.1.2.1 Aktuelle Forschungsansätze
- 3.2.1.2.2 Standardisierung der ISO
- 3.2.1.3 Begründungsansätze der gesellschaftlichen Verantwortung der Unternehmen
- 3.2.1.3.1 Wirtschaftliche Faktoren als Begründung – der sog. „Business case“
- 3.2.1.3.1.1 Vom aufgeklärtem Interesse bis zur ethischen Verflechtung
- 3.2.1.3.1.2 Mögliche Fälle von Business case
- 3.2.1.3.1.3 Schaffung eines gesellschaftlichen Mehrwerts
- 3.2.1.3.2 Soziale Faktoren als Begründung - der sog. „Social case“
- 3.2.1.3.2.1 Stakeholder-Theorie als Bruch der klassischen Shareholder-Doktrin
- 3.2.1.3.2.2 Neo-institutionelle Organisationstheorie
- 3.2.1.3.3 Politische Begründungsansätze und ethische Erwägungen
- 3.2.1.3.3.1 Unternehmen als politische Akteure
- 3.2.1.3.3.2 Politische CSR und systematische Verantwortung
- 3.2.1.3.3.3 Aktuelle Entwicklungen und Tendenz zur politischen Verantwortung- sübernahme im Bereich der Wirtschaft
- 3.2.2 Ebene der Investoren
- 3.2.2.1 Grundlagen der kollektiven Vermögensanlage
- 3.2.2.2 Gesellschaftliche Verantwortung im Bereich der kollektiven Vermögensanlage
- 3.2.2.3 Entstehung des Konzepts von (Socially) Responsible Investments
- 3.2.2.4 Strategien der verantwortungsvollen Investments
- 3.2.2.4.1 Negative Screenings und Ausschlüsse
- 3.2.2.4.2 Positive Screenings und Best-in-Class-Ansatz
- 3.2.2.4.3 ESG-Integration
- 3.2.2.4.4 Themenfonds
- 3.2.2.4.5 Shareholder Engagement
- 3.2.2.5 Offene Herausforderungen und aktuelle Markttendenzen im Bereich der SRI
- 3.3 Erstrebenswertigkeit der gesellschaftlichen Verantwortung des Privatsektors
- 3.3.1 Zurück zu Adam Smith und seiner Lehre
- 3.3.2 Ludwig von Mises
- 3.3.3 Milton Friedman
- 3.3.4 Treuhänderische Pflichten als wahrgenommener Widerspruch der gesellschaftlichen Verantwortungsübernahme
- 3.3.5 Erkenntnisse des sog. Freshfields report und des Berichts Who cares wins
- Nachhaltigkeitsorientierte Erneuerung der Marktwirtschaft „von innen heraus“: Potential des Privatsektors am Beispiel vom sozialen Unternehmertum und Impact Investing
- 4.1 Nachhaltigkeitsbezogenes Neuverständnis der gesellschaftlichen Verantwortung des Privatsektors
- 4.2 Konzept des sozialen Unternehmertums
- 4.2.1 Historische Entwicklung in verschieden soziokulturellen Kontexten
- 4.2.2 Diverse konzeptuelle Ansätze und dominierende Meinungsschulen
- 4.2.2.1 Social Innovation School
- 4.2.2.2 Social Enterprise School
- 4.2.3 Abwägungserwägungen und modernes Verständnis des sozialen Unternehmertums
- 4.2.4 Finanzierung des sozialen Unternehmertums
- 4.2.4.1 Besondere Finanzierungshürden des sozialen Unternehmertums
- 4.2.4.2 Gängige Finanzierungsformen des sozialen Unternehmertums
- 4.3 Impact Investing als besondere Form der verantwortungsvollen Investments und Frage der Renditeerwartung
- 4.3.1 Impact Investing, sein Wirkungsmechanismus und Mehrwert für die Realwirtschaft
- 4.3.2 Streit um Anspruchsprimat zwischen finanzieller Rendite und gesellschaftlicher Wirkung
- 4.3.3 Spektrum der Renditeerzielungserwartung im Bereich von Impact Investing und Stellungnahme unter Einbeziehung nachhaltigkeitsbezogener Erwägungen
- 4.4 Potential von wirkungsorientierten Formen des Privatsektors: praktische Beispiele
- 4.4.1 Beitrag von Impact Investoren zur Förderung des sozialen Unternehmertums
- 4.4.1.1 Pandemiebedingter Überlebenskampf des sozialen Unternehmertums und Antwort der Impact Investoren
- 4.4.1.2 R3 Coalition als Beispiel einer erfolgreichen Impact-Investing-Initiative
- 4.4.2 Langfristiges Wirkungspotential sozialer Unternehmen
- 4.5 Geteilte Verantwortung für einen nachhaltigen Transformationsprozess
- 4.5.1 Ebene des Privatsektors – Neues Rollenverständnis der Market Player
- 4.5.2 Rolle der Gesellschaft – Mitbestimmung über die Zukunftsentwicklung
- Der aktuelle rechtliche Rahmen der EU und seine größten ungelösten Probleme
- 5.1 Nachhaltigkeitskonzept in der EU
- 5.1.1 Richtungsgebende Entwicklungen
- 5.1.2 Aktuelles Verständnis der Nachhaltigkeit
- 5.1.2.1 Aktionsplan zur Finanzierung nachhaltigen Wachstums
- 5.1.2.2 Bestimmung einer nachhaltigen Investition im Sinne der sog. Offenlegungsverordnung
- 5.1.2.3 Klassifikationssystem für ökologische und soziale Nachhaltigkeit
- 5.1.2.4 Der sog. „Grüne Deal“ und eine neue Vision für die Zukunft
- 5.1.3 Gesellschaftliche Verantwortung und die Rolle des Privatsektors in der EU
- 5.1.3.1 Entwicklung des konzeptuellen Verständnisses der gesellschaftlichen Verantwortung
- 5.1.3.2 Praktische Auswirkungen der Änderung der sog. CSR-Richtlinie
- 5.1.3.3 Vertrauen des Gesetzgebers in das Potential des Privatsektors
- 5.2 Rechtliche Regulierung des sozialen Unternehmertums und Impact Investing
- 5.2.1 Rechtliche Stellung des sozialen Unternehmertums in der EU
- 5.2.1.1 Initiative für soziales Unternehmertum und die Bewertung ihrer Umsetzung
- 5.2.1.2 Vorschlag eines EU-weiten Statuts für soziale Unternehmen
- 5.2.2 Einführen des Europäischen Fonds für soziales Unternehmertum (EuSEF)
- 5.2.2.1 EuSEF als spezielles Fondsvehikel zur Finanzierung des sozialen Unternehmertums
- 5.2.2.2 Überarbeitung der EuSEF-Verordnung
- 5.3 Kritische Würdigung und wünschenswerte Schritte des Gesetzgebers
- Schlussbetrachtung und Hauptthesen der Arbeit
- Literaturverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Einführung und Ziel der Arbeit
Diese Arbeit hat die Schwierigkeiten der rechtlichen Regulierung solcher Formen des Unternehmertums und der kollektiven Vermögensanlage zum Gegenstand, die neben der klassischen Profitorientierung auch darum bemüht sind, durch die wirtschaftliche Aktivität eine positive gesellschaftliche Wirkung zu erzeugen. Obwohl diese Formen des Unternehmertums schon seit mehreren Jahrhunderten existieren und später auch auf Ebene der Investments entwickelt wurden, sieht sich diese spezifische, auf „Profit & Purpose“ ausgerichtete Art des Privatsektors, noch mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert, von denen die signifikanteste der Konflikt zwischen den privaten und öffentlichen Interessen bzw. zwischen der Profitmaximierung und den Belangen der Gesellschaft ist. Diese Belange können unterschiedlichen Charakter haben und beschränken sich nicht nur auf soziale Thematiken (bspw. soziale Ungleichheit, unfaire Arbeitsbedingungen oder Verletzung der Menschenrechte), sondern werden angesichts der bedrohlichen Ereignisse im Zusammenhang mit dem Klimawandel (bspw. globale Erwärmung, extreme Hitzewellen oder Dürren) und der Umweltverschmutzung zunehmend auch um umweltbezogene Themen erweitert.
Der Privatsektor und insbesondere das Unternehmertum wurden in der Vergangenheit als ein Teil des Problems gesehen, denn unter Umständen kann die unternehmerische Tätigkeit zu den beschriebenen Problemen führen. Das geschieht insbesondere dann, wenn Unternehmen lediglich wirtschaftliche Faktoren im Blick haben und im Sinne einer möglichst schnellen Gewinnerzielung solche Geschäftspraktiken einsetzen (oder bezogen auf Ebene der Investments Gelder in solche Anlagen bzw. Projekte investiert werden), die keine Rücksicht auf die Bedürfnisse der Gesellschaft und der Umwelt nehmen. Wenn Unternehmen bspw. aus sozialer Sicht zwar wünschenswerte, in rechtlicher Sicht aber (noch) nicht verbindliche Standards zum Zwecke der Kostensenkung missachten oder billige, für die Umwelt jedoch schädliche Produktionsverfahren verwenden, führt dies zur Perpetuierung der sozialen Ungleichheit oder zur Umweltverschmutzung, ggfs. verbunden mit dem Verlust von ökologischer Biodiversität oder sogar mit schwerwiegenden Folgen für die Gesundheit der lokalen Bevölkerung.
Nach einer denkbaren Auslegung der von Adam Smith formulierten These der unsichtbaren Hand des Marktes – welche bis heute als eins der wichtigsten Prinzipien einer marktbasierten Wirtschaftsordnung darstellt – haben Unternehmen (bzw. Investoren) grundsätzlich kein eigenes Interesse daran, ihre ←17 | 18→Geschäftsstrategie zugunsten einer besseren sozialen oder ökologischen Verträglichkeit zu verändern, da dies in den allermeisten Fällen mit höheren Kosten und infolgedessen mit geringer Rentabilität einhergehen würde. Unternehmen und Investoren sollten jedoch als wichtige Wirtschaftsakteure – so die Sichtweise eines Meinungsspektrums – rational und wirtschaftsorientiert handeln und zum Gemeinwohl dadurch beitragen, dass sie ihre Gewinne steigern. Dies sei zudem nicht nur aus wirtschaftlicher, sondern auch aus rechtlicher Sicht geboten, da die Unternehmensführung gegenüber den Anteilseignern (und entsprechend die Vermögensverwalter von Investmentfonds gegenüber den Anlegern) zur Wertsteigerung des Unternehmens (bzw. der Anlage) verpflichtet ist und somit lediglich die Interessen der Anteilseigner (bzw. der Investoren) zu berücksichtigen hat (bzw. haben). Die Akteure der marktbasierten Wirtschaft seien danach als „Gewinnmaximierer“ zu verstehen und ihr primärer Zweck bestehe nicht in der Förderung diverser gesellschaftlicher Ziele, sondern in der Erzielung von Gewinnen, da dies der Gesellschaft in ihrer Gesamtheit am stärksten zugutekommen würde.1
Während sich dieses erste Meinungsspektrum für die Kräfte des freien Marktes ausspricht, fordern andere dagegen eine stärkere Regulierung des Marktes durch die öffentliche Hand. Die Ergebnisse der soziologischen Untersuchungen zeigen, dass die Ereignisse der letzten Jahre zu einem allgemeinen Schwund des Vertrauens in die aktuelle Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung führten; zu dem systemkritischen Narrativ schien insbesondere der empfundene Widerspruch zwischen den moralischen Vorstellungen von Würde, Solidarität und Gerechtigkeit einerseits und der aktuellen Gestaltung und der ökonomischen Erfordernisse der Marktwirtschaft andererseits zu führen.2 Insbesondere die Gewinnorientierung wird dabei als besonders verwerflich gesehen, was dazu führt, dass die Grundlogik einer marktbasierten Wirtschaft zu schnell verurteilt wird. Nach der Ansicht des zweiten Meinungsspektrums müsse bspw. ein gesellschaftlich akzeptables Handeln von den auf Profit ausgerichteten Unternehmen erst durch die Benachteiligten abgerungen werden.3 Zudem wird behauptet, dass die Gewinnerzielungsabsicht automatisch eine rücksichtslose Gier bedeute und sich Menschen unter Marktbedingungen anders als sonst, und zwar unmenschlicher und unsozialer verhalten würden.4
←18 | 19→Einige marktkritische Stimmen können – zunächst losgelöst von deren Argumentationsansatz – nicht einfach ignoriert werden, denn unsere Wirtschaftsordnung scheint nicht in ausreichendem Maße widerstandsfähig zu sein, was schließlich auch das enorme Ausmaß der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie offenbarte; auf globaler Ebene führte die Corona-Krise bspw. zur größten Rezession seit dem zweiten Weltkrieg,5 sodass die Menschheit an einem entscheidenden Punkt der Geschichte steht. Die Marktwirtschaft ist ein altes System und erfuhr bereits einige Modifikationen, doch diese scheinen angesichts der beschriebenen Probleme der Gegenwart nicht mehr die optimalen Lösungen zu bieten. Es ist Zeit zum Umdenken, doch den Markt und alle seine Vorteile zu verwerfen ist kein Ausweg. Vielmehr muss die Marktwirtschaft einer Neugestaltung unterzogen werden, und zwar so, dass sie widerstandsfähiger wird und den Bedürfnissen der heutigen Gesellschaft besser entsprechen kann.
Als das fehlende Puzzleteil bei der Gestaltung einer zukunftsfähigen Form der Marktwirtschaft kann das Konzept der Nachhaltigkeit erachtet werden. Dieses erfährt eine große Beachtung (spätestens) nach der Einigung der UN-Mitgliedsstaaten auf die Notwendigkeit der Entwicklung einer globalen und zielorientierten Nachhaltigkeitsagenda, welche durch die Verabschiedung der Agenda 2030 mit ihren 17 Zielen für Nachhaltige Entwicklung (sog. SDGs) ihren Niederschlag gefunden hat. Seitdem gehört die Nachhaltigkeit zum leitenden Motiv der europäischen Politik und der rechtlichen Regulierung des Privatsektors, welchem eine bedeutende Rolle bei der Nachhaltigkeitswende zugeschrieben wird.
Diese Sicht auf die Rolle des Privatsektors geht mit der seit mehreren Dekaden zu beobachtenden Tendenz einher, dass vom Privatsektor zunehmend eine stärkere gesellschaftliche Verantwortungsübernahme erwartet wird. Allmählich wächst nämlich das Bewusstsein, dass das unternehmerische Handeln auch eine Verantwortung gegenüber der Gesellschaft impliziert, welche über die Einhaltung der bloßen rechtlichen Verpflichtungen hinausgeht. Auch Anleger und Vermögensverwalter verändern ihr Selbstverständnis und berücksichtigen bei ihren Anlageentscheidungen immer häufiger auch andere als rein finanzielle Aspekte. In diesem Zusammenhang entstand eine breite Palette von Konzepten und Begriffen, von denen „Corporate Social Responsibility“ (nachfolgend „CSR“) (auf Ebene des Unternehmertums) bzw. „(Socially) Responsible Investments“ (nachfolgend „(S)RI“) (auf Ebene der Investoren) am häufigsten verwendet werden. Deren inhaltliche Auslegung änderte sich stark im Laufe der Zeit und bis ←19 | 20→heute besteht kein allgemeiner Konsens; seitens der europäischen Regulatorik ist jedoch ersichtlich, dass die gesellschaftliche Verantwortung des Privatsektors an das Konzept der Nachhaltigkeit angelehnt werden soll.
Wenn man sich von der Überzeugung loslöst, den Markt als die Ursache der brennendsten sozialen und ökologischen Probleme der Gegenwart zu sehen und die Marktwirtschaft im Sinne des Nachhaltigkeitsgedanken neu gestaltet, könnte der Markt sogar behilflich dabei sein, angemessene Lösungen für die beschriebenen Probleme zu entwickeln. Dann müsste man auch nicht zwischen den Optionen Markt oder Staat bzw. individuelles versus kollektives Interesse entscheiden, sondern könnte die Wirtschaft so gestalten, dass diese sich gegenseitig fördern und zu einer Symbiose gelangen. Der Markt selbst kann also einen wichtigen Beitrag zur Bewältigung der Herausforderungen der heutigen Zeit leisten, denn diverse unternehmerische und investmentbezogene Ansätze haben bereits mehrfach bewiesen, dass sich neue Geschäftsmodelle auch dort entwickeln lassen, wo dem Staat zum großen Teil die Hände gebunden sind bzw. dort, wo er lediglich mittels Förderung durch öffentliche Gelder agieren kann.
Der Privatsektor beteiligt sich immer mehr an der Entwicklung neuer Lösungsansätze, welche die Marktwirtschaft von innen heraus transformieren und die geforderte Resilienz stärken könnten. Die gesellschaftliche Verantwortung des Privatsektors bezieht sich nicht mehr lediglich auf die Reduzierung von negativen Effekten, sondern auf eine direkte positive Wirkung für die Gesellschaft. Das beste Beispiel einer solchen Form des verantwortungsvoll handelnden Privatsektors stellt auf Ebene der Unternehmen das soziale Unternehmertum und auf Ebene der Investoren das Impact Investing dar. Diese weisen nämlich einige gemeinsame Charakteristika auf, welche sie sowohl vom Sektor der Gemeinnützigkeit als auch von rein konventionellen, gewinnorientierten Wirtschaftsaktivitäten abgrenzen, bspw. die Zielsetzung einer positiven sozialen und/oder ökologischen Wirkung und innovative Geschäftsmodelle mit großem Transformationspotential.
Details
- Seiten
- 266
- ISBN (PDF)
- 9783631887356
- ISBN (ePUB)
- 9783631887363
- ISBN (MOBI)
- 9783631887370
- ISBN (Paperback)
- 9783631887035
- DOI
- 10.3726/b20069
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2023 (Januar)
- Erschienen
- Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 2023. 266 S., 10 s/w Abb.
- Produktsicherheit
- Peter Lang Group AG